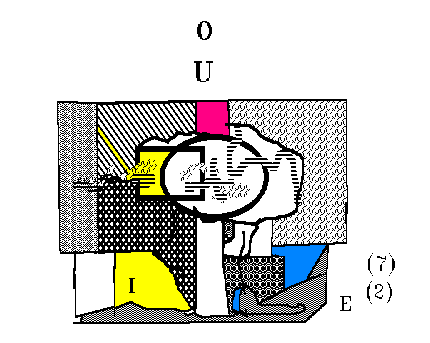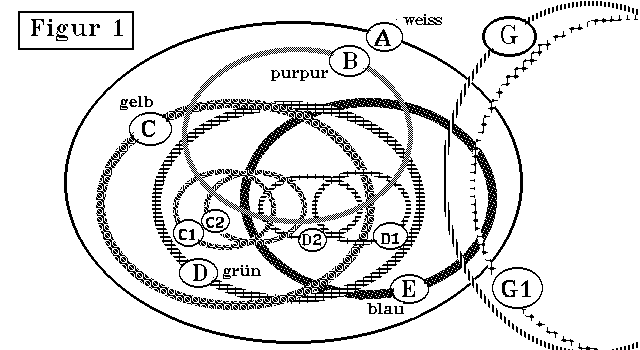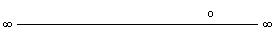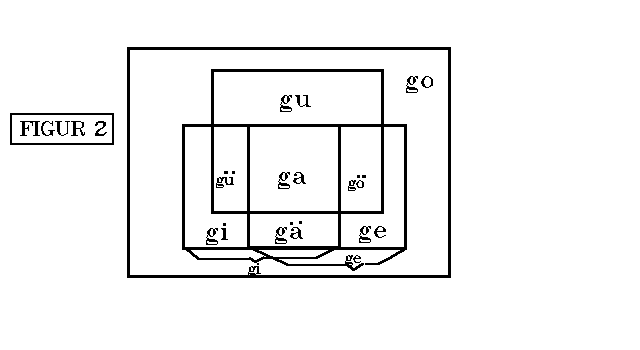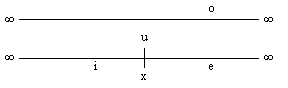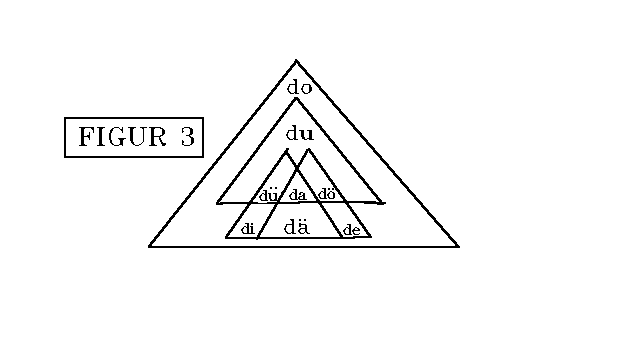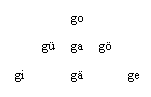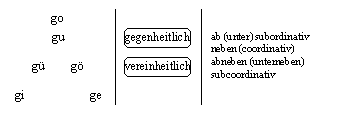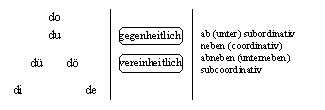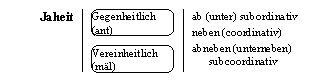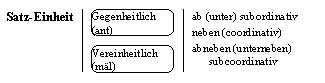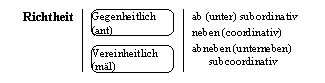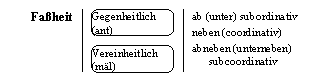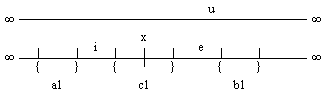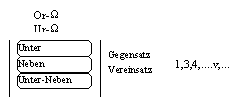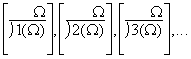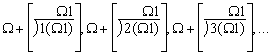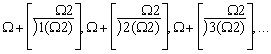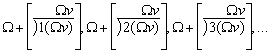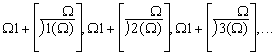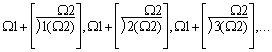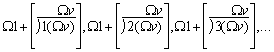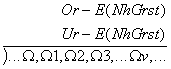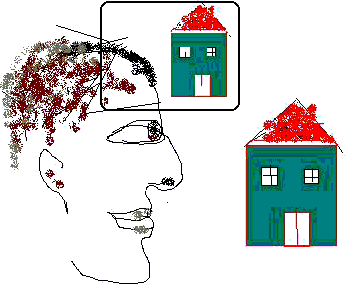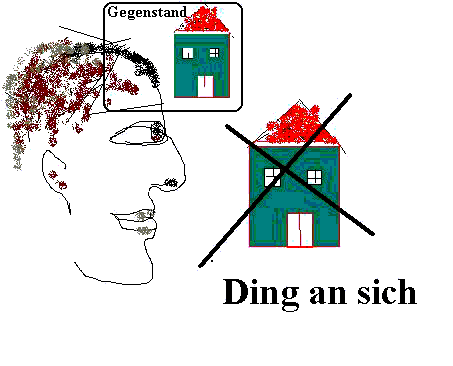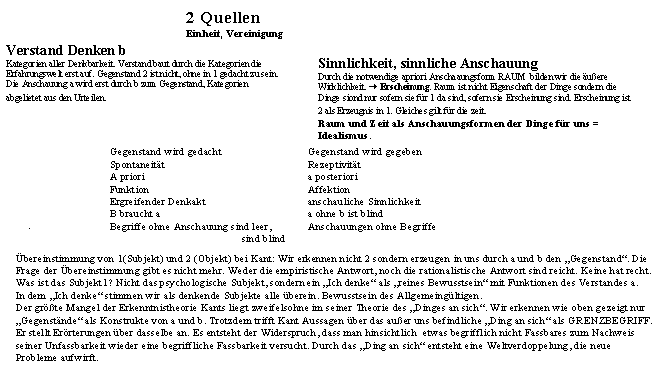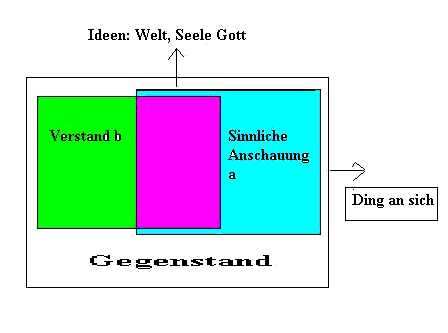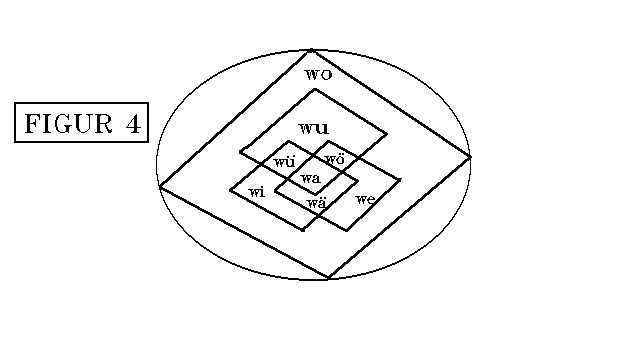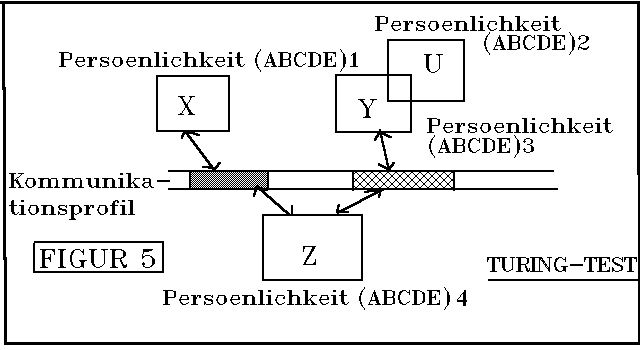Wir benützen die
FIGUR 1. Ein Mensch erkennt die Welt außer sich, Natur
G (Landschaft, Bäume usw.) und die Gesellschaft G(1) um sich, also z. B.
seine Familie, die deutsche Sprache, die Zeilen, die er hier liest. Eine
Außenwelt, Natur G und eine Gesellschaft G(1), erkennen wir nicht
unmittelbar. Zugänglich sind uns von ihr nur Zustände unserer Sinnesorgane
des Körpers E (blau) – vgl. unter 1.2.1 –, die wir hereinnehmen in die
Phantasie D (grün). Durch die nachbildende äußere
Phantasie D(1) und die schöpferische, innere Phantasie D(2) und mit
Begriffen C (gelb), die wir teilweise bereits bei der Geburt in unserem
"Bewusstsein" besitzen (C1), teils aus dem Gesellschaftssystem G(1)
übernehmen, in welches wir hineingeboren werden C(2), bilden, konstruieren
und konstituieren wir eine in der Person, im Subjekt, in uns bestehende
(subjektimmanente) Erkenntnis der "Außenwelt". Für jeden
Ungewohnten erscheint es ein wenig kühn, wenn er hört: "Ich weiß gar
nicht, wie die 'Außenwelt' aussieht, denn was ich von ihr weiß, ist nichts
als ein Bild, ein Konstrukt, das ich mir davon mache. Ich sehe nur, was in
meinen Augennerven ist, aber nicht die Abendsonne, die ein Blatt
durchleuchtet."
Nur das
Angewirktsein der Sinne durch die "Außenwelt" kommt von außen,
alle übrigen Tätigkeiten sind
aktive, erzeugende Handlungen im Bewusstsein des
Menschen. Die genaue Unterscheidung von D(1) und D(2) ist dabei ebenso
wichtig wie die Unterscheidung der Begriffe, die schon bei Geburt gegeben
sind, von jenen, die über die Gesellschaft und deren Sprache im Rahmen der
Sozialisation erworben werden. Da jeder in einer sozialen Umwelt geboren
wird, die durch die Faktoren der Gesellschaft (wie z. B. Sprache, Kultur,
Wirtschaft, Politik, Schichtung) bestimmt ist, tritt eine Einwirkung aller
dieser Faktoren auf E, D und C ein, die zu einer Kanalisierung und
Regulierung, entsprechend den Färbungen der Gesellschaft, führt.
Die Probleme der
Erkenntnis der Außenwelt über die Sinne wollen wir jetzt ausführlicher
behandeln.
1.2.1 Erkenntnis
von Außenwelt
1.2.1.1
Äußerlich sinnliche Erkenntnis mittels E, D(1), D(2), C, B, A
Für die Kenntnis
der Welt um uns brauchen wir einen Leib. Der Zustand der Sinnesorgane, also
der "Stempel", den das Außen auf ihnen erzeugt, ist alles, was von
außen ist. Ein Blinder erhält auf der Netzhaut keine "Spuren".
Er lebt daher in einer "anderen" Welt.Wir zitieren im folgenden, oft
leicht verändert, aus den erkenntnistheoretischen Schriften KRAUSEs.Von
diesen Zuständen in den Sinnen behaupten wir, sie seien Wirkungen
äußerer, "wirklicher" Gegenstände, die in Raum und Zeit sind,
die mit unserem Leib, also mit Augen, Nase, Ohren, Haut usw., in einer
Wechselwirkung stehen, wobei aber diese Sinnesorgane bei der Erzeugung dieser
Empfindungen selbst auch aktiv mitwirken. Wir behaupten dann auch gleich –
eigentlich sehr kühn –, dass einerseits diese Gegenstände auch
unabhängig davon, dass sie in unseren Sinnen Wirkungen erzeugen,
existieren und dass sie andererseits unabhängig von unserer Sinnlichkeit
und unserer Fähigkeit und Möglichkeit, sie wahrzunehmen, gegeben
sind.Allgemeine Bedingungen für die Sinneswahrnehmung sind:1. Ein organischer Leib, seine
Sinnesorgane, das Nervensystem, durch welches alle Sinnesorgane unter sich
mit dem gesamten Nervensystem und mit dem ganzen Leib in Verbindung stehen (Koordinierungs–
und Integrierfunktion des Nervensystems und des Hirns). Einzelne Sinne können
manchen Menschen fehlen, kein einziger aber allen. Die "Welt" würde
sich schlagartig ändern, wenn alle Menschen plötzlich taub wären.2. Dasein und Wirksamkeit der unseren
Leib umgebenden Sinnenwelt, wobei wir auch noch annehmen können, dass die
"Naturprozesse", die in unserem Körper ablaufen, wenn wir die Natur
erkennen, zu den "Naturprozessen außerhalb unser" in einem
bestimmten Verhältnis stehen.3. Schließlich
müssen wir uns den Sinneseindrücken hingeben, hinmerken, darauf acht
geben.Jeder Sinn stellt ihm Eigentümliches dar. Die Bestimmung der Größe
und des Grades der Anwirkung ist für die Wahrnehmung wichtig.
1.2.1.1.1 Der
Tastsinn
Hauptsitz im
Organ der Haut, besonders Zunge und Fingerspitzen. Jeder Nerv aber ist Teil
des Tastsinns. Der Tastsinn ist der allgemeinste Sinn, der sich auf die
allgemeinsten Eigenschaften der Körper, auf den Zusammenhalt in festem und
flüssigem Zustand nach Wärme und Kälte bezieht. Die Anwirkungen halten in
ihm am relativ längsten an, er ist aber der beschränkteste Sinn, denn man
muss ja "den Gegenstand" selbst berühren. Man nimmt auch im
Verhältnis zu anderen Sinnen mit dem Tastsinn die kleinste Mannigfaltigkeit
wahr. Wir nehmen im Tastsinn nur Zusammenhaltbestimmtheiten des Tastnervs
selbst wahr, mögen sie nun mechanisch oder durch Erwärmung und Erkältung
erfolgen, wobei sich eine große Mannigfaltigkeit einzelner besonderer
Empfindungen ergibt. Fast jede dieser weiteren Bestimmtheiten des Tastgefühls
zeigt durch das Gefühl von Lust und Unlust eine wesentliche Beziehung zum
Leib. In diesem Sinne gibt es einen weiten Bereich von Gradverschiedenheiten,
wodurch dieser Sinn zur Orientierung in der äußeren Sinnenwelt und zur
Untersuchung der Organe des eigenen Körpers hinsichtlich der Kohäsion
besonders geeignet ist. Mittelbar aber schließen wir von den unmittelbar
wahrgenommenen Kohäsionsbestimmtheiten unserer Nerven auch auf Gestalt,
Ort, Stelle und Bewegung desjenigen Stoffes, welcher die wahrgenommenen
Kohäsionsbestimmtheiten unseres Nervs innerhalb der Wechselwirkung dieses
Gegenstandes mit allem ihn umgebenden Leiblichen verursacht. Dies erreichen
wir aber nur durch Schlüsse. Bei dieser Auslegung des Tastgefühls
dienen uns als Grundlage bestimmte, nichtsinnliche Begriffe, Urteile und
Schlüsse (C in
FIGUR 1), die wegen der Allgemeinheit und
Allgemeingültigkeit, die wir ihnen beimessen, nicht aus der Sinneswahrnehmung
entsprungen sein können.
Solche Begriffe
sind etwa: Das Gefühl im Tastsinn ist weder lang, noch breit, noch tief, ist
gar kein Stoff. Daher müssen wir diesen Gedanken schon unabhängig von dieser
Empfindung des Tastgefühles haben, wenn wir behaupten, einen Stoff
wahrzunehmen. Ferner bringen wir den Gedanken der Bewegung hinzu, denn auch
dieser liegt nicht in dem einfachen Gefühl. Bewegung können wir nicht
anschauen ohne Zeit, weil Bewegung Änderung ist. Folglich bringen wir auch
den Gedanken der Zeit hinzu. Nun beobachten wir aber, dass wir uns mittels
dieser Gedanken des Räumlichen und Zeitlichen in unserer Phantasie dasjenige
vorstellen, woran wir diese Empfindung als seiend denken und wodurch wir sie
uns als verursacht vorstellen. Dies wird recht offenbar, wenn man sich einen
Blinden denkt oder wenn man sich selbst denkt, wie man sich an finsteren Orten
durch das Gefühl weiterhilft. Da kann man weder seinen Leib noch das Äußere
sehen. Trotzdem wird das bestimmte einfache Tastgefühl Anlass dazu, dass
sich der Blinde, der geblendet Sehende oder der Mensch im Finsteren
innerlich in Phantasie (D in FIGUR 1) ein Bild vom Äußeren
entwirft, das ihn umgibt. Nun beinhaltet aber das, was der Blinde, der
Geblendete oder der Mensch in Dunkelheit mit tastenden Händen erspüren,
weder Raum noch Stoff, auch erkennen diese gar nicht durch das Gesicht, und
dennoch bilden sie diese innere Welt der Phantasie. Sie behaupten, dies
geschehe der äußeren Welt entsprechend. Daraus sehen wir, dass das
Vorhandensein der Welt der Phantasie (D) und unser freies Schaffen darin auch
eine Grundbedingung dafür ist, dass wir die einzelnen Tastgefühle auf Raum
und Materie beziehen können.
Aber bei dieser
Auslegung des "dumpfen" Tastgefühles sind noch viel höhere
Voraussetzungen erforderlich, und es sind dabei viel höhere geistige,
kognitive Verrichtungen wirksam als nur die Welt der Phantasie, die wir weiter
unten noch ausführlich analysieren werden. Denn wir müssen ganz allgemeine
Begriffe, Urteile und Schlüsse (C in FIGUR 1) – z. B. "etwas",
"etwas Bestimmtes" – hinzubringen, von welchen die einfache
Empfindung des Tastgefühls gar nichts enthält. Hätten wir einen solchen
Begriff nicht, so könnten wir gar nicht denken, dass wir etwas fühlen oder
etwas durch Gefühl wahrnehmen. Weiterhin benützen wir den Gedanken
"Eigenschaft", indem wir die Tastempfindung als Eigenschaft dessen,
was wir im Gefühle wahrnehmen, betrachten. Überdies verwenden wir die
Begriffe: Ganzes, Teil , Verhältnis, Beziehung, Grund und Ursache. Denn wir
denken ja, dass das äußere Objekt und unsere Sinne Grund und Ursache dieser
Empfindung sind. Wir benützen aber auch Urteile und Schlüsse. Zum
Beispiel: "Hier ist etwas, ein Objekt; hier ist eine Wirkung; hier ist
eine Empfindung." Demnach muss die Empfindung, wie alles Bestimmte, eine
Ursache haben. Da ich selbst nicht die Ursache bin, folglich muss etwas
anderes da sein, was Ursache der Empfindung ist. Hier ist eine Eigenschaft,
also muss etwas sein, woran die Eigenschaft gebunden ist, etwas im Raum
Selbständiges, das auch in der Ausdehnung über längere Zeit anhält.
Diese Begriffe,
Urteile und Schlüsse sind uns bei der Auslegung
des Sinnes in unserem gewöhnlichen Bewusstsein so
geläufig, wir wenden sie mit so großer Kunstfertigkeit an, dass wir uns
derselben nur selten bewusst werden. Durch diesen Umstand des
Nichtbewusstwerdens dieser Voraussetzungen lassen sich viele verleiten zu
behaupten, die Anerkenntnis der äußeren Gegenstände mittels der Sinne
sei unmittelbar, und zwar geschehe sie auf eine uns unbegreifliche Weise. Aber
wer auf sich selbst hinmerkt, der findet, dass es so geschieht, wie wir hier
feststellten. Und wir dürfen unser gebildetes Bewusstsein, das sich bereits
eine kunstfertige Beherrschung unseres Leibes erworben hat, nicht mit dem
Zustande des Kindes verwechseln, welches sich erst jene Fähigkeit nach und
nach erwerben muss. Bei dieser geistigen Arbeit können wir auch die Kinder
beobachten. Es geht uns in unserem reifen Bewusstsein mit der Auslegung der
Sinne so wie einem Weber oder Orgelspieler. Wir bringen die kognitive
Tätigkeit und die Tätigkeit unserer Phantasie, während wir sie
durchführen, nicht ins Bewusstsein, weil wir sie schon beherrschen. Wie sich
auch der Orgelspieler dessen nicht bewusst wird, wie er die Noten sehen,
verstehen und durch ganz bestimmte geistige Tätigkeit seine Finger und Füße
bewegen muss. Wenn aber der Orgelspieler oder der Weber sich an die Zeit
erinnert, wo er die Kunst erst erlernte, so wird er sich auch erinnern, wie
er sich anfänglich jeder dieser Tätigkeiten bewusst werden musste, wie er
alles einzelne einzeln einüben musste, um endlich zur Kunstfertigkeit zu
gelangen. Ein solches aber noch viel höherartiges Instrument als die
Orgel dem Orgelspieler ist jedem Bewusstsein (jeder "kognitiven
Instanz") der Leib. Erst nach und nach werden wir des Leibes mächtig,
erst nach und nach lernt der Mensch die Sinne verstehen und seinen Leib zu
gebrauchen.
Wir können uns
z. B. in einem finsteren Keller beim Tasten im Dunkeln täuschen. Was
täuscht sich da? Die Wirkung auf den Tastsinn ist wie immer. Aber wir legen
diese Eindrücke falsch aus, wir machen uns "falsche Bilder" von
dem, was wir da tasten, und wir schließen falsch auf das, was da
"draußen" ist. Wir können uns auch z. B. bei Helligkeit täuschen,
wenn wir sitzen und plötzlich einen Druck am Fuß verspüren. Wir wissen
dann nicht, ob wir angestoßen werden oder ob es ein Gegenstand ist, den
jemand an den Fuß gebracht hat. Hier sei auch erwähnt, dass man natürlich
einwenden könnte, die Gedanken, Begriffe usw., die hier zur Auslegung der
Sinne benützt werden, hätten wir nicht ursprünglich, sondern Begriffe,
Urteile und Schlüsse (also C in FIGUR 1) lernten wir erst durch eine
Sprache in einem Gesellschaftssystem. Zum einen legt aber das Kind, wie wir
sehen, die Sinne schon aus, bevor es sprechen lernt. Ja das Erlernen einer
Sprache ist selbst ein Vorgang der Auslegung der Sinne mittels Begriffen,
Urteilen usw. – also mittels "kognitiver Strukturen". Das Kind
legt hierbei Sinneseindrücke (Laute und Zeichen) so aus, dass es darin
Elemente und Zeichen erkennt, die über die sinnliche Dimension hinaus
etwas
anderes bedeuten (Erkennung der Bedeutungsdimension von Zeichen). Ein
Kind hat also schon C-Begriffe bevor es C(s) -Begriffe, C(s) -Urteile einer
Sprache lernt. Eben weil das Perlhuhn das nicht kann, obwohl es auch Sinne
hat, kann es unsere Sprachen nicht erlernen. (Vgl. Pflegerl: Vollendete
Kunst S. 4 f. und S. 109.)
Wir müssen
weiterhin unseren aktiven Einsatz des Tastsinnes beachten. Wir liegen
nicht irgendwo und lassen die "Dinge auf uns einwirken", sondern wir
bewegen ja unseren Körper, um seine Tastempfindungen gezielt, intentional
auf etwas Hartes, auf eine Gegenwirkung hin, eben auf einen
"Gegenstand" zu richten, etwas abzutasten. Wir veranlassen
unseren Körper zu Bewegungen. Auch hier spüren wir in den Tastnerven das
Heben des Armes, die Bewegung des Fußes, und wir spüren das Anstoßen,
die "Eigenschaften" des Körpers. Wir steuern auch Richtung und
Stärke der Bewegung, z. B. des Tastens. Wir können durch diesen aktiven
Einsatz des Tastsinnes unseren eigenen Körper mit Zunge, Händen und
Füßen in absichtlicher Beobachtung kennen lernen. Wir werden uns damit der
Teile unseres Körpers und seiner Gestalt in gleicher Weise wie der
"Gegenstände" außerhalb des Leibes bewusst.
1.2.1.1.2
Geschmackssinn
Der Geschmacks-
wie auch der Geruchssinn kommen dem Tastsinn insofern nahe, als auch bei ihnen
stoffliche Berührung nötig ist. Die Angewirktheit, der "Stempel",
der hier in den beiden Sinnen wahrgenommen wird, ist die Bestimmtheit des
chemisch-organischen Stoffes im Sinnesorgan selbst. Die Empfindung des
Schmeckens enthält eine große Mannigfaltigkeit, mit starken Tendenzen
einer begleitenden Lust- oder Unlustempfindung (Ekel beim Essen bestimmter
Stoffe; Verfeinerung und Differenzierung der Geschmacks"kultur").
Wir nehmen schmeckend nur die chemische Tätigkeitsstimmung unseres Organs,
der Zunge, wahr, keineswegs aber einen äußeren Gegenstand selbst noch
dessen chemische Beschaffenheit. Aber wir übertragen das
Wahrgenommene nach den gleichen Voraussetzungen wie unter 1.2.1.1.1 auf die
Außenwelt. Auch hier benützen wir zur Erzeugung der sinnlichen Erkenntnis
Phantasie D und begriffliche Operationen C und C(s).
Gedankenmodell:
Jemand muss etwas mit verbundenen Augen essen und feststellen, was es ist;
oder wir stellen uns vor, wie ein Rindsbraten mit Kartoffelsalat schmeckt.
Ein Österreicher kann sich aber in der Regel nicht vorstellen, wie Imam
Bayildi schmeckt.
1.2.1.1.3
Geruchssinn
Der Geruchssinn
ist bereits freier als der Geschmacks– und Tastsinn. Man kann auch von fern
Gerüche wahrnehmen. Auch der Tastsinn ist fein und mannigfaltig, womit neue
Schlüsse auf die Beschaffenheit von Körpern oder Erscheinungen in der
Natur möglich sind (z. B. bei einem Rasenbrand oder Ölteppich auf dem Meer).
Erinnert sei hier an den Versuch, in Filmen eine Geruchsdimension zu
integrieren.
1.2.1.1.4
Gesichtssinn
Er ist unter
allen Sinnen der freieste, von Lust und Unlust des Körpers unabhängigste,
das Organ des Auges selbst ist rasch und vielseitiger orientierbar.
Unmittelbar sehen wir keine Welt außerhalb unser, sondern nur auf der
Fläche des Auges Bestimmtheiten des Lichts an Helle und Farbe. (Auch dies
sind schon sehr abstrakte Konstruktionen mit Begriffen und durch Phantasie.)
Aber durch die sprunghaften, ganz oder teilweise scharf begrenzten Umrisse
mehr oder weniger durchsichtiger Körper sowie durch die mittels der
Schatten und des abgestrahlten Lichtes bestimmten, allmählichen
Übergänge der Helligkeit und der Farben begründet das Bild im Auge die
weiteren Schlüsse auf die Lichtbestimmtheiten und Beschaffenheiten der
Gegenstände und auf deren Gestalt, Ort, Stelle und Bewegung. Bei der
Auslegung des Bildes im Auge kommt der bereits ausgelegte und richtig
verstandene Tastsinn dem Bewusstsein erheblich zu Hilfe (integrative
Koordinierung der Auslegungsergebnisse aller Sinne in den kognitiven
Leistungen des Bewusstseins). Dass es aber nur unser erleuchtetes, farbig
bestimmtes Auge, eigentlich eine "physio-chemische Reaktion", ist,
was wir äußerlich sinnlich sehen, wahrnehmen und unter Anwendung
nichtsinnlicher Voraussetzungen C und mit Hilfe von Phantasie D auslegen,
zeigt uns folgende Tatsache: Vernichtung und Krankheit des Organs vernichtet
oder verändert das Sehen; sind die Augen verbunden, sehen wir nichts.
Folgende Erscheinungen können als weitere Denkanstöße für diese
komplizierten Zusammenhänge dienen: Jedes Auge gibt ein besonderes Bild;
solange wir nicht ein Auge schließen, koordinieren wir die beiden Bilder zu
einem Doppelbild; Schwindel bei Aufsetzen einer schlechten Brille;
Farbenblindheit; bei Stoßen oder Drücken des Auges auftretende
Lichterscheinungen; optische Täuschungen; Zusammensehen schnell bewegter
Bilder im Film; perspektivische Verzerrung in die Ferne hin; Benützung dieser
Eigenschaften in der Zentralperspektive der Malerei; Verzerrung durch
Gläser; Benützung von Brillen bei Sehfehlern oder Sehschwäche; Teleskope;
Mikroskope; Reproduzierung des Sehvorganges in Fotografie, Film, Video, wo
wiederum nur Sinnesdaten des Auges ausgelegt werden. Hier ein wichtiger
Einschub über die Grenzen der Beobachtbarkeit der Natur in der
Naturwissenschaft: Werden Mikroerscheinungen in der Natur mit Licht
beobachtet, wird durch die Wirkung des Lichtes des Beobachtungsvorganges der
beobachtete Bereich verändert: Der Vorgang der Beobachtung selbst
verändert das zu Beobachtende, das Beobachtete "verschwindet" in
eine neue Konstellation. Beachten wir aber weiter. Wir sehen ja nicht diesen
Mikrobereich, wie er wirklich ist, wir machen uns ja nur
aus Zuständen in den Augen E mit Phantasiebildern D und Begriffen, z. B. der
wissenschaftlichen Theorie C(T),
ein inneres Bild von der Sache. Nun die entscheidende Überlegung: Nicht nur
durch die Lichtstrahlen, die wir auf das Beobachtungsobjekt lenken, wird
verändert, was wir beobachten, sondern auch durch eine Veränderung in
den Begriffen C(T) und in den Phantasiebildern D wird unsere Beobachtung, das
Beobachtungsergebnis verändert. Es "verschwindet" das eine
Bildergebnis, und es ergibt sich ein anderes. Hinzu kommt: Wir können das
Bild, das wir uns in der Beobachtung gemacht haben, niemals mit der
Wirklichkeit außerhalb unser vergleichen, wir können nicht feststellen, ob
unser Bild dem entspricht, was außerhalb unser ist, denn wir kommen niemals
hinaus zu den Dingen, wir können nur verschiedene Bilder in uns miteinander
vergleichen.
In den letzten
Zeilen haben wir zwei wichtige Grundsätze erwähnt:
·
Das Problem der
Relativität jeglicher naturwissenschaftlicher Erkenntnis, weil sie von den
eingesetzten Begriffen C und den Phantasiebildern D abhängig ist, und
· das Problem, dass wir die Wahrheit
naturwissenschaftlicher Erkenntnis überhaupt nicht durch einen Vergleich
zwischen unserer Erkenntnis und einer "objektiven" Außenwelt
überprüfen können. Beides wird uns weiter unten noch beschäftigen.
1.2.1.1.4.1
Vergleich Retina – Computer
"Um nur 100
Millisekunden der Arbeit einer einzigen Nervenzelle der Retina in einem
Rechner zu simulieren, müssten gleichzeitig 500 nichtlineare
Differentialgleichungen hundertmal gelöst werden. Auf einem der
schnellsten Computer, dem Superrechner CRAY, würde dies mehrere Minuten
Rechenarbeit beanspruchen. Umgerechnet auf die normale Funktion der
Retina pro Sekunde, benötigte der Superrechner mindestens 100 Jahre (EBELING)."
1.2.1.1.4.2
"Ich sehe eine Rose"
Für das
Verständnis der Beziehung zwischen DI und MI ist bereits die sorgfältige
Analyse dieser hochkomplexen Vorgänge bei der Erkenntnis der Außenwelt
bedeutungsvoll. Darum noch ein Hinweis: "Ich sehe eine Rose", sagt
man. Das unmittelbar Wahrgenommene der sinnlichen Erkenntnis ist hierbei
lediglich dieses bestimmte flächige Bild im Auge E. Aber sogleich bearbeite
ich das Bild weiter, indem ich dasselbe durch Phantasietätigkeit gleichsam
plastisch vollende, wobei ich dann auch früher durchgeführte Anschauungen
davon erneuere und aktiv mit Phantasie hinzufüge, was ich sonst schon
einzeln sinnlich in Erfassung der Rose erkannt habe. Ich besitze sodann
eigentlich ein vereintes Bild aus dem reinen Augenbilde und dem
Phantasiebilde, wobei ich aber dieses vereinte Bild für das
Bild der Rose selbst halte. Ich glaube also, dies alles soeben an der Rose
selbst zu erblicken. Ich vermeine, die Farben, die in meinen Augennerven
wahrgenommen werden, als an der Rose selbst haftende und als außerhalb
meines Leibes an dem Ort, wo die Rose selbst ist, vorhandene wahrzunehmen.
Aber auch dabei lässt es das denkende und schauende Bewusstsein nicht
bewenden, sondern es trägt dieses Vereinbild, ein plastisch
raumzeitliches Phantasiebild im Bereiche D(1), in welches es seine
reinsinnliche Anschauung aufgenommen hat, dann wieder hinaus in die
angeblich äußere Natur.
Indem ich die
Rose an einem Rosenstock erblicke, der vor mir in einem Garten steht, trage
ich das innerlich vollendete Vereinbild davon auch
im Bewusstsein hinaus. Ich projiziere das Bild hinaus, ich sage mir:
"Das Bild ist nicht in dir, es ist außer dir 'im Garten.'" Ich
trage es hinüber an diese bestimmte Stelle im Raum und eben dann, wenn der
Mensch dies in seinem "vorwissenschaftlichen Bewusstsein"
vollbracht hat, meint er, er habe den Gegenstand selbst gesehen und
wahrgenommen.
1.2.1.1.5
Gehörsinn
Der Gehörsinn
nimmt im Inneren des Ohres die Bestimmtheit der inneren, stofflichen
Selbstbewegung (Vibration) des Hörnervs wahr. Auch hier legen wir diese
sinnliche Bestimmtheit E mit Phantasie D und Begriffen C aus und machen
uns ein Bild von dem, was klingt, lärmt, quietscht usw. Die Schallbewegung
enthält in sich mannigfaltige Bestimmtheiten, z. B. Artverschiedenheit
der Stimmen, Laute, Höhen und Tiefen, Stärke oder Schwäche; menschliche
Musik ist eine aktive Erzeugung sinnlicher Schallqualitäten; beim Bau von
Musikinstrumenten benützt man bestimmte Tonsysteme, wo mathematische
Relationen maßgeblich sind. Erwähnt seien bestimmte Gesellschaften, in
denen Sprache nur als gesprochene, nicht als geschriebene Sprache vorkommt
(orale Kultur), also Gesellschaftssysteme, in denen der Gehörsinn stärker
aktiviert wird als in Systemen mit Benutzung der Schriftsprache.
1.2.1.2
Integrative Koordinierung der Zustände, "Daten" aller Sinne
Jeder einzelne
Sinn ist selbständig und eigentümlich. Aber das wahrnehmende Bewusstsein
verbindet in Phantasie D die Wahrnehmungen jedes einzelnen Sinnes mit Hilfe
der erwähnten begrifflichen Operationen C in ein Ganzes der Wahrnehmung
und bezieht sie alle auf die gleichen einzelnen Gegenstände in der
äußeren Natur. Diese integrierende, synthetisierende Koordinierung und
Verbindung des Einzelnen zu einem Gesamten ist ein wichtiger kognitiver Akt.
Hinsichtlich dieser Koordinierungsfunktion ein interessantes Beispiel: In dem
Kurzfilm "Die Täuschung des Auges durch das Ohr" von Andreas
KOPRIVA wird eine Szene einmal gedreht, dreimal kopiert und jeweils mit
anderen Geräuschen und Dialogen synchronisiert, wodurch sich bei gleichen
optischen Sinneseindrücken durch die Variation der auditiven
"Eindrücke" drei unterschiedliche Wirklichkeiten ergeben. Wir
sehen hier, dass uns die Außenwelt nicht direkt zugänglich ist. Die Sinne
unseres Körpers sind gleichsam der Filter und das Stempelkissen, auf welche
sie wirkt. Wir sehen die erheblichen konstruktiven und koordinierenden
Leistungen der Phantasie D und der kognitiven begrifflichen Operationen,
mit denen wir uns in uns ein Bild von außen machen, dabei aber auch noch
glauben, wir erlebten die Welt außerhalb unser, wie sie ist. Bereits an
diesem Punkt unterscheiden sich die verschiedenen philosophischen Systeme
bei der Beantwortung der Frage, wie diese Tatsache eigentlich zu
verarbeiten sei. Wir leben ja in einer konstruierten inneren Bildwelt. Vor
allem erhebt sich die Frage: Wie können wir wissen, ob das, was wir derart
von der Welt erkennen, auch wahr ist (Wahrheitsproblematik)?
1.2.2. Phantasiewelten D
1.2.2.1 Äußere
Phantasie D(1)
Wir haben im
Vorigen gesehen, dass Sinnes"stempel" der Sinnesorgane mit der
Phantasie verbunden werden und die Phantasie – natürlich unter
Benützung von Begriffen, Schlüssen usw. – Bilder der äußeren Welt
erzeugt. Wir wollen diese Phantasietätigkeit etwas schlampig als äußere
Phantasie D(1) bezeichnen. D(1) erzeugt eine mit der äußeren Sinnenwelt
E integrativ gebildete Phantasiewelt. Damit ist aber im Bewusstsein der
Bereich der Phantasietätigkeit bei weitem nicht erschöpft.
1.2.2.2 Innere
Phantasie D(2)
Wir stellen fest,
dass es ohne weiteres möglich ist, Bilder in D(1) in der Phantasie
weiterzubilden. Wir können in der Phantasie Bäume bilden, auf denen
Silberpferde hängen, Menschen mit Vogelköpfen, Phantasiewesen, wie die
Turtles, Donald Duck, Asterix, Pokemon, die Bilderwelt eines Malers wie DALI
oder MAX ERNST. Wir können uns in der Phantasie das Haas-Haus auf dem Mund
einer Frau, kombiniert mit dem Geruch von Schokoladekeksen und den Klängen
einer Arie der Oper "Tosca" vorstellen. Phantasiebilder sind
natürlich nicht auf den Gesichtssinn beschränkt. Die Traumfabrik
Hollywood erzeugt unentwegt Bildwelten, die mittels Phantasie aus der Natur
und den Gesellschaften nachgebildet und weitergebildet sind und die in
zunehmendem Maße über die Kinos der ganzen Welt in die Phantasiewelten der
Konsumenten übergehen. In unserer Phantasie kann es aber auch Formen geben,
die in keiner Weise aus der Natur weitergebildet sind. In dem Buch "Die
Vollendete Kunst" habe ich gründlich aufgezeigt, dass in der modernen
Malerei der entscheidende Schritt vollzogen wurde, Formen unabhängig von der
Natur zu finden und darzustellen. MAX BILL sagt:" Konkrete Kunst nennen
wir jene Kunstwerke, die aufgrund ihrer ureigenen Mittel und
Gesetzmäßigkeiten – ohne äußerliche Anlehnung an Naturerscheinungen
oder deren Transformierung, also nicht durch Abstraktion, – entstanden sind.
"Es gibt also unendlich viele Möglichkeiten der Erzeugung von Formen in
der menschlichen Phantasie, die nicht aus den Phantasiegebilden D(1)
abgeleitet sind, die wir aus der sinnlichen Erkenntnis gewinnen. Die
Entwicklung der Kunst seit 1910 bietet reiche Beispiele. Es ist auch zu
beachten, dass wir zur Erstellung bestimmter Phantasiegebilde überhaupt
keiner sinnlichen Eindrücke E bedürfen; die Sinnlichkeit ist also nicht
Voraussetzung unserer Phantasiefähigkeit.Ist die Phantasie in D(1) schon
bei der Erzeugung sinnlicher Erkenntnis aktiv und innovativ, so ist sie in der
Erzeugung von Phantasiegebilden in D(2) noch wesentlich freier.
Selbstverständlich werden auch bei der Erzeugung von Phantasiegebilden in
D(2) Begriffe usw. eingesetzt, wenn etwa der Maler, der Architekt oder
Erfinder neue Formen sucht. Wir beobachten aber auch, dass wir ständig die
beiden Bildwelten D(1) und D(2) miteinander verbinden und dass vor allem in
allen gesellschaftlichen Bereichen, von der Finanzverwaltung bis zum
elektronischen Spielautomaten, ständig durch Neubildungen in D(1) und D(2)
und deren Verbindungen Veränderungen in die "Außenwelt" gebracht
werden.Den Aufsatz über die Grundlagen digitaler Kunsttheorie von Ernst
Riemschneider: "Deduktive Kunst – Digitalisierung"
möchte ich hier zur Verdeutlichung benützen. Es wird nämlich bei der
Frage der DI sehr darauf ankommen, festzustellen, ob diese mit hohen
Freiheitsgraden, in Verbindung mit dem Einsatz von Begriffen C in unserem
Bewusstsein erzeugten Phantasiewelten D(1) und D(2) in
gleicher Weise von Computern erzeugt werden können. Es würde
nämlich nicht genügen, dass der Rechner von irgendwelchen Menschen bereits
dargestellte Bilder nachmachen kann,
sondern es ist zu fragen, ob er mit der gleichen Spontaneität, in der
gleichen Form und Vielfalt neue Phantasiewelten erzeugen kann. Diese
Phantasiegebilde müssten aber in der gleichen Weise neu sein,
wie etwa die Bilder von MAX ERNST oder GOYA in der Malgeschichte neu
waren. Es geht also um einen Grad von Neuartigkeit, der genau bestimmt
sein muss. Denn es ist klar, dass z. B. manche Maler neue Bilder machen, die
in auffälligem Maße jenen von
MAX ERNST gleichen. Sie ahmen nur eine Erfindung nach, die dieser
Maler erstmals vollzogen hat. Wir meinen hier also nicht die nachahmende
Neuschöpfung in der Phantasie, sondern eine bestimmte, darüber
hinausgehende Art der Neuheit (Innovationsdimension) Vgl. den Begriff
der "Originalität" bei PENROSE, S. 414.
Nun zum Aufsatz Ernst
Riemschneider: "Deduktive Kunst – Digitalisierung". Text
und Bilder sind bereits mittels digitaler Software erstellt (PAINTBRUSH-Programm).
Die dargestellten Bilder hatte der Autor vorher in seiner Phantasie D(2).
Wir wollen einige analysieren: Die Bilder von Flächen unter 2.2 und von
Linien unter 2.3 sind, wie der Text zeigt, mit Begriffen mathematischer und
logischer Art verbunden, die mit unseren bisher behandelten
Erkenntnisoperationen nicht zusammenhängen. Es liegt also eine
hochgradige Verknüpfung der Bilder mit Begriffen vor, die mit sinnlicher
Erfahrung nichts zu tun haben. Eigentlich setzen dieselben eine
mathematische Axiomatik voraus, von der dann eben Skizzen in der Phantasie
abgebildet werden. Man kann diese Bilder unter 2.2 und 2.3 erst " verstehen",
wenn man diese mathematischen Axiome verstanden hat, was aber allein durch
Phantasie D gar nicht möglich ist. Wir können nämlich z. B. nicht den
"ganzen Gedanken" der unendlichen Linie in der Phantasie nachbilden,
weil die Phantasie nur Endliches nachbilden kann. Ob und wie wir
Unendliches denken können und dürfen, müssen wir erst später
überprüfen. Das gleiche gilt von der Kochschen Kurve. Eine fraktale
Ähnlichkeitsfunktion ist eine mathematische Relation, die wiederum durch
digitalisierbare Programme grafisch darstellbar ist. Wir können bis zu
einem gewissen Grad in Phantasie D(2) die Entwicklung der Kurve
nachbilden; niemals aber vollständig, da die Teilung ja unendlich
fortsetzbar ist.
Wir können uns
in der Phantasie D(2) eine Vielzahl der Ornamente unter 4.1.2 nachbilden.
Auch diese Ornamente sind nicht aus der Außenwelt mit Sinneseindrücken
gewonnen, sie können, wie wir zeigen, mit einem BASIC-Programm erzeugt
werden. Auch hier sind die Grundlagen der Phantasiebilder in D(2)
verbunden mit "allgemeinen" Begriffen, wie "Allheit",
"Stufung", "Inversion", "Spiegelung",
"Regelmäßigkeit", "Selbheitlichkeit",
"Ganzheitlichkeit" und "Harmonie". Beachten wir auch,
dass wir normalerweise Schwierigkeiten haben, uns solche 8X8-Ornamente in
größerer Zahl zu merken. Ein Schachmeister ist jedoch in der Lage, eine
Vielzahl von 8X8-Konstellationen lange in Erinnerung zu behalten.Die Bilder ab
OR-OM0.PCX
sind deshalb um eine Stufe komplexer, weil alle Striche, Füllungen von
Flächen usw. mit Mustern (pattern) gezeichnet sind, die unter 4.1 erzeugt
wurden. Für die Erzeugung dieser Bilder in D(2) wurde eine Vielzahl von
begrifflichen und theoretischen Grundlagen herangezogen, die alle als
Sinnebenen, als Sinngehalte, als inhaltliche Implikationen in den
Bildern enthalten sind. Man "versteht" die Bilder also erst dann
richtig, wenn man diese theoretischen Grundlagen, die nicht in der
Phantasie gelegen sind,
mitberücksichtigt. Es sind dies u.a.:
·
die im Buch "Vollendete
Kunst" dargelegte Grundwissenschaft,
·
die in OR-OM1.PCX
angedeutete und hier unter 1.2.3.1.1 entwickelte Philosophie der geraden
Linie, inklusive der logischen und mathematischen Axiomatik derselben.
· Die Einhaltung einer Gliederung der
Bilder, die dem "Gliedbau des Weltalls" ähnlich ist.
· Die potentielle und virtuelle
Benützung aller bisherigen Bilder der Kunstgeschichte, die nach den
Prinzipien der "Vollendeten Kunst" als Material zur Erzeugung
neuer, komplexer, den neuen Baugesetzen entsprechender Bilder im Gesamtbau
der Malerei einen bestimmten "logischen" Platz einnehmen
(integrative Synthesen mit neuen Prinzipien).
· Die Aufnahme aller bisherigen
theoretischen Ansätze der Kunstentwicklung in den Allzusammenhang der neuen
Axiomatik.Was stammt bei diesen Bildern der Phantasie D(2) aus der
Sinnlichkeit E, was aus der äußeren Phantasie D(1)? Der Autor hat Bilder aus
der Kunstgeschichte, die Philosophie der Grundwissenschaft, die bisherigen
Theorien der Logik, Mathematik und Malerei als Sinneseindrücke –
"Bilder" oder "Zeichen mit Bedeutung" – aus Büchern
durch Einsatz von Begriffen C und Phantasie D aufgenommen. Hieraus wurden
als eine komplexe Synthese durch eine Vielzahl von Begriffsoperationen mit
C, in Verbindung mit D und E und dem Einsatz von "äußeren"
Werkzeugen wie einem PC und seiner Software diese Bilder hergestellt, die
der Leser wiederum nur als Sinnesqualitäten auf seiner Netzhaut
vorfindet. Der Zeichner der Bilder kann sich etwa "alle
Einzelheiten" des BildesOR-OM27.PCX,
also die Stellung eines jeden Pixel im Raster, nicht merken. Auf der
Festplatte seines PC wie auch auf Disketten im Club sind jedoch alle
Details digital aufgezeichnet, genauso wie man früher in Schriftstücken
Informationen speicherte.Wir können in Phantasie D(2) Einzelbilder aus
einem Zusammenhang nehmen und in andere setzen. Die Montagetechnik in der
Malerei hat dies auch in "äußeren Bildern" angewandt. Im
PAINTBRUSH-Programm ist eine Funktion vorgesehen, "einfache Bilder"
wie OR-OM2.PCX in andere, komplexere Bilder
einzubauen ( paste-Funktion).
Weiterhin können Bilder der "Außenwelt" in Büchern durch einen
Scanner eingelesen und in andere Bilder eingebaut werden (z. B. in OR-OM65.PCX). Der
komplizierte Vorgang, dass man beim Erzeugen "äußerer" Bilder
auf dem Monitor nicht immer nur Bilder der inneren Phantasie – in
Verbindung mit jenen der äußeren – in das neue Medium
"umsetzt" oder "herauskopiert", sondern dass man durch
Probieren mit Elementen und CUT-files im Zeichenprogramm selbst plötzlich
einem bisher nicht bekannte, in der Phantasie D(2) noch nicht gegebene oder
konstruierte Bilder erzeugt, die man sich dann wieder merkt, also in D(1)
und D(2) aufnimmt, kann hier nicht im Detail untersucht werden.
1.2.3 Begriffswelten (Logik, Mathematik, Theorien)
In vielen
Erkenntnistheorien werden die unter 1.2.2 dargestellten komplexen
Operationen der Phantasie, die laufend ganze Bildwelten erzeugt, ständig im
Gedächtnis vorhandene raumzeitliche, plastische Bildkompositionen umstellt,
verändert und neu organisiert, überhaupt nicht in der gesamten Tragweite
erkannt und berücksichtigt. (Die Phantasie ist natürlich nicht nur im
Wachen, sondern auch im Traum tätig, was wir hier nicht weiter untersuchen.)
Die sinnliche Erkenntnis wird u.U. als ein einfaches
Reiz-Reaktionsverhältnis, als Input-Outputsystem verstanden. Noch viel
schwieriger ist die Erschließung des für die sinnliche Erkenntnis im
weiteren unerlässlichen Anteils "kognitiver" Operationen
begrifflicher Art. Hier finden sich wieder
eine Vielzahl von Ansichten in der Erkenntnistheorie. Einige Schulen meinen,
Begriffe stammten ausschließlich aus der sinnlichen Erfahrung, man lernte
eben Sprachen und ihre Bedeutungen. Andere Schulen meinen, Begriffe müssten
wir schon von vornherein (a priori) im Bewusstsein (nach anderer
Formulierung im Geist) haben, damit wir überhaupt als Kleinkinder sinnliche
Erkenntnis zustandebringen können und überhaupt die Laute der Eltern als
Sprache "verstehen" und dann die gesellschaftlich gegebene (z. B.
deutsche) Sprache zu erlernen vermögen. Wir hatten also schon Gedanken,
Begriffe, bevor wir die Wörter einer Sprache lernen. (Wir haben auf jeden
Fall zwischen dem Gedanken und seiner Darstellung als Zeichen in einer
Sprache zu unterscheiden!) Die nächste Schule meint gar, dass bestimmte, z.
B. logische Gedanken, wie FREGE sagt, nicht Erzeugnis unserer seelischen
Tätigkeit sind, sondern im Denken nur "gefunden" werden. "Denn
der Gedanke, den wir im Pythagoräischen Theorem haben, ist für alle
derselbe, und seine Wahrheit ist ganz unabhängig davon, ob er von diesem
oder jenem Menschen gedacht wird oder nicht. Das Denken ist nicht als
Hervorbringung des Gedankens, sondern als dessen Erfassung anzusehen."
(Vgl. auch PENROSE S. 95 + 418.)
1.2.3.1
Systematische Analyse der Erkenntnisbegriffe
Wir versuchen
jetzt in möglichst einfachen Formulierungen ganz entscheidende Probleme
darzustellen. Es ist schon ein großer Fortschritt zu erkennen, dass wir eine
Vielzahl von Begriffen (C) benützen und einsetzen müssen, um überhaupt
eine sinnliche Erkenntnis zustande zu bringen. Ein noch schwierigeres
Unterfangen aber ist es, eine Analyse dieser Begriffe durchzuführen und sie
als ein System darzustellen. Das System von Begriffen wäre dann auch
gleichzeitig das Schema, nach dem wir alles zu erkennen und zu denken hätten.
Dieser Versuch macht einen breiten Teil der Geschichte der
Erkenntnistheorie aus, und es gab immer wieder neue Bemühungen, diese
Grundgedanken – früher Kategorien genannt – zu systematisieren. Wir
erwähnen hier nur ARISTOTELES, KANT und WITTGENSTEIN im Traktat. Die
Begriffssysteme der drei Denker sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Auf
die Differenzen gehen wir hier aus Platzgründen nicht ein. Wir möchten aber
in diesem Zusammenhang auf eine philosophische Frage zumindest hinweisen,
die nun gestellt werden muss und auch in der Geschichte immer wieder gestellt
wurde: Wenn wir Erkenntnis der Außenwelt durch eine Synthese aus
Sinneseindrücken (E), Bildkonstruktionen in äußerer und innerer
Phantasie D(1) und D(2) und Begriffen (C) zustandebringen, von denen ein
Teil Grundbegriffe bilden, die in einem System erfassbar sind und bei allen
Erkenntnissen benützt werden sollen, dann erhebt sich die weitere Frage,
woher wir denn wissen sollten, ob die Anwendung dieser Grundbegriffe auf
alles, was wir denken und erkennen, zulässig sei. Können wir uns da nicht
auch täuschen? Woher sollen wir denn wissen, ob es zulässig ist, diese
Begriffe auf alles anzuwenden, was wir denken, vor allem auf die Welt
außerhalb unser. Ist die Welt denn auch wirklich so gebaut, wie wir sie uns
denken? Hat die Welt denn die gleiche Struktur wie das System der
Grundgedanken, das uns da von den Philosophen vorgeschlagen wird? Diese
Frage zu stellen, bedeutet einen besonderen Schritt in der
Erkenntnistheorie. Sie nicht zu stellen, bedeutet umgekehrt, dem
menschlichen Erkenntnisvermögen eine Grenze zu setzen, die eigentlich
unzulässig ist. Da wir eingangs ankündigten, die Frage der Grenzen der
MI zu untersuchen, gelangen wir hier an
eine entscheidende Stelle. Wird die Zulässigkeit dieser Frage geleugnet,
erfolgt bereits eine für die gesamte Entwicklung der Erkenntnistheorie
und im weiteren für das Verständnis der Erkenntnisgrenzen der MI relevante BEGRENZUNG
UND EINZÄUNUNG mit schwerwiegenden Folgen. Diese Grenzziehung erfolgt
etwa damit, dass man sagt: "Menschliche Erkenntnis ist auf den Aufbau
von Theorien zu beschränken, die auf Begriffe der Theorie C(T), Logik und
Mathematik sowie auf Beobachtungen zu beschränken sind. Darüber
hinausgehende Erkenntnisse sind sinnvoll nicht zu gewinnen. Die formale
Logik ist die nicht überschreitbare Grundlage des Aufbaus von
Erkenntnis, sozusagen die innerste Grundlage der MI." Mit dieser
Begrenzung hat sich das menschliche Erkenntnisstreben nie zufrieden
gegeben. Die Überschreitung dieser Grenze wirft also die Frage auf, ob
jenseits des Menschen und der "Welt" ein absolutes und unendliches
Grundwesen existiert, in/unter dem sowohl der Mensch als auch die Welt
enthalten sind. Gibt es ein solches Grundwesen, ergibt sich die weitere Frage,
inwieweit es dem Menschen erkennbar ist. Denn wenn eine solche menschliche
Erkenntnis des Grundwesens möglich ist, dann müsste vom Menschen auch
erkannt werden können, wie alles an oder in/unter dem unendlichen und
unbedingten Grundwesen enthalten ist. Unter der Voraussetzung, dass dies
möglich ist, ergeben sich entscheidende Folgerungen:(1) Wahr
erkennen wir nur dann, wenn der Bau unseres Denkens so gebaut ist, wie alles
in/unter dem Grundwesen enthalten und gebaut ist. Also der Bau des Denkens
(Logik) muss so sein wie der Bau der Welt, des Universums, des Weltalls
in/unter dem unendlichen Grundwesen.(2) Ist
eine solche neue Logik (synthetische Logik, SL) auffindbar, dann ist zu
prüfen, inwieweit alle bisherigen Logiken in der Geschichte der
Erkenntnistheorie Mängel besitzen, "zu eng" sind oder gar
bestimmte Teile derselben überhaupt nicht besitzen.(3) Mit
dem Vorhandensein einer solchen Logik würde sich aber auch der Aufbau der
Wissenschaft, vor allem auch der Naturwissenschaft, entscheidend
verändern.Hier sei zur Klarstellung für den Leser auf einen sehr wichtigen
Unterschied in der Art der logischen Systeme hingewiesen. Die einen Denker
sagen: Der Bau eines logischen Systems muss sich nach dem Inhalt
dessen richten, was wir denken –
Inhaltslogik, etwa bei HEGEL –, die anderen meinen, die Logik sei aus
bestimmten, ihr eigentümlichen Gesetzen so aufbaubar, dass das System – unabhängig
vom Inhalt, auf den die logischen Gesetze und Regeln später angewendet
werden – rein der Form nach aufgebaut werden könnte.
(Systeme der formalen Logik, über deren Entwicklung J.M.BOCHENSKI eine
gründliche und subtile Darstellung gibt; Alber Verlag, 1970.)Die hier
gemeinte Logik, die sich aus der GRUNDWISSENSCHAFT ergibt, ist INHALTSLOGIK
und FORMALE LOGIK in völliger Übereinstimmung und Deckung. Ist es
nun möglich, den Weg zu beschreiten, den wir hier als WENDE ZUR
GRUNDWISSENSCHAFT (WGr) bezeichnen wollen? Eine Reihe von Philosophen hat es
behauptet. Auch dieser Typ von Systemen hat eine Entwicklung durchgemacht.
Die Inhaltslogik HEGELs hat weitreichende geschichtliche Bedeutung
erlangt. Ein anderes System erweist sich – zumindest nach unserer
Ansicht – als bahnbrechend für die weitere Entwicklung der
Wissenschaft dieser Menschheit: die Grundwissenschaft des bisher eher
unbeachtet gebliebenen Philosophen KRAUSE. Diese Grundwissenschaft ist
in den von mir 1981 neu herausgegebenen "Vorlesungen über das System
der Philosophie" enthalten, die sich daraus ergebende Logik im Werk
"Vorlesungen über Synthetische Logik". Die Grundlagen der
Mathematik sind ebenfalls in der GRUNDWISSENSCHAFT und in einem
Aufsatz enthalten, der im Buch Pflegerl: "Die Vollendete Kunst"
neuerdings abgedruckt ist. Im hier begrenzten Rahmen wäre es
unmöglich, diese Lehren darzustellen. Wir werden aber unter
Berücksichtigung dieser neuen Grundwissenschaft, den Versuch unternehmen,
an einem BEISPIEL, das jedem Leser leicht einsichtig sein wird, zu zeigen,
worin die bahnbrechenden Neuerungen dieser Lehren für Logik und Mathematik
bestehen. Bereits an diesem, relativ eingeschränkten Beispiel lassen sich
nämlich die Grundzüge der neuen Logik (SL) und jene Axiome zeigen, welche
in der Lage sind, die Grundlagenkrise der modernen Mathematik und damit auch
der mathematischen Logik zu beheben. Festgehalten sei aber, dass eine
kritische Auseinandersetzung mit der Grundwissenschaft nicht umhinkäme,
diese selbst und die SL gründlich durchzudenken.
1.2.3.1.1 Das Universum der geraden Linie o
In der Mathematik
sind Gedankenmodelle beliebt. (Man überlegt etwa, welche Geometrie
Lebewesen hätten, die nur aus zwei Dimensionen bestehen und auf einer Kugel
leben.)In unserem Gedankenexperiment wollen wir annehmen, es lebe irgendwo
eine Gesellschaft von Menschen, das Volk der Karidonier, dessen Universum
nur aus einer unendlich langen, geraden Linie besteht. Generationen von
Forschern analysieren dieselbe und stellen Überlegungen an, wie diese Linie
richtig zu erkennen sei, welche Logik sich aus den Inhalten dieser
Erforschung ergebe. Sie fragen also: Wie muss der Bau unserer Logik sein,
damit wir die Linie so denken, wie es ihrem Inhalt, ihrem Bau entspricht.
Hier das Ergebnis: Wichtig ist bereits einleitend zu beachten, dass die
deutsche Umgangssprache nicht ausreicht, um die hier entwickelten
Erkenntnisse genau zu bezeichnen. Es müssen daher einige neue, klarere
Bezeichnungen für das Erkannte, für das Gedachte eingeführt werden (z. B.
"Or" für das Ungegenheitlich/Ganze/Eine, "ant" für das
Gegenheitliche, "mäl" für das Vereinte, "Ab" für die
Beziehung des Höheren zum Niederen, "Neb" für die Beziehung von
Nebengliedern usw.). Da die hier deduzierten, abgeleiteten Begriffe im
System (LO) eine andere Bedeutung haben, als in der bisherigen
Umgangssprache und den bisherigen Wissenschaftssprachen, werden sie in der
Axiomatisierung (LO) in einer besonderen Schrift (Lucida Sans) geschrieben. Umgekehrt wird hier aber auch
dazu angeregt, bisher überhaupt nicht gründlich genug Gedachtes erst
einmal überhaupt zu denken.
(LO 1) Was die Linie o AN
sich ist
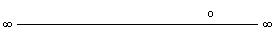
"AN" einem
Wesentlichen ist, was von ihm ganz, durchaus gilt. "IN" einem Wesentlichen ist dasjenige
Wesentliche, welches von ersterem ein Teil ist, und Gleichartiges des
ersteren außer sich hat. Betrachtet wird bei der Linie o in (LO 1), was sie
AN sich ist, also noch nicht, inwieweit sie vielleicht auch Teile usw.
hat.(LO 1.1) AN der Linie o wird die Wesenheit go (in der FIGUR 2 go, gu,
gi, ge usw.) erkannt. An der Wesenheit die Einheit.
Dass die Linie im weiteren (LO 1.2) und (LO 1.3) auch Zweiheit, Mehrheit,
Vielheit,
Vereinheit
von mehreren Teilen usw. ist und hat, wird hier noch nicht erkannt. Die
Einheit, die hier erkannt wird, ist eine ungegliederte, allen Teilheiten
und Vielheiten "IN" der Linie übergeordnete Einheit, die wir der
Genauigkeit wegen als OrEinheit
(go) bezeichnen können.
(LO 1.2) AN der
Wesenheiteinheit go der Linie werden die Selbheit
(gi) und die Ganzheit (ge) erkannt. Die Selbheit
bezeichnet man üblicherweise als Absolutheit und die Ganzheit als
Unendlichkeit. Die Linie ist AN sich Eine, absolut und unendlich. Das Wort
"Ganzheit" meint hier nicht eine Summe von Elementen, die zu einer
Ganzheit zusammengefasst sind. (Diese finden sich erst in (LO 1.2 und LO 1.3.)
Die Linie o ist IN sich auch Summen von Teilen usw. Aber als Linie o ist diese
Verein–Ganzheit von Teilen noch nicht ersichtlich oder erkennbar. Diese Or–Ganzeit oder unendliche Ganzheit ist ein
"über"geordneter Begriff. Das Wort "Selbheit" oder
Absolutheit" der Linie o meint, dass sie an sich ist, ohne irgend ein
Verhältnis nach außen. (Dies stimmt auch in unserem Modell, da es bei den
Karidoniern außer der Linie o ja nichts gibt.)Wesenheiteinheit (go),
Selbheit (gi) und Ganzheit (go) stehen in der Gliederung der FIGUR 2
zueinander. Für die Gliederung der Mathematik sind go, gi und ge die
Grundaxiome. Für die Lehre von Gegensatz,
Negation, positiven und negativen Zahlen
sind es die Ableitungen IN go,
für die Lehre von den Verhältnissen sind es die Ableitungen IN gi und
für die Ganzheitslehre die Ableitungen
IN ge. Go und ge sind auch miteinander vereint und mit go als gu.
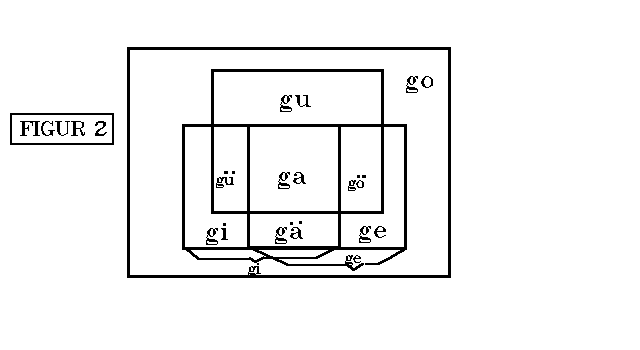
(LO
1.2.1) Wie ist
die Wesenheit-Einheit (go) und wie sind im weiteren gi, ge und alle
Verbindungen der Linie o in FIGUR 2? Die FORM
der Wesenheit go ist Satzheit
do. Die Linie o ist das eine Gesetzte,
Positive. Hier An der Linie o gibt es noch keine Negation, keinen
Gegen–Satz usw. Wir bezeichnen diese Satzheit als Or-Satzheit. Die Form
der Selbheit gi ist Richtheit
di oder Bezugheit
(Relationalität), aber auch hier gibt es nur die Eine Richtheit ohne noch ein
Hin und Her oder sonstige einzelne Richtungen zu unterscheiden, also
Or-Richtheit. Die Form der Ganzheit ge ist Fassheit
de ("um"fangen, befassen). AN der unendlichen, ganzen Linie wird
noch nicht ein Um-fassen endlicher Ganzer erkannt, sondern dieses Fassen
der Or-Ganzheit hat keine Endlichkeit (FIGUR 3).
(LO 2) Was
die Linie o IN sich ist
Die Linie o ist IN sich gemäß der
obigen Zeichnung Gegenlinie und Vereinlinie nach INNEN, so dass die Linie IN
sich zwei ihr als o untergeordnete und IN ihr selbst als ganzer selber Linie nebengegenheitliche Linien i und e ist, welche AN sich
gleichwesentlich und sich darin neben-gegenheitlich sind, dass die eine von
beiden ist, was die andere nicht ist und umgekehrt. Die Linie o aber,
sofern sie ÜBER sich selbst als die beiden nebengegenheitlichen
entgegengesetzten Linien i und e ist, ist die Urlinie u, von i und e unterschieden, und
insoweit ist die Linie o in sich eine doppelgliedrige AB-Gegenlinie. Die Linie ist als u auch vereint mit
den beiden Gegenlinien i und e. Die beiden Neben-Gegenlinien sind
ebenfalls miteinander vereint.
(LO 2.1) IN der
Linie o in der ersten Gliederung sind nur 2 Linien, die durch den Punkt X
voneinander getrennt sind. Es gibt das Erste und das Zweite,
das Zweite ist das Andere des Ersten. Das Erste ist, was das
Zweite nicht ist und umgekehrt. Beide sind einander nebenentgegengesetzt, nebengegenheitlich,
andererseits ist aber die Entgegengesetztheit der beiden gegen die Linie u
eine Ab-gegenheit.
Die Gegenheit der beiden Glieder gegen u ist also eine andere als die
Gegenheit der beiden i und e gegeneinander. Die Linie o ist IN sich beide.
Man kann also nicht sagen, das Eine ist die Linie o und das Andere sind die
beiden Linien i und e. sondern es ist zu sagen: Die Linie o ist In sich sowohl
das Eine als auch das Andere. Unrichtig ist aber zu sagen: Die Linie o ist
beide. Daraus ergibt sich, dass die innere Gegenheit in der Linie o zwei Glieder hat. Es ist unmöglich anzunehmen,
dass die innere Gegenheit nur ein Glied hätte. Dadurch dass die eine der
beiden Linien i nicht ist, was die andere Linie e ist, wird von der Linie o
überhaupt nichts verneint. Weiterhin ist zu beachten, dass die Linie o,
soweit sie ÜBER i und e ist, und erst in dieser Hinsicht eine Beziehung nach
innen hat, in (LO 1) aber, AN der Or-Linie o solche Beziehungen nicht gegeben
sind ( Es sei denn, man meint alle Beziehungen, die wir in (LO 1)
darlegten, diese Beziehungen sind Aber AN-Beziehungen.)
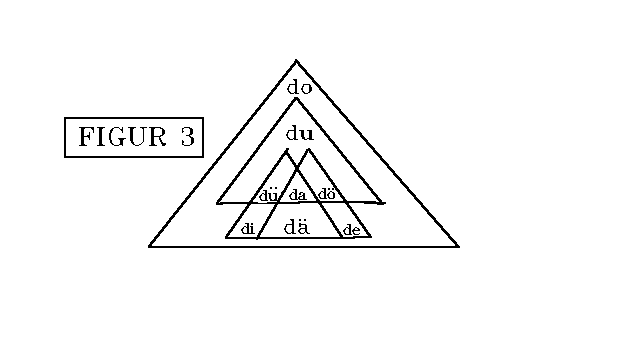
(LO
2.2.) Die in (LO 1.2) angeführten Begriffe der Wesenheit und ihrer
AN-Gliederung, also Wesenheiteinheit, Selbheit (LO 2.2) Die in (LO 1.2) angeführten Begriffe der
Wesenheit go und ihrer AN-Gliederung
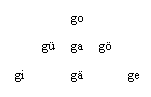
n
also Wesenheiteinheit, Selbeit und Ganzheit (FIGUR 2)
- erfahren bei der Gliederung der Linie o IN (LO 2) durch Linie u und die
beiden Linien i und e ebenfalls eine Ab-Gegen-, Neben-Gegen- und
Vereingliederung, die folgend darstellbar ist:
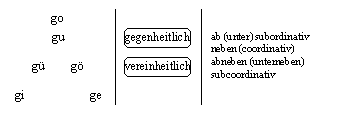
(LO 2.2.1) Die Wesenheit go, der unendlichen unbedingten
Linie o erfährt an den beiden Linien i und e eine Veränderung. Die
Neben-Gegen-Wesenheit der beiden Linien ist ihre Artheit
(Art, Qualität). In der Linie o ist zuerst einmal eine nur zweigliedrige
Artheit: der qualitative Unterschied zwischen i und e.
(LO 2.2.2) Für die beiden Nebengegen-Glieder i und e
ergibt sich als Gegenheit der Selbheit (gi) die Verhaltheit, das Verhältnis.
Sie stehen zueinander in einem Neben-Verhältnis,
zur Linie u in einem Über-Unterverhältnis
usw. AN der Linie o in (LO 1) gibt es keine Gegen-Verhältnisse, sondern die
Eine Selbheit, als Or-Selbheit. i verhält sich zu e in bestimmter Weise.
Das Gegenselbe steht sich als ein Anderes wechselseitig entgegen, eines ist
des anderen Objekt.
(LO 2.2.3) Für die beiden Neben-Gegenglieder i und e
ergibt sich als Gegenheit der Ganzheit (Or-Ganzheit der Linie o) die Teilheit.
Das Gegenganze ist Teilheit.
Die Linie o ist IN sich zwei und nur
zwei Teile i und e. Hier ist auch die höchste Grundlage des Mengenbegriffes
gegeben. Man kann nicht sagen: die Linie o ist eine Menge, weil AN der Linie
überhaupt keine Teilheit ist, wohl aber die Linie o ist IN sich in dieser ersten
Gegenheit zwei und nur zwei
Teile (Elemente). Wir unterscheiden aber die Ab-Teilung
von der Neben-Teilung.
Denn die untergegenheitlichen Teile nennt man Unter-Teile, (Ab-Ant-Ganze). In
der Vereinigung ergibt sich das Vereinganze der Teile, die Erste Summenbildung
von i und e
(LO 2.3). Auch hinsichtlich des Wie der Wesenheit usw. hinsichtlich
der Begriffe der Formheit
do usw. ergeben sich für die gegenheitlichen Linie i und e neue Bestimmungen.
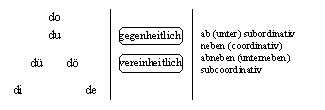
Unter (LO 1.2.1) fanden wir, dass die Linie o Satzheit
do hat. Hinsichtlich der Gliederung o, i, e, usw. ergibt sich hier Gegen-Satzheit
und zwar wiederum Neben-Gegensatz
zwischen i und e, Ab-Gegensatzheit zwischen u und i usw. Die Gegensatzheit ist
die Bestimmtheit.
Bestimmtheit ist also eine Teilwesenheit an der Satzheit als Gegensatzheit.
i ist also gegen e bestimmt, aber auch u bestimmt e und i usw. Diese Gegensatzheit
hat selbst auch eine Form. Die Or-Satzheit ist der Form nach ganz Jaheit,
ohne Neinheit, also Or-Jaheit. Diese Jaheit ist nun selbst wiederum
gegliedert
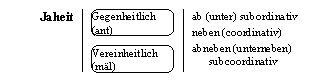
Statt der Or-Jaheit kann man sagen, die unendliche und
unbedingte Positivität. Was die Gegen-Jaheit
betrifft, so ist diese zugleich Gegen-Neinheit,
entgegengesetzte Verneinheit (oppositive Negativität). Das Nein
oder Nicht
wird daher nur hier erkannt. Die Gegenneinheit ist nur an der Gegenjaheit.
Dadurch dass i bestimmt ist als das Eine von zwei Wesentlichen, ist es
auch zugleich bestimmt als nicht
sein Anderes, sein Gegenheitliches, hier also e ist von ihm verneint. Das
Nein ist also nur in einer Beziehung
gegen ein Anderes. Durch die gegenseitige
Teilverneiung i gegen e und umgekehrt, wird von der Unendlichen und
unbedingten Linie o überhaupt nichts verneint. Hinsichtlich der Linie
o ist das Nicht nicht. Die Bestimmtheit i gegen e besteht darin, dass es e
ausschließt. Hier liegt die Grundlage der Wörter ja, nein, Nichts, des
logischen „ist
nicht“. Zu beachten sind natürlich auch die Gegenjaheiten von
der Linie u gegen i bzw. e (Unter-Gegen-Verneinung oder Ab-Ant-Verneinung).
(LO 2.3.1) Auch die Satz-Einheit, an der Linie o
unendliche und unbedingte Einheit der Satzheit (oder Zahleinheit), ist hier
gegenheitlich zu finden als:
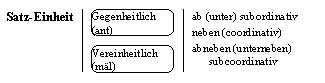
also Satz-Gegeneinheit,
Satz-Vereinheit. Für die Zahl-Gegeneinheit wird das Wort Vielheit
oder Mehrheit benützt. Zu beachten ist aber, dass hier noch keine Vielheit gegeben
ist, die mehr als Zweiheit
wäre (Gegeneinheit).
Statt der Vereinzahlheit sagt man Allheit, Totalität, die aber hier nur aus
zwei vereinten
Gegen-Gliedern besteht. Von der Linie o gilt unbedingte und
unendliche Zahleinheit, keine Vielheit, oder Mehrheit, keine Allheit. Die
Linie o ist IN/UNTER sich die Vielheit und das Viele, die Allheit und das
All oder die Totalität, das Universum aller Glieder in sich. Jede ursprüngliche
Vielheit in der Linie o ist eine Zweiheit,
und jede Vereinzahlheit ursprünglich eine vereinte
Zweiheit, da der Gegensatz, oder die nach Ja und Nein bestimmte
Gegenheit nur zweigliedrig ist. Die unbestimmte Vielheit oder Vielzahligkeit
ist hier noch nicht gegeben, z.B. die unendliche Vielzahligkeit 1,2,3,4,5,
usw.
Hier liegen die Grundlagen der Zahlentheorie: die oberste
Zahl ist die unendliche, unbedingte Eins (o). In ihr sind die
beiden gegenheitlichen Zahlen i und e, die ebenfalls noch unendlich
sind, aber gegeneinander begrenzt durch X. Sie sind nicht mehr absolut,
sondern gegeneinander und gegen u relativ. Hier liegen die Grundlagen der
widerspruchsfreien Mengenlehre. Denn die beiden ersten „Mengen", INNEREN
Elemente, von o sind i und e, beide selbst noch unendlich, aber bereits relativ.
(LO 2.3.1.1) Die Form der Satzeinheit oder Zahleinheit ist
die unendliche, unbedingte Jaheit. Die Jaheit ist dann selbst wiederum
gegliedert wie unter (LO 2.3). Daraus ergibt sich die Jaheit und Neinheit
der Zahlheit, hier aber erst für die beiden Teile i und e. Hier findet sich
die Grundlage der mathematischen Lehre von den Zahlen und Gegenzahlen (den
positiven und negativen Zahlen).
(LO 2.3.1.2) Auch die Richtheit di (als Form der Selbheit
in LO 1.2.1) erfährt hier weitere Bestimmung:
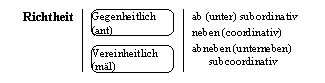
Hier wird die Gegenrichtheit erkannt. Und zwar haben i und
e nebengegenheitliche Richtheit. i „fängt“ bei X an und „geht in die
eine Richtung", e „fängt“ bei X an und „geht in die andere
Richtung“. Weiters ist die Richtung von u nach i und e und umgekehrt von i
nach u usw. zu erkennen. Anstatt Richtheit sagt man gewöhnlich Dimension,
Erstreckung. Der Begriff der Richtheit
ist für die Ausbildung der Mathematik wichtig, bisher aber ungenau erkannt
und entwickelt. Hier ist zu unterscheiden: die Eine Ganze Richtheit
(Or-Richtheit di) der Linie o; die Neben-Gegenrichtheit
an den Teilganzen i und e und andererseits die Ab-Gegenrichtheit
u gegen i und e usw. Hier hat der Begriff der Richtheit noch nichts mit Zeit
und Bewegung zu tun. (In der Umgangssprache wird Richtung ausgedrückt
durch: hin und her, auf und ab, hinüber und herüber.)
(LO 2.3.1.3) Auch die eine selbe ganze Fassheit de, als
Form der Ganzheit erfährt hier Bestimmung.
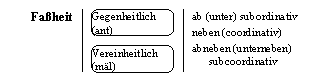
Die Linie o hat „ungeteilte“ ganze Fassheit (Or-Fassheit),
die beiden inneren Teile i und e haben Neben-Gegenfassheit, u hat gegen i
und e Ab-Gegen-Fassheit,
schließlich erkennen wir alle Vereinfassheiten.
Auch hier kann man sagen, dass die Linie o ganze Fass-Jaheit hat, dass aber
von i und e neben-wechselseitig Fassjaheit und Fassneinheit gilt. Denn i fasst
das, was e nicht fasst und umgekehrt. Daraus ergibt sich das In-Sein
und Außensein. e ist außer i und i ist außer e.
(LO 2.3.1.3.1) An dieser Stelle müssen wir noch genauer
fragen: Wie ist die FORM dieses In-und Außensein? Die Form dieses einander
In- und Außenseins ist die Grenzheit.
Das sieht man leicht indem man sagt: X ist die Grenze von i und e. Dort wo die
Inbefassung von i aufhört, an der Grenze X, da fängt die Inbefassung von e
an. Grenzheit,
Grenze ist also die Form
des Gegenfassigen. Es ist also deutlich, daß An der Linie o keine
Grenze ist, sondern dass erst in der ersten In-Teilung derselben, an i und e
die Grenzheit als X gegeben und erkannt wird. i und e haben daher eine
gemeinsame Grenze. Die Grenze X ist weder i noch e, sie ist ihre gemeinsame
Grenze.
(LO 2.3.1.3.2) Fragen wir nun, was ist IN dem, was da
ingefasst, eingefasst wird. Der Inhalt des Infassigen wird als groß oder Großheit
bezeichnet. Damit Größe da sein kann, muß etwas innerhalb bestimmter
Grenzheit bejahig befasst sein. Der Begriff der Großheit
ist wiederum für die Mathematik grundlegend. Man hat daher die Mathematik
oft irrtümlich auf die Größenlehre beschränkt. Hier wird aber gezeigt,
dass die Mathematik viel mehr umfasst, und dass der Begriff der Großheit
bisher auch nicht richtig erkannt wurde.
Betrachten wir das inbegrenzte Große, so erscheint die
Grenze desselben als dessen Ende, als Endheit, oder umgekehrt als Anfang.
Hier erkennen wir die Begriffe Endheit,
Endlichkeit, und Un-Endlichkeit. Die Endlichkeit ist eine Bestimmung
der Grenzheit, die Grenzheit wieder eine Bestimmung der Gegenfaßheit an der
Großheit und mithin daher eine Bestimmung der Ganzheit als Gegenganzheit.
Daraus zeigt sich, daß der Begriff der Endlichkeit nicht richtig gefunden
wird, ohne die Begriffe der einen, selben, ganzen Richtheit
(di), der Faßheit
(de) und der Ganzheit
(ge). Von der Linie o kann nicht gesagt werden, daß sie an sich endlich ist,
oder Grenze hat, sondern nur, dass sie ganz (organz) ist und in ihrer Ganzheit
auch alle Endlichkeit und Grenzheit des Gegenganzen in sich befasst.
(LO 3) In der dritten Erkenntnis fassen wir zusammen, was
bisher erkannt wurde, also was die Linie o AN und IN sich ist.
Es gilt: Die Linie o ist AN sich und IN sich ein
Organismus, heute würde man auch sagen eine Struktur. Die An-Gliederung und
die Ingliederung wurden unter (LO 1 und LO 2) dargestellt.
(LO 3.1) Dieser bisher dargestellte Gliedbau (Organismus,
Struktur) der Linie o ist „voll"ständig. Hier ergibt sich die erste
Erkenntnis hinsichtlich der Begriffe ALL-heit, Totalitiät. Diese Allheit ist
aber nicht irgendeine unbestimmte verschwommene, sondern die Gliederung ist
deutlich bestimmt.
(LO 3.1.1) Aus dieser Gliederung ergibt sich auch, dass
die Gegenheit nur zweigliedrig ist, denn es gibt keine anderen inneren
Glieder der Linie o als i und e, und deren Jaheit und Gegenjaheit
(Neinheit). Natürlich gibt es auch „noch endlichere“ Linie in o, aber
das wird sich erst im folgenden ergeben.
(LO 3.1.2) Für diesen gegliederten Organismus gilt auch,
dass alle hier entwickelten Begriffe aufeinander anzuwenden sind. So hat
z.B. die Ganzheit (ge) auch Wesenheit, Selbheit und Gegenselbheit, also
Verhaltheit, Ganzheit, sie hat eine bestimmte Form oder ist in bestimmter
Grenzheit, gegenüber der Selbheit, usw. Wenn also derjenige Teil der
Mathematik der sich mit Größen beschäftigt, voll ausgebildet werden soll,
dann muss an der unendlichen und nach innen absoluten Ganzheit (hier
Or-Ganzheit der Linie o) begonnen werden, was bisher nicht geschehen ist. Ein
anderer Zweig der Mathematik ergibt sich aber aus der Selbheit (gi) und
Gegenselbheit (Verhaltheit, Verhältnis), wenn dieser Begriff nach allen
anderen Begriffen durchbestimmt wird (z.B. die Lehre von den Proportionen
usw.).
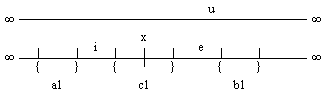
(LO 4.1) Jeder der beiden Teile i und e in der Linie o
(und auch die Vereinigung der beiden) ist selbst wiederum AN und IN sich
Struktur, Organismus gemäß der Struktur (LO 1-3), also hat selbst
wieder eine der Linie o ähnliche Struktur.
Es gilt: Wie sich die Linie o zu u, i und e und deren
Gegenheiten und Vereinheiten verhält, so verhält sich wiederum i zu dem,
was es IN sich ist, usw...
(LO 4.1.1) Die Form dieses Ähnlichkeitsverhältnisses ist
die Stufung,
Abstufung (Stufheit), wobei sich das unter (LO 2.3.1.3) dargestellte
Insein und Außensein nach innen fortsetzt.
(LO 4.1.2) Fahren wir nun mit der inneren Gliederung von i
und e und deren Vereinigung fort, so ergeben sich in i unendlich
viele Linien gemäß a1, in e unendlich
viele Linien wie b1 und in der Vereinigung von i und e unendlich
viele Linien wie c1. Analysieren wir die Ganzheit, Großheit,
Grenzheit und Endlichkeit (LO 2.3) dieser Linien a1, b1, c1, so fällt auf, dass
sie zum Unterschied von den Linien i und e „auf beiden Seiten endlich
sind“, beidseitig begrenzt sind, sie sind also ganz
endlich, oder unendlich-endlich.
i und e sind also in sich unendlich endliche Glieder. Ein solches Glied der
Linie o nennt man nun individuell,
partikular. Wichtig ist zu erkennen, dass sich die Art
der Endlichkeit von i einerseits und a1 andererseits unterscheiden. Die
Glieder i und z.B. a1 gehören verschiedenen Stufen
der Grenzheit, Begrenzung, verschiedenen Grenzheitsstufen
an. Die Erkenntnis dieses Unterschiedes in der Grenzheitsstufe von
Elementen in einem unendlichen Ganzen ist entscheidend, um die Antinomien
der bisherigen Mengenlehre zu vermeiden.
(LO 4.1.3) Frage: Hat diese Gliederung der Linie o nach
innen ein Ende? Ja! Und zwar: Die Linie o ist beidseitig unendlich. Genauer
gesagt: sie hat unendliche Or-Richtheit. Die Linien i und e gehören noch
der gleichen Grenzheitsstufe an, sie sind auch noch unendlich, haben aber
gegeneinander die Grenze X, sind nur mehr einseitig unendlich
(endlich-unendlich). Die Glieder a1, b1, c1, sind beidseitig endlich, sind
also in der Stufung der Grenzheit noch weiter innen. Teilt man jedoch a1
weiter in 3 Teile, so erhält man der Artheit
nach keinen neuen Typ von Linien, weil 1/3 von a1 wiederum eine beidseitig
begrenzte Linie ist. Die Grenzheitsstufe der Linientypen a1, b1, usw. ist
also die letzte innere Grenzheitsstufe der Linie o. Hier ist das Ende der
Endlichkeit (unterste Grenzheit; Grenze der Grenze).
(LO 4.1.4) An diesen unendlich endlichen Gliedern
(Elementen) in/unter o ist nun in zweifacher Hinsicht Unendlichkeit.
1.
In den Gliedern i, e und ihrer Vereinigung gibt es jeweils unendlich
viele unendlich endliche Elemente (a1..,b1..,c1..).
2.
Jedes unendlich endliche Glied a1, usw. ist selbst weiter unendlich
teilbar und bestimmbar.
(LO 4.1.5) Das Endliche, Bestimmte oder Individuelle jeder
Art und Stufe ist also nicht isoliert, gleichsam losgetrennt von dem, was
neben und außer, über ihm ist (z.B. a1 von o), es ist in/unter seinem höheren
Ganzen und mit ihm vereint, wie auch mit den Nebengliedern.
(LO 4.1.5.1) Aus den bisherigen inneren Gliederungen der
Linie o ergeben sich nun folgende weitere axiomatische Folgerungen:
Die Stufung der Grenzheit und die Großheit sind nun mit
der Selbheit und der Gegen-Selbheit, also der Verhaltheit verbunden
(vereint). Die allgemeine Lehre von der Verhaltheit (von den Verhältnissen)
begreift in sich Verhältnis, Verhältnisgleichheit
(Analogie, Proportion), Verhältnis-Ungleichheit
(Disproportion), Verhältnisreihe
(Progression), nach gleichen oder ungleichen Verhältnissen; die ersten Reihen
sind Gleichverhaltreihen
oder Verhaltstufreihen (Potenzreihen).
Hinsichtlich der Verhältnisgleichheit zeigt die reine Selbheitlehre zwei
Grundoperationen: zu einen gegebenen Musterverhalte und einem gegebenen
Hinterglied das gleichverhaltige Vorderglied zu finden; oder: zu einem gegebenen
Vorderglied das gleichverhaltige Hinterglied zu finden. Auf die Ganzheit
angewandt sind dies das Multiplizieren
(Vorgliedbilden) und Dividieren
(Nachgliedbilden).
(LO 4.1.5.2) Ferner entsteht hier das grenzheitsstufliche
Verhältnis, also das
Verhältnis von Ganzen, die zu verschiedenen Stufen der Grenzheit gehören
(z.B. Linie i zu b1 usw.), als auch grenzheitsstufliche Verhältnisgleichheit,
Verhältnis-Ungleichheit und Verhältnisreihe. Auch die analogen Axiome
hinsichtlich der Verhältnisse von solchen Ganzen, die innerhalb einer und
der selben Stufe der Grenzheit enthalten sind.
(LO 4.1.5.3) Hier ergeben sich nun zwei in der bisherigen
Mathematik und Mengenlehre nicht beachtete wichtige Folgerungen.:
Jede selbganzwesenliche also unendliche und ansich unbedingte
Einheit jeder Art und Stufe (hier die Linie o) ist in/unter sich unendlich
viele Einheiten der nächstniederen Grenzheitsstufe (hier a1, b1, usw;
beachte i und e sind von der gleichen Grenzheitsstufe, wie die Linie o
selbst!!) und so ferner bis zur untersten Grundstufe (die hier mit der
beidseitig begrenzten Linie gegeben ist). Diese Grundstufe ist nach allen
Richtheiten (Strecken, Dimensionen) endlich, und besteht selbst wiederum aus
unendlich vielen Einheiten dieser untersten Stufe (a1 kann man weiter
unendlich teilen). Jede jedstufige unendliche Einheit besteht aus
unendlich vielen unendlich endlichen Einheiten der untersten Stufe.
(LO 4.1.5.3.1) Wir können uns auch ein ähnliches Volk
wie die Karidonier vorstellen, welches als Kosmos nicht nur eine Linie o
sondern eine Fläche besitzt, welche nach den in unserem Artikel PC News
3/91; 2.2 erwähnten Grundsätzen gegliedert ist. Da zeigt sich, daß die Fläche
in sich 4 Grenzheitsstufen hat, wobei erst die 4.Stufe unendlich endliche
Flächen als unterste Stufe ergibt.
(LO 4.1.5.4) Hier zeigt sich auch der Grundbegriff
der unendlichen
Vielheit und darin der unbestimmten Vielheit oder der unendlichen
und darin der unbestimmten
Zahlheit, wobei ein Unendlich-Ganzes des Gleichartigen (hier der
Linie o) vorausgesetzt wird, worin innerhalb vollendet bestimmter
Grenze, die endliche
Einheit der Unendlichkeit des Ganzen wegen, willkürlich
angenommen wird.
(LO 4.1.5.4.1) Hierauf beruht die mathematische
Voraussetzung, dass
die Zahlenreihe 1,2,3,.. und so fort unendlich ist und dass auch
wiederum an jeder Zahl die ganze Zahlenreihe darstellbar ist, durch
Zweiteilung, Dreiteilung, Vierteilung usw. ohne Ende. Diese hier bewiesene,
unendliche und unbestimmte Vielheit, als Grundaxiom der allgemeinen
Zahlheitlehre (Arithmetik und Analysis) ist wiederum eine doppelte. Einmal die
unendliche Artvielheit
oder Artzahlheit von Einheiten, welche artverschieden sind, oder
die Zahlheit der diskreten Zahlen. (Dies ergibt sich aus dem obigen Satz
LO 4.1.5.3)
Hier zeigt sich aber zum anderen auch die unendliche stetige
Zahlheit, oder Stetzahlheit
an Einheiten, welche in ihrem stetigen Ganzen selbst binnen bestimmbarer
Grenze stetig und unendlich teilbar sind. Dies ergibt sich aus: Alles
Stetige, Wesenheitgleiche ist in sich unendlich bestimmbar und teilbar. Die
Lehre von der Artzahlheit ist übrigens von der Stetzahlheit zu unterscheiden.
(LO 4.1.5.4.2) Im weiteren ergibt sich hieraus das Axiom
der stetigen Großheit,
und der stetigen Größen: unendliche Teilbarkeit, unendliche
Vielmaligkeit jedes Endlichen in seinem Unendlichen der nächsthöheren
Stufe; die Gegenrichtheit
hinsichtlich der Richtheit (Strecke, Dimension), das ist die Lehre von den
gegenrichtheitlichen
Größen, den positiven und negativen Größen. Ferner die Axiome
der Stetgroßheit und der Stetgrößen nach der SELBHEIT und der
VERHALTHEIT. Denn es ist eine Größe entweder eine selbheitliche Größe
(Selbgröße; absolute Größe) oder eine verhaltliche Größe
(gegenselbheitliche Größe), Verhaltgröße, relative Größe, welche
hinsichtlich der mit ihr verglichenen Größe groß
oder klein
ist. Die Größeverhaltheit ist selbst wiederum eine der
Gegenselbheit (ein arithmetisches Verhältnis oder Restverhältnis) oder
eine der Vereinselbheit, darunter auch der Vielheit( ein sogenanntes
geometrisches Verhältnis). Das gleiche gilt von der Verhaltheit hinsichtlich
der Stetgroßheit.
(LO 4.1.5.4.3) Alle Größen der selben Grenzheitsstufe
(hier die Linien a1, bn, c5.. usw.) stehen zu einer jeden beliebigen Größe
der gleichen Grenzheitsstufe in einem bestimmten Größenverhältnis, welche
letztere, wenn sie das bestimmende Glied jedes
Verhältnisses ist, die Grundeinheit oder absolute Einheit genannt
wird. (z. B. Verhältnis 1 zu 3 oder 3 zu 1 usw.) Jedes Verhältnis der Ungleichheit
ist diesseits oder jenseits des Verhältnisses 1..1, und zwar entweder eines
der größeren Ungleichheit z.B. 3 zu 1 oder der kleineren Ungleichheit z.B.
1 zu 3. (vgl. auch vorne unter LO 4.1.5.1) die Grundoperationen des
Multiplizierens und Dividierens).
(LO 4.1.5.4.4) Rein nach der Grundwesenheit der Selbheit
sind an dem Stetgroßen folgende Operationen gegeben: Addition und
Subtraktion, indem entweder aus den Teilen das Teilganze oder aus einem oder
mehreren Teilen des Teilganzen der andere Teil (der Rest) bestimmt wird.
(LO 4.1.5.4.5) Die Verhaltheit der Stetgrößen ist selbst
artgegenheitlich (qualitativ) verschieden. Denn sie ist, wie alles Endliche,
Bestimmte selbst nach Unendlichkeit und Endlichkeit bestimmt. Daher ist jedes geometrische
Verhältnis zweier Stetgrößen entweder ein unendliches oder ein
endliches. Ersteres, wenn keine gemeinsame Einheit diese beide Glieder mißt,
das Verhältnis also unzahlig oder unwechselmeßbar (irrational und
inkommensurabel) ist, letzteres, wenn beide Glieder von derselben Einheit
gemessen werden, das Verhältnis also zahlig und wechselmeßbar ist.
(LO 4.1.5.5) Für die Begründung einer antinomienfreien
Mengenlehre ist folgender Satz fundamental: Ein jedes Glied, ein jeder
Teil einer bestimmten Grenzheitsstufe hat zu dem ihm übergeordneten Ganzen
der nächsthöheren Grenzheitsstufe überhaupt
kein Verhältnis der Großheit oder endlichen Vielheit. Man kann also
nicht sagen: Die Linie o oder i sind größer als a1, oder b1. Wir haben zu
beachten: Es gibt die Zahl, „Or-Größe“ Linie o, dann die beiden In-Größen
(In-Zahlen) i und e, und schließlich die unendlich endlichen Größen wie
a1, b5, c7 usw.
Die von den Karidoniern entwickelte Grundwissenschaft der
Linie o haben wir in einigen Aspekten dargestellt. Wir setzen nun unser
Gedankenexperiment fort. Der Karidonier Mart Ulansidor gelangt durch eine
abenteuerliche Reise in „unsere Welt“. Da ist er einerseits erstaunt über
die unendlich viel reichere Geometrie, die wir besitzen, haben wir doch
zweidimensionale und dreidimensionale Raumgebilde, also einen unendlich
viel höheren Grad an Raumunendlichkeiten, die über seine Welt der Linie
hinausgehen. Neben der viel reicheren Geometrie bemerkt er aber auch die
Vielfalt anderer Gegenstände, die unsere Welt bevölkert.
So sehr er davon fasziniert ist, so sehr erstaunt ihn
andererseits bei Durchsicht der mathematischen und logischen Schriften unseres
Planeten der Umstand, dass man versucht, Logik und Mathematik auf die Ebene
(LO 3) im System der Karidonier zu beschränken, dass das Problem der
Unendlichkeit in der Mathematik seit CANTOR zu einer Grundlagenkrise führte,
und prominente Denker wie BROUWER meinen, das Unendliche sei die Möglichkeit
einer unbeschränkten geistigen Konstruktion, es gebe kein
Aktual-Unendliches, sondern nur ein Potentiell-Unendliches. Endliche Mengen
entstünden dann durch eine Hemmung des Erzeugungsprozesses. In den Schriften
der formalen Logik (etwa dem“ Grundriß der formalen Logik“ von BOCHENSKI
und MENNE, 5. Auflage, 1983) fand er nicht die geringsten Hinweise bezüglich
des Aufbaus einer Logik, welche die deduktive Relation vom Unendlichen zu
immer endlicheren Gliedern und deren logische Beziehungen behandelte.
Mart Ulansidor entschloss sich daher, unter Berücksichtigung
der Deduktionen (LO 1-4) zu folgender Behebung der logischen Antinomien der
Mengenlehre.
„'Das Paradies, welches CANTOR uns in seiner Mengenlehre
zu erschließen versuchte, ist erst hier richtig eröffnet. Sein Weg war
nicht frei von Mängeln, die wir hier beheben. Ob und wann die Mathematiker
dieses Paradies betreten werden, können sie nur selbst nach Prüfung
entscheiden.
Der aufsteigende, induktive Weg CANTORs in seiner Grundlegung
einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre ist nicht gründlich, vollständig
und klar, weshalb er auch nicht zur reinen Erkenntnis des Grundwesens, als
des Einen, selben, ganzen, unendlichen und unbedingten Or-Wesens gelangt,
hier symbolisiert durch die Linie o, sondern als höchstes Symbol für das
Grundwesen die absolut unendliche Zahlen-FOLGE annimmt. Wie aber die obigen
Deduktionen zeigen, ist die unendliche Zahlenfolge erst eine unter (LO
4.1.5.4.1) deduzierte INNERE Gegebenheit in/unter der einen selben ganzen und
nach INNEN ABSOLUTEN Linie o. Die Absolutheit (Selbheit) und Unendlichkeit
(Ganzheit) der Linie o liegen jedoch über der Zahlvielheit, der Zahlfolge.
Wohl aber ist die Linie o in/unter sich alle Zahlfolgen, alle bestimmte
Ganzheit, Teilheit, Teilganzheit, alle Grenzheitsstufen. Die Or-Zahlheit der
Linie o ist erst in/unter sich Zahlgegenheit.
Auch die Bildung der Zahlklassen nach dem ersten und
zweiten Erzeugungsprinzip CANTORs erweist sich als mehrfach mangelhaft.
Wenn man sich unter W
die Zahl denkt, welche für den Inbegriff der Zahlen 1,2,3,4,....v steht
(gemäß der Definition CANTORs), so ist nach sorgfältiger Beachtung der
Ableitungen unter LO deutlich, dass die Zahl W
gliedbaulich folgend zu sehen ist:
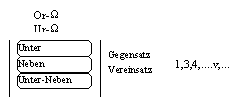 CA0
CA0
Das Eine, selbe, ganze W
ist in/unter sich zuerst einmal die beiden Zahlen i und e nach (LO 2) und
erst in/unter diesen beiden sind in der nächsten Grenzheitsstufe die
unendlich vielen Teile 1,2 usw. die zueinander in Nebengegensatz stehen. Als
Ur-Ganzes, Ur-W
ist W
über den Teilen i und e und weiters 1,2 usw. Weiters sind alle Gegenheiten
und Vereinheiten klar zu erkennen.
Was CANTOR im folgenden nicht beachtet, ist, dass Or-W
im Verhältnis zu den Zahlen 1,2,3,.. der NÄCHSTHÖHEREN Grenzheitsstufe
angehört, dass daher W
und etwa die Zahl 436 verschiedener Grenzheitsstufe angehören. Or-W
folgt daher nicht, wie CANTOR annimmt, als erste ganze Zahl auf v! (Dies
wäre nur bei Neben-Gegenheit von W
und v möglich.) Or-W
ist auch nicht größer als jedes v, sie ist vielmehr das Or-Ganze, in/unter
dem auch alle Endganzen (daher auch v) sind. Die Zahl W
steht mit keinem ihrer In-Teile in einem Verhältnis der Großheit, oder
endlichen Vielheit, kann daher auch nicht „größer“ als eine der
endlichen Zahlen genannt werden (LO 4.1.5.5). Sie ist daher auch nicht die
GRENZE, der die Zahlen 1,2,3,4,..v... zustreben. Jede ganze Zahl ist vielmehr
eine ihrer In-Begrenzungen, während sie im Verhältnis zu ihren In-Grenzen
unendlich und ganz ist. Man muss, um diesen Bau des Verhältnisses klarer
darzustellen, eine verbesserte Schreibweise der Zahlen in etwa folgender
Form einführen:
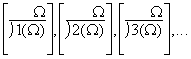 (CA1)
(CA1)
wobei das Zeichen „
 “ das Verhältnis der Untergegenheit der nächstniederen Grenzheitsstufe
der Zahlen 1,2,3,..usw. darstellt und das Zeichen „(W)“
ein Zugehörigkeitsindex der Zahl zur Or-Zahl W
sein soll.
“ das Verhältnis der Untergegenheit der nächstniederen Grenzheitsstufe
der Zahlen 1,2,3,..usw. darstellt und das Zeichen „(W)“
ein Zugehörigkeitsindex der Zahl zur Or-Zahl W
sein soll.
Wie schon gesagt, steht die Zahl W
infolge ihrer nächsthöheren Grenzheitsstufe in keinem Verhältnis der Großheit
zu irgendeinem ihrer In-Unterglieder.
Der nächste Schritt CANTORs
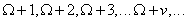 (CA2)
(CA2)
ist unbestimmt und u.U. unzulässig. Da W
in/unter sich die unendlich vielen Zahlen 1,2,3,4,...v,... ist, die der nächstniederen
Grenzheitsstufe angehören, addiert die Operation W+1,
usw. zwei Zahlen unterschiedlicher Grenzheitsstufe. Da aber W
von CANTOR bereits als der Inbegriff aller in ihr enthaltenen unendlich
vielen Zahlen definiert wurde, ist die Zahlenbildung (CA2) ohne genauere Bestimmung,-
jedenfalls im hiesigen Fall CANTORs sicher - unzulässig. Gibt es nämlich
neben W
auf der selben Grenzheitsstufe mehrere oder sogar unendlich viele W1,
W2,
usw. in Nebengegenheit, (so wie in unserem Beispiel unendlich viele Linien
auf einer Fläche, unendlich vielen Flächen in bestimmten Räumen usw.)
in/unter dem Or-Ganzen der nächsthöheren Grenzheitsstufe, so sind die
Summenbildungen (CA3.1), (CA3.2), (CA3.v),.. möglich:
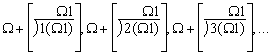 CA3.1
CA3.1
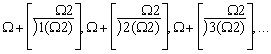 CA3.2
CA3.2
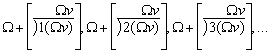 CA3.3
CA3.3
wobei W1,
W2,..
andere W
neben-gegen zu W
in/unter dem nächsthöheren Ganzen bezeichnen, und der Index „(W1)",
„(W2)“
die Zugehörigkeit der entsprechenden Zahl zur Or-Zahl W1,
usw. darstellt.
Es sind im weiteren auch folgende Zahlenbildungen möglich:
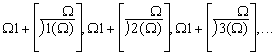 CA4.1
CA4.1
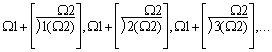 CA4.2
CA4.2
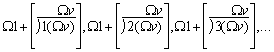 CA4.3
CA4.3
und im weiteren ähnliche Summenbildungen für jedes W,
W1,
W2,
Wv,.
mit jedem der unendlich vielen In-Glieder aller anderen W.
Werden die klaren Unterschiede der Grenzheitsstufen
in/unter einer Art beachtet, so sind die Summenbildungen (CA3) bis (CA5) zulässig.
Eine deutliche Spezifizierung durch Indizes und eine Angabe der
Grenzheitsstufen sind aber erforderlich. Da die Zahlenbildung CANTORs diese
Aspekte nicht berücksichtigt, beginnen hier die Antinomien der
Mengenlehre, die aber in der zeitgenössischen formalen Logik (vgl. Abschnitt
„Klassenkalkül“ bei BOCHENSKI, § 15 bis 17) nicht zufriedenstellend lösbar
sind.
Weiters fehlt bei CANTOR die Summenbildung:
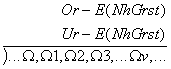 CA5
CA5
Der Index (NhGrst) bedeutet, daß E im Verhältnis
zu allen W
der nächsthöheren Grenzheitsstufe angehört.
Weiters gilt: Das
Potentiell-Unendliche, also die konstruktive Begründung der Zahlenreihe
durch ein Werden, durch eine ins Unbegrenzte fortschreitende Folge usw. ist
in/unter dem Aktual-Unendlichen enthalten. Wir sehen, dass bereits CANTOR
darin irrte, dass er als Grundlage der Zahlentheorie die unendliche
Zahlen-FOLGE annahm.Wie sollten wir sicherstellen können, dass wir bei
Fortsetzung einer Zahlenfolge tatsächlich nicht an ein Ende kommen, wenn
nicht dadurch, dass wir die Aktual-Unendlichkeit voraussetzen,
zumindest stillschweigend postulieren. Denn die Unendlichkeit der
Fortsetzbarkeit des Zählens endlicher Mengen ist ja erst eine INNERE,
abgeleitete Unendlichkeit, welche die Unendlichkeit, hier der Linie o,
voraussetzt.Die zeitgenössische formale Logik wird aber nicht nur im
Klassenkalkül durch diesen Ansatz grundsätzlich betroffen und
verändert, sondern z. B. auch im Begriff der "Negation" des
Aussagenkalküls (vgl.BOCHENSKI, Aussagenkalkül § 3.2).Vom unendlichen,
unbedingten Grundwesen kann nicht gesagt werden: A, non A, weil vom Or-Wesen
nichts verneint wird. Es gibt nur In-Teilverneinung im Grundwesen. Ebenso
kann man hinsichtlich der unendlichen und unbedingten Linie o, wenn man
annimmt, dass AUSSER ihr nichts ist, nicht sagen A, non A, weil AN der Linie
als Or-Linie keine Verneinung ist, sondern nur IN der Linie als i und e
Neben-Gegenverneinung der beiden Glieder gegeneinander und
Unter-Gegen-Verneinung gegen u usw. gegeben sind. Da es aber außer der Linie
o noch andere Linien, andere Gegenstände gibt, ist non A als
Außen-Negation hier zulässig. Die beiden Arten der Negation sind aber
deutlich zu unterscheiden. Näheres vgl. in: "Die Vollendete
Kunst" Kapitel 3.5. Das Denkgesetz. Ähnliches gilt natürlich auch für
andere Begriffe der formalen Logik, wie Allklasse, Disjunktion, Relation,
usw. Beachte: Die Bedeutung dieser grundlegenden Begriffe ist daher im
System LO eine andere, als etwa im "Grundriss der formalen Logik"
von BOCHENSKI. Auch alle bisherigen Inhaltslogiken, vor allem die HEGELsche,
erweisen sich in anderer Hinsicht als mangelhaft.' "Das Denkgesetz, die
formale und inhaltliche Logik, die sich aus (LO 1–5) ergibt, ist im Buch
"Die Vollendete Kunst" Seite 158f. enthalten; die bisher
gründlichste Logik ist die Synthetische Logik KRAUSEs.
1.2.3.2
Grenzziehungsverfahren-Erkenntnisschulen-Grenzen der MI
Wir sagten schon:
Die Frage, inwieweit MI durch DI simuliert werden kann, hängt unmittelbar mit
der Frage zusammen, wo die Grenzen der MI liegen. Je enger diese Grenzen
gezogen werden, umso eher wird man Thesen stützen, MI sei durch DI
simulierbar. Überblicken wir die bisherigen Erkenntnistheorien, können
wir, ausgehend von der engsten, folgende, das menschliche
Erkenntnisvermögen jeweils weiter fassende Schulentypen feststellen:
MI(1) Naiver Empirismus
Die Außenwelt ist uns unmittelbar als subjektunabhängiger
Bereich zugänglich. Wir können daher unsere Erkenntnisse und Beobachtungen
der Außenwelt mit der "tatsächlichen", wirklichen Außenwelt
vergleichen, und dadurch die "Wahrheit" unserer Erkenntnisse
überprüfen.
MI(2) Kritischer Realismus
Dieser wurde etwa
vom späten CARNAP vertreten. Während der Empirismus ursprünglich meinte,
für den Aufbau wissenschaftlicher Theorien könne man sich auf Logik und
Mathematik sowie auf solche Ausdrücke beschränken, die empirische
Begriffe zum Inhalt haben, worunter man solche versteht, deren Anwendbarkeit
mit Hilfe von Beobachtungen allein entscheidbar ist, hat sich diese Annahme
als zu eng erwiesen. Der prominente Kenner der Schule, STEGMÜLLER,
schreibt: "Die Untersuchung über theoretische Begriffe hat gezeigt,
dass frühere empirische Vorstellungen vom Aufbau wissenschaftlicher
Theorien grundlegend modifiziert werden müssen. Während nach den
Vorstellungen des älteren Empirismus in allen Erfahrungswissenschaften
der Theoretiker nur solche Begriffe einführen dürfte, die mit dem
Begriffsapparat definierbar sind, welcher dem Beobachter zur Verfügung
steht, und ferner der Theoretiker nichts anderes zu tun hätte, als
Beobachtungsergebnisse zusammenzufassen und zu generalen
Gesetzesaussagen zu verallgemeinern, ergibt sich jetzt das folgende Bild von
den Aufgaben des Theoretikers. Er hat weit mehr zu tun, als beobachtete
Regelmäßigkeiten zu verallgemeinern. Vielmehr muss er EIN NEUES SYSTEM VON
BEGRIFFEN KONSTRUIEREN, DIE ZU EINEM TEIL ÜBERHAUPT NICHT UND ZU EINEM
ANDEREN TEIL NUR PARTIELL AUF BEOBACHTBARES ZURÜCKFÜHRBAR SIND, ER MUSS SICH
WEITER EIN SYSTEM VON GESETZEN AUSDENKEN, WELCHE DIESE NEUEN BEGRIFFE
ENTHALTEN, UND ER MUSS SCHLIESSLICH EINE INTERPRETATION SEINES SYSTEMS
GEBEN, die eine bloß teilweise empirische Deutung zu liefern hat, die aber
dennoch genügen muss, um das theoretische System für die Voraussetzungen
beobachtbarer Vorgänge benutzen zu können. Die Begriffe, mit denen er
operiert, können GANZ ABSTRAKTE, THEORETISCHE BEGRIFFE SEIN. Dennoch ist er
gegen die Gefahr eines Abgleitens in die spekulative Metaphysik so lange
gefeit, als er ZEIGEN KANN, DASS ALLE DIESE BEGRIFFE EINE VORAUSSAGERELEVANZ
BESITZEN" (Hervorhebungen von S. P.).Aus diesem Zitat entnehmen wir
gleich zweierlei: Zum einen die enorme Bedeutung der überhaupt nicht aus
der Erfahrung stammenden abstrakten Begriffe C, beim Aufbau einer jeden
wissenschaftlichen Theorie. Es zeigt sich also, dass jede empirische
Beobachtung bereits durch das System der theoretischen Begriffe des Forscher
vorgeformt wird, dass also diese Begriffe eine Brille mit bestimmter
Färbung und bestimmtem Schliff sind, mit der wir überhaupt erst
Beobachtungen machen. Setzen wir uns andere Brillen, mit anderer Färbung
und anderen Schliffen auf, erhalten wir ANDERE BEOBACHTUNGEN!!. Die
theoretischen Begriffe sind bereits BEOBACHTUNGSKONSTITUTIV, sie sind an
der Erzeugung der Beobachtung grundlegend beteiligt. Folgerung: Wir erhalten
ANDERE BEOBACHTUNGEN, wenn wir andere theoretische Begriffe benützen.
Die Außenwelt wird eine Funktion unserer theoretischen Begriffe. (Der
geniale Wissenschaftstheoretiker KUHN folgert hieraus aber in einer gewissen
Verlegenheit folgendes: "Sind Theorien einfach menschliche
Interpretationen gegebener Daten? Der erkenntnistheoretische Standpunkt,
der die westliche Philosophie während dreier Jahrhunderte so oft geleitet
hat, verlangt ein sofortiges und eindeutiges Ja! In Ermangelung einer
ausgereiften Alternative halte ich es für unmöglich, diesen Standpunkt
völlig aufzugeben. Und doch, er fungiert nicht mehr wirksam, und die
Versuche, ihn durch Einführung einer neutralen Beobachtungssprache wieder
dazu zu bringen, erscheinen mir hoffnungslos. "Nach unserer Ansicht
kann eine "neutrale" Beobachtungssprache nur gefunden werden,
wenn es wissenschaftlich möglich ist, den Bau der Welt jenseits des
Gegensatzes Subjekt-Objekt in einen unendlichen Grund der beiden DEDUKTIV
ABZULEITEN: (Siehe unten MI(5).)Zum zweiten zeigt dieses Zitat die
Problematik, Metaphysik, also eine über die Erfahrung hinausgehende
Existenzdimension auszuklammern, metaphysische Schulen auszugrenzen.
Sicherlich kann der Begriff "Voraussagesrelevanz" nur sehr
schwer überhaupt definiert werden. Sehr interessant ist übrigens, was
PENROSE meint (S. 420). Er geht wie FREGE davon aus, dass die mathematischen
Wahrheiten in einer geistigen Welt unabhängig vom Subjekt ewig existieren
und nur gefunden werden. Daneben stellen wir aber das physikalische Universum
fest. In der modernen Physik – vor allem Quantenmechanik – erhält das
physikalische Weltbild immer mehr mathematische Züge. So glaubt nun
PENROSE: Diese beiden Welten könnten womöglich gleichgesetzt werden. In dem
hier dargelegten System wird auch diese Frage geklärt: Geistwelt (i) und
Natur oder Leibwelt (e) sind in/unter dem unendlichen Grundwesen. Die Welt
des Grundwesens, als Or-Wesen (gleichnishaft in Linie o) und Ur-Wesens
(gleichnishaft in Linie u) enthalten in/unter sich die beiden ebenfalls noch
unendlichen Welten i (Geistwesen) und Natur (e) gleichnishaft in (LO 2). Die
mathematischen Wahrheiten, die wir in (LO) teilweise ableiteten, gelten
für o, u, Geist und Natur gleichermaßen!
MI(3) Transzendentaler Idealismus
Die
"Außenwelt" ist ein subjektives Erzeugnis des menschlichen
Bewusstseins, wobei nur die Sinneseindrücke auf eine Außenwelt hindeuten.
Das Subjekt erzeugt mittels Sinnlichkeit (E) und Begriffen dasjenige, was
man Außenwelt nennt. Prominente Vertreter sind KANT und WTTGENSTEIN in der
Philosophie des Traktat. Eine über oder außer dem Subjekt gegebene Instanz
zur Sicherung der Wahrheit oder Sachgültigkeit der vom Subjekt erzeugten
Bewusstseinkonstrukte gibt es nicht.
Die
Position Kants
Subjekt-Objekt Beziehung vor Kant
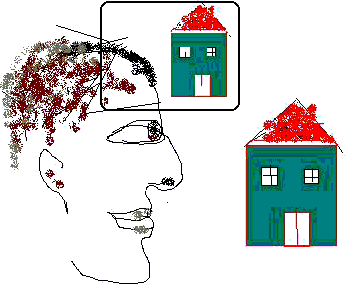
In der Philosophie vor Kant nahm man z.B. an, dass
wir bei der Erkenntnis des Außenwelt davon ausgehen, dass wir Gegenstände
vor uns haben, die real
sind. Also: wir besitzen in uns eine Vorstellung "Haus"
1 von
einem wirklichen Haus
2. Es entsteht dann im weiteren die Frage nach der
Überbeinstimmung von 1 und 2
(Problem
der Wahrheit der Erkenntnis)
Hierbei entwickelten sich im Laufe der
Zeit zwei Grundschulen:
Empirismus
Rationalistische Antwort (idealistisch)
Weil die Dinge sich in uns (wahr?)abbilden Prästabilisierte
Harmonie, durch Gott
Aber
wie bildet 2
sich in 1richtig
ab?
Eingerichtet, dass das Denken in 1
im Inhalt mit 2 übereinstimmt.
Diese
These endet in Skeptizismus.
Kant
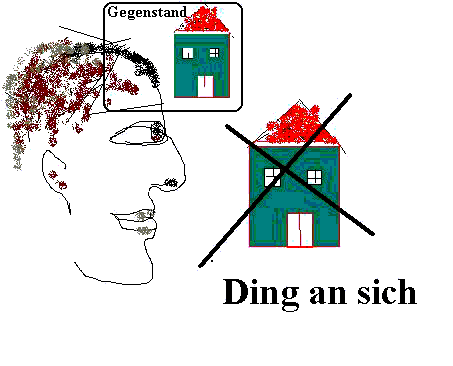
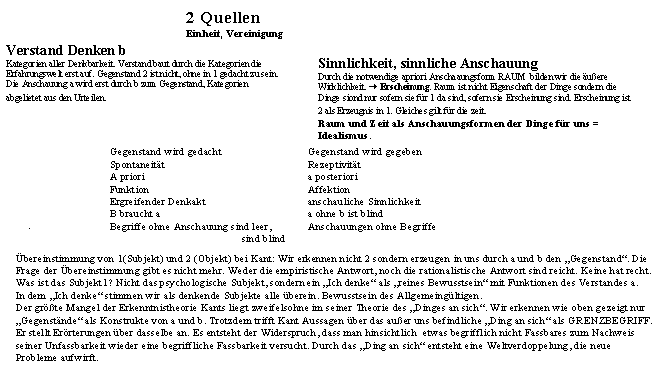
"Logische Tafel der
Urteile:
I.
Der Quantität nach : Allgemeine, Besondere, Einzelne.
II.
Der Qualität nach :
Bejahende, Verneinende, Unendliche.
III.
Der Relation nach :
Kategorische, Hypothetische, Disjunktive.
IV.
Der Modalität nach: Problematische, Assertorische, Apodiktische.
Transzendentale Tafel der
Verstandesbegriffe:
(das Ganze).
II.
Der Qualität
: Realität, Negation, Einschränkung.
III.
Der Relation
: Substanz, Ursache, Gemeinschaft.
IV.
Der Modalität
: Möglichkeit, Dasein, Notwendigkeit."
Es findet sich aber auch die
Anmerkung zu dieser Tafel: "Über eine vorgelegte Tafel der Kategorien
lassen sich allerlei artige Anmerkungen machen, als: 1) daß die dritte aus
der ersten und zweiten in einen Begriff verbunden entspringe ..."
Auch in der "Kritik der reinen Vernunft" findet sich ein ähnlicher
Gedanke: "2te Anmerkung: Dass allerwärts eine gleiche Zahl der
Kategorien jeder Klasse, nämlich drei sind, welche eben sowohl zum
Nachdenken auffordert, da sonst alle Einteilung a priori durch Begriffe
Dichotomie sein muss. Dazu kommt
aber noch, daß die dritte Kategorie allenthalben aus der Verbindung der
zweiten mit der ersten ihrer Klasse entspringt."
Die
Ideen
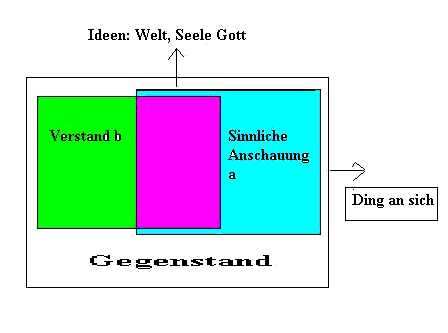
Wird der Verstand b mit seinen Kategorien auf Ideen wie
Gott, Welt, Seele usw. angewendet, dann ist dies deshalb unzulässig weil
diesen Ideen nichts entspricht, wie bei der sinnlichen Erfahrung, wo durch ein
"Ding an sich" durch sinnliche Anschauung und Verstand ein
Gegenstand gebildet wird. Wenn ich daher die Idee der Welt als
"All des Seins" denke, übertrage ich die Kategorien des
Verstandes b, die nur für die Erfahrung also in Verbindung mit a
gelten, auf Unendlichkeiten , die weil unerfüllbar,
sich der Erfahrung entzeihen. Das Sein im Ganzen (Gott) ist kein Gegenstand.
Ideen zeigen sich, wo ich im Fortgang der Verstandeserkenntnis den Abschluss
zu einem Ganzen suche. Sie täuschen, wenn der Abschluss in einem
erkannten Gegenstand erreicht gedacht werden. Dieser Weg ist eine
notwendige Illusion unserer Vernunft. Die Ideen sich notwendige Illusionen
unserer Vernunft. Den Ideen kann in der Erfahrung nie ein adäquater
Gegenstand gegeben werden.
Aber: Wir gewinnen durch die Ideen Regeln unseres
Fortschreitens in der Erkenntnis, aber nicht den Gegenstand der Idee. Die
Ideen sind daher regulative Prinzipien des Fortganges der Forschung, nicht
konstitutive Prinzipien für den Aufbau eines Gegenstandes. Vernunft als
regulative Prinzipien jeden Verstandesgebrauches zum Bedarf einer möglichen
Erfahrung.
Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese regulativen
Funktionen der Ideen, also metaphysischer Bereiche jenseits des Verstandes bei
Kant eine essentielle Rolle spielen, die in der späteren Analyse und
Beurteilung Kants oft einfach ausgeklammert wird. Man beschränkte sich
darauf, seine Grenzziehungsverfahren hinsichtlich des Verstandes als
Legitimation für eigene, zumeist noch engere Grenzziehungen einzusetzen.
MI(4) Transsubjektive,
transpersonale Systeme
Hier wird
angenommen, dass jenseits des Subjektes ein letzter Urgrund, ein Grundwesen,
Gott ist, mit dem der Mensch in Verbindung steht und durch welches Wesen
Subjekt und Außenwelt verbunden sind. In diesen Bereich fallen alle
intuitiven Einsichten, denen aber noch deduktive wissenschaftliche
Präzision fehlt, wie dies in mythischen, pantheistischen und ähnlichen
Konzeptionen in der Darstellung des Verhältnisses zwischen Gott und der
Welt geschieht (z. B. PLATO, HEGEL, SCHELLING, JASPERS, theosophische,
pansophische und mystische Systeme).
MI(5) Grundwissenschaft
Wie schon vorne
angedeutet, sehen wir in der von KRAUSE entwickelten Grundwissenschaft eine
wissenschaftlich präzise, UNDOGMATISCHE, deduktive Metaphysik begründet.
(Näheres siehe vor allem in: "Die Vollendete Kunst" und den neu
herausgegebenen "Vorlesungen über das System der Philosophie"
von KRAUSE.)Wir sehen also nunmehr unsere Schwierigkeiten genauer: MI wird
über erkenntnistheortische Thesen formuliert, die oft mit Vehemenz Grenzen
ziehen. MI wird eine Funktion dieser Grenze. Je enger die Grenze, umso eher
wird die Annahme wahrscheinlich, dass MI durch DI simulierbar sei. Je weiter
die Grenze, umso unwahrscheinlicher, wird die Simulationsmöglichkeit,
oder es wird sogar möglich zu beweisen, dass sie THEORETISCH UNMÖGLICH ist!
1.2.3.3 Toleranzprinzip
Vertreter der
verschiedenen Standpunkte MI(1), MI(2) .. MI(5) können sagen: Wir ziehen
hinsichtlich des menschlichen Erkenntnisvermögens zwar die Grenzen a, b,
c usw., können aber damit nicht ausschließen, dass für andere Menschen
auf Grund deren Erkenntniskonfiguration von uns für uns geleugnete Grenzen
nicht bestehen. Mit der von uns für uns erfolgten Grenzziehung
beabsichtigen wir nicht, diese Grenze für das menschliche
Erkenntnisvermögen ALLGEMEIN und grundsätzlich zu behaupten.
1.2.3.4 Theorien
über die Wahrheit
Die Antwort auf
die Frage, wann einer Erkenntnis Wahrheit zukommt, ergibt sich zweifelsohne
jeweils unterschiedlich aus den Grenzen die man in MI(1) bis MI(5) dem
menschlichen Erkenntnisvermögen zu– oder abspricht. Es ist ein weiteres
interessantes Phänomen der MI, dass es heute bereits eine Vielzahl
solcher Wahrheitstheorien gibt, die wir hier dem Namen nach aufführen, um
dem Leser eine Vorstellung davon zu geben, wie unterschiedlich allein
diese Frage in der Theorie über die menschliche Erkenntnis behandelt
wird.Korrespondenztheorien (Abbildtheorien)Realistische SemantikAbbildtheorie
WITTGENSTEINs im TractatusFREGEs SemantikKorrespondenztheorie bei
RUSSELKorrespondenztheorien des Logischen EmpirismusCARNAPsche Methode der
Extensionen und IntensionenCARNAPs Begriff der
"Verifizierbarkeit"POPPERs Begriff der
"Falsifizierbarkeit"CARNAPs Begriffe der
"Bestätigungsfähigkeit" und "Prüfbarkeit"AUSTINs
KorrespondenztheorieTARSKIs sematischer WahrheitsbegriffKohärenztheorie des
Logischen EmpirismusRedundanztheorieWiderspiegelungstheorie des Dialektischen
Materialismusmit Praxiskriterium und
AnnäherungstheorieEvidenztheorienBRENTANOHUSSERLPragmatische
WahrheitstheorienPragmatisch semantische Theorie der Sprachphilosophie
WITTGENSTEINsPragmatisch–linguistische Relativitätstheorie bei HUMBOLT,
SAPIR und WHORFTranszendental–pragmatische kommunikationistische
Annäherungstheorie bei PIERCE und APELPragmatische Annäherungstheorie bei
JAMESIntersubjektivitäts– und Konsenstheorie bei KAMLAH und
LORENZENDiskursive Konsenstheorie bei HABERMASHermeneutisch–zirkuläre
AnnäherungstheorienTranspersonale WahrheitstheorienBegriff der Wahrheit bei
JASPERSTranspersonal–psychologische Richtungen z. B. bei JUNG, MASLOW,
ASSAGIOLI, BUCKE, usw.Theosophische, pansophische und andere mystische
Systeme.Wahrheitsbegriff des MI(5) unter 1.2.3.1. nach W(gr).Da sich
Digitaltheoretiker u.U. nur mit ganz bestimmten formal–logisch
ausgerichteten Erkenntnistheorien beschäftigen, ist dieser Hinweis
nützlich, um auf die Vielfalt der Bemühungen hinzuweisen, allein die Frage
zu klären, unter welchen Umständen unseren Erkenntnissen Wahrheit zukommen
kann.
1.2.3.4 Arten der Begriffe C
Auch hinsichtlich
der Arten der Begriffe C, die wir bei unserer Erkenntnis ständig benützen,
können wir hier nur einige Andeutungen machen: Aus (LO) und den
Ausführungen über die Mengenlehre ergibt sich hinsichtlich der Ganzheit, in
welcher der Begriff der "Größe" erst axiomatisch abgeleitet ist,
dass wir unendliche Begriffe wie o kennen, dann In-Begriffe, die auch noch
unendlich sind, wie i und e in (LO 2) und schließlich immer endlichere
Begriffe bis zur untersten Grenzheitsstufe. Der Leser möge beachten, dass
alle in (LO) vorkommenden Begriffe überhaupt nicht aus der sinnlichen
Erfahrung stammen, dass wir sie also nicht finden, indem wir außerhalb
unser mit unseren Sinnen die Umwelt betrachten.
Eine Begriffstheorie, die, wie
in
FIGUR 1 untersucht, welche Begriffe wir beim Aufbau
der "Außenwelt" mit unseren Sinnen benützen, ist ein eigener Teil
der Erkenntnistheorie, den wir wiederum nach dem Erkenntnisstandpunkt MI(5)
zusammenfassend hier anführen:
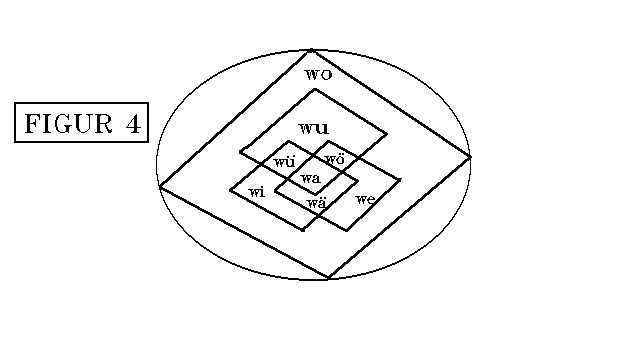
we sind die
empirischen oder nebensinnlichen Begriffe, die ihren Inhalt der
äußerlich–sinnlichen Erkenntnis (mittels (E), D1 und D2) entnehmen und
im Inhalt nicht die Erfahrung übersteigen. Man kann sie auch
Mehrgemeinbegriffe nennen, weil sie uns nur bei Erkenntnissen von
"Beobachtungen" dienen, wo wir schließen, dass das Beobachtete wohl
auch an mehreren anderen so sein würde. (Vgl. oben die Überlegungen für
MI(2).) In diesem Bereich kann aber niemals eine Erkenntnis gefasst
werden, wo wir zu Recht sagen, diese Beobachtung gilt für ALLE x, oder ALLE
y in gleicher Weise. Der reine Allgemeinbegriff kann durch Schluss aus der
Erfahrung niemals abgeleitet werden, weil die Erfahrung immer endlich
bleibt. (Alle Hypothesen, Theorien und Modelle werden zumeist mit
Mehrgemeinbegriffen gebildet. (Vgl. oben MI(2).) Mehrgemeinbegriffe
können aber selbst nur gebildet werden, indem erfahrungsunabhängige
Begriffe wi (z. B. logische und mathematische Begriffe) benützt werden. Die
reinen Allgemeinbegriffe im hiesigen Sinne der
FIGUR1 und 4 werden in der heutigen
Wissenschaftstheorie noch nicht benützt. Da sie aus der Erfahrung nicht
gewonnen werden können, müssten sie DEDUKTIV-AXIOMATISCH in/unter dem
Unendlichen gewonnen werden.(Ähnlich wie bei (LO).) Der Urbegriff wu wäre
als Überbegriff über wi und we zu erkennen, was stillschweigend, aber
nicht explizite, in den meisten Erkenntnistheorien geschieht und wo wäre
der Eine selbe, ganze Begriff, der wi und we in/unter sich enthält und als wu
mit ihnen verbunden ist. (Ähnlich wie bei LO i und e in/unter o sind.)
Schließlich sei
noch ein wichtiger Gedanke erwähnt. Nennen wir die "echten"
Allgemeinbegriffe wi "C1" so müssen wir beachten, dass die
empirischen Begriffe we als "C(e) nicht unmittelbar von jedem Menschen
auf gleiche Weise gebildet werden, sondern dass durch die Erlernung einer
Sprache S jeder Mensch ein System von Begriffen C(s) erwirbt, das für den
Engländer grün, den Österreicher gelb und für den Türken blau ist. Je
nach dem Einsatz von C(s1), C(s2) usw. erhält man eine unterschiedliche
Erfahrung (Welt)!Schließlich möge hier noch daran erinnert werden, dass auch
beim "wissenschaftlichen" Umgang mit Begriffen ständig die
Phantasiekräfte in D(2) eingesetzt werden, um durch Umstellungen von
Begriffssystemen neue Erkenntnisse mittels C, (D) und (E) zu gewinnen.
Weiterhin wird mit Begriffen über Begriffe gedacht (Reflexion auf die
Begriffe unserer Erkenntnis).
2 Digitale Intelligenz
Ein
Digitaltheoretiker schreibt: "Da diese vollständigen Roboter im
Prinzip allen Input–Output–Spezifikationen genügen können, sind sie
in der Lage, unter beliebig gewählten äußeren Bedingungen sämtliche
denkbaren Instruktionen auszuführen – Probleme erfinderisch zu lösen,
Symphonien zu komponieren, Werke der Kunst, Literatur und Technik zu
schaffen und jedes beliebige Ziel zu verfolgen." CULBERTSON.Wir haben
unter 1 die Grundlagen und Grenzen der MI dargestellt und sagen nun: Eine
gleichwertige Simulation dieser Erkenntnisleistungen und ihrer
Verschränkungen ist digital dann gegeben, wenn DI alle diese Leistungen im
gleichen Umfang und gleichen Inhalt simuliert, wozu weiterhin auch die
Fähigkeit gehört, dies "wie ein Mensch" in der Umgangssprache in
dialogischem Kontakt mit dem Menschen darzulegen, woraus dann jeweils
ersichtlich wäre, dass der Computer bei allen seinen Handlungen "das
Gleiche meint" "wie der Mensch" und auch wissen kann, dass er
das meint usw. Wir nennen dies das MI–DI–Postulat.
2.1 Der
Turing-Test
Eine bisher
vorgeschlagene Methode zur Prüfung der Fähigkeiten von Computern ist der
Turing–Test. Es gibt drei Teilnehmer. Einen Menschen X, einen Computer Y,
der natürlich mit einem Programmierer U in Verbindung steht und einen
Fragesteller Z. Der Fragesteller befindet sich allein in einem Zimmer. Für
ihn ist das Ziel des Tests, herauszufinden, welcher der beiden anderen der
Mensch und welcher der Computer ist. Ihm sind Mensch und Computer nur unter
den Etiketten X und Y bekannt und am Schluss des Tests sagt er: "X ist
der Mensch, Y der Computer" oder umgekehrt (
FIGUR 5). Die Fragen und Antworten werden auf
unpersönliche Weise übertragen, z. B. per Tastatur und Bildschirm.
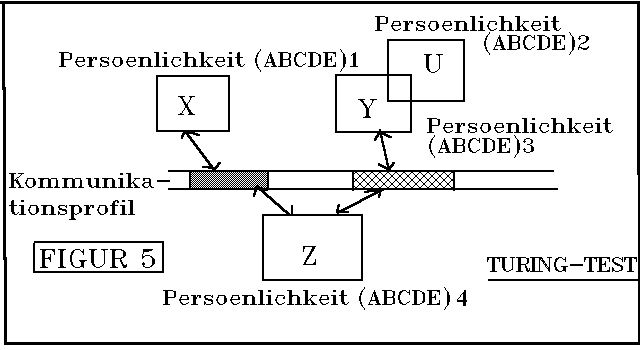
TURING erörtert
also in seinem 1950 erschienenen Aufsatz "Computing Machinery and
Intelligence" die Frage: "Können Maschinen denken?" Die
Testsituation enthält infolge der eingeschränkten Kommunikationsbasis eine
Reihe von Problemen, die teilweise TURING selbst bereits feinsinnig analysiert
(Täuschungsmöglichkeiten, Vorurteile des Menschen gegen den Computer,
programmiertes absichtliches "Fehlverhalten" des Computers,
usw.).Aus den Grundlagen unserer Ausführungen, die TURING natürlich in
bestimmtem Maße überhaupt nicht in Erwägung zog, ergeben sich u.a.
folgende Schwierigkeiten:Welche geistige "Persönlichkeit" im
Sinne der
FIGUR 1 hat der Mensch X in der Versuchsanordnung?
Wie nimmt er Sinnlichkeit (E) auf, welche Fähigkeiten hat er in seiner
Phantasie entwickelt (D1 und D2), welche Begriffe (C, C1, Cs) benützt er,
welche Erkenntnistheorie in der Gliederung 1.2.3.2 benützt er, wie denkt er
über sein eigenes Denken? Kurz: X hat eine (A, B, C, D,
E)1-Persönlichkeit.
Beachten wir
weiters: Wir behandeln hier nur das DENKEN und ERKENNEN der Person X gemäß
FIGUR 1. Wollten wir noch präziser sein, müssten
wir auch sein Fühlen und Wollen behandeln. Diese stehen überdies ständig
mit dem Denken in Verbindung. Die Persönlichkeit müßte daher eigentlich als
ko, ku, (Willen), ki (Denken) und ke (Fühlen) in einer Gliederung wie in FIGUR 2
und auch in allen Verbindungen betrachtet werden. (Wir gehen daher auf das
"Fühlen" und "Wollen" von Computern noch gar nicht ein!)
Der Konstrukteur
und Programmierer U des Computers Y hat eine Persönlichkeit (A, B, C, D,
E)2, der Computer Y eine Persönlichkeit(A, B, C, D, E)3 und der Fragende Z
die Persönlichkeit (A, B, C, D, E)4. Im Rahmen des Tests werden
offensichtlich Frage-Antwort-Dialoge problematisch, wenn nicht alle 3
Beteiligten X, Y(U) und Z hinsichtlich des Modells von Persönlichkeit (A,
B, C, D, E) in
FIGUR 1
und den Erkenntnistheorien M(1) bis M(5) die gleichen Voraussetzungen
besitzen.
Um die
Qualifikation des Turing-Tests auf die Grundlagen zu bringen, die wir in
diesem Aufsatz darlegen, ist die erste Forderung, dass Z die Grundlagen
unter 1 erkennt, anerkennt und als Basis des Tests benützt.Postulat des
Qualifizierten Turing-Tests (QTT)Der Turing-Test muss so aufgebaut werden,
dass es mit ihm möglich ist, einen in allen Details präzisen Vergleich
zwischen den Funktionen der MI, die unter 1 dargelegt wurden, und den
Funktionen des Computers, der die DI repräsentiert, zu ermöglichen. Wir
bezeichnen dies als den Qualifizierten Turing-Test (QTT). Die
Versuchsanordnung ist erst dann sinnvoll, wenn über die
Versuchsgestaltung gesichert werden kann, dass der Vergleich auf dem hier
unter 2 dargelegten Niveau unter Berücksichtigungen der Untersuchungen
unter 1 durchgeführt werden kann. Die Verbindung zwischen X, Y(U) und Z ist
mittels eines Kommunikationsprofils herzustellen, das über die Basis eines
Monitors mit Keyboard hinausgehen muss, um einen präzisen Vergleich der
Funktionalbereiche A, B, C, D, und E bei X, Y(U) und Z anstellen zu können.
Diese Transparenz ist Voraussetzung des QTT. Es ist offensichtlich, dass die
Versuchsanordnung nur dann sinnvoll ist, wenn X, Y(U) und Z alle
Untersuchungen und Problemlagen unter 1 verstanden haben und auch die
erkenntnistheoretischen Unterschiede MI(1) – MI(5) berücksichtigen. Die
Frage TURINGs: "Können Maschinen denken?", wäre im QTT dann mit
"Ja" zu beantworten, wenn sich herausstellt, dass auch Y(U), also
der Computer alles das kann, was unter 1 für die MI angegeben wurde.
Natürlich ist durch unseren Aufsatz gleichzeitig dargelegt, dass derzeit auch
viele Menschen zwar denken, in Bezug auf die hier gegebenen logischen
Grundlagen aber in einer mangelhaften und zu engen Weise. Den QTT nach
FIGUR 5
würden also auch viele Menschen erst bestehen, wenn sie die Grundlagen unter
1 erkannt und anerkannt haben.
Wir werden bei
der Analyse der Anforderungsprofile der DI im weiteren immer wieder die
Frage stellen: "Kann im QTT gezeigt werden, dass der Computer Y(U) diese
Fähigkeit besitzt?" Wir kürzen diese Frage im folgenden ab als:
"QTT-Frage 1" usw.
2.2 Die
Funktionalbereiche des Computers (DI)
Wir nennen den
gewünschten Computer im folgenden "Computer mit DI" und kürzen ab
als CO(DI).Kurzformulierung: CO(DI) muss alles genau gleich können, wie es
für MI unter 1. dargestellt wurde. Nicht also einzelne Funktionen
herausgerissen, sondern auf jeden Fall eine Synthese aller Faktoren unter
1.2. in einem Wirkungszusammenhang und einer Effizienz, welche der MI
entspricht. Als Maschine müsste er daher die gleichen
"Funktionaleinheiten" besitzen, die wir oben in
FIGUR 1 für die MI aufstellten (generelles Postulat an
den Turing-Test)
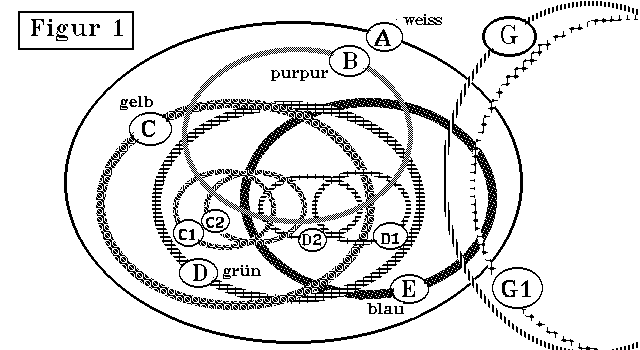
Die einzelnen Einheiten E, D, C, B, A
müssten alle miteinander verknüpft sein und vor allem müssten sie im
Standard ebenso ausgestattet sein, wie es beim Menschen der Fall ist. Für die
Sinneseindrücke (E) "Sinnesorgane" (Auge, Nase, Mund, Tastsinn
usw. sowie deren funktionale Koordinierung wie im menschlichen Körper usw.)
QTT-Frage 1 Eminent wichtig ist im weiteren die Verbindung dieser
"ungeordneten" Sinnesdaten mit der Phantasie D1 und D2. (Vgl. oben
etwa "Ich sehe eine Rose".) Die" digitale Ausstattung"
von D1 und D2, die schon bei der Erkenntnis der MI bisher zu wenig Beachtung
fanden, würde sicherlich neue Probleme bei CO(DI) darstellen. Es würde
nicht genügen, ein auch fast praktisch unbegrenztes Reservoir von
Bild-Files hinsichtlich irgendwelcher bisheriger Augenbilder, Riechbilder,
Geschmacksbilder, Fühlbilder und deren Verschränkungen, Koordinierungen
und Synthesen, als Erinnerung des CO(DI) zu implementieren, die mit den
neu hereinkommenden (E) verglichen werden usw. Die Speicherung solcher
Files müsste ja digital erfolgen (ähnlich wie das Bild OR-OM65.PCX im
Artikel Riemschneiders), es müsste aber wie bei der MI eine UMWANDLUNG
dieser digtialen Files in RAUMZEITLICHE Bilder erfolgen, wie wir sie in
unserer menschlichen Phantasie D1 und D2 ständig hervorrufen können. Der
Vorgang einer Aufrufung digitaler "Sinnesbilder" auf einem
"Monitor" in den Einheiten D1 und D2 würde übrigens das Problem
nicht lösen, weil die Bilder, die in D1 und D2 im menschlichen Bewusstsein
erzeugt werden, nicht so naiv gebaut sind, wie die "flächige"
Generierung digitaler Daten auf einem Bildschirm. Bildlich: Im Raum unserer
äußeren Phantasie D1 und dem der inneren D2 können wir in ungemein
"plastischer Form" Bilderfolgen flexibel durcheinandergreifend,
einander überlagernd usw. wachrufen, verändern und wieder
beiseiteschieben, "verdrängen", selektiv vergrößern usw.
Niemand wird bei Eigenbeobachtung leugnen, dass er solche Raumzeitgebilde in
D1 und D2 bilden kann. Ebenso müssten aber auch in CO(DI) die
Funktionseinheiten D1 und D2 aus "gespeicherten digitalen
Unterlagen" solche "Bilder" DREIDIMENSIONAL MIT DEM GLEICHEN
FREIHEITSGRAD KREATIV AUFBAUEN KÖNNEN, wie die MI es ständig vollbringt
(QTT-Frage 2). Die Schwierigkeit wird noch dadurch erhöht, dass neben einer
hochkomplexen Verbindung zur "Sinneseinheit" wo die (E) gewonnen
werden, in D1 mit D2 vor allem eine Verbindung zur Funktionseinheit C
installiert sein müsste, und zwar so wie beim Menschen, dass ständig durch
den Einsatz bestimmter C (vor allem in der Regel C(s) und C(e) diese
KREATIVEN Bilderzeugungsprozesse regulativ gesteuert, modifiziert,
verbunden, getrennt, in verschiedenen KONTEXTEN unterschiedlich selektiv
aktiviert werden. Wir gehen weiter unten auf die Funktionseinheit C des
CO(DI) näher ein, aber bereits hier ist zu sagen, dass das Zusammenwirken
zwischen (E), D1 und D2 mit C (C1, C(e) und C(s)) so sein müsste, dass die im
menschlichen Bewusstsein von der MI bewerkstelligte
Konfigurationsveränderung (Qualität der Konfigurationsmodifikationen) in
gleicher Weise erreicht wird (QTT-Frage 3)!Ein Sonderfall dieser Fähigkeiten
ist die Erlernung einer Sprache als Lautsprache oder als Schriftsprache. Aus
Platzgründen nur kurz: Um eine Sprache lernen zu können, müssen wir
schon C haben und mit (E), D1, D2 und C "verstehen" können, dass
bestimmte (E) (Laute und Schriftbilder) etwas "bedeuten", was
"in ihnen als Sinneseindruck nicht unmittelbar enthalten ist".
Auch bei unserem CO(DI) müssten daher die Funktionaleinheiten C, D1, D2 und
(E) technisch so ausgestattet sein, dass CO(DI) eine Sprache erlernen kann,
die er bisher noch nicht kannte (QTT-Frage 4).Um einen Teil der hier
geschilderten Fähigkeiten sichtbar zu machen, könnte man sich als
Durchschnittsstandard für DI etwa die Aufgabe vorstellen, dass CO(DI) eine
Illustrierte, wie etwa den "Stern", Heft 45 vom 31.Oktober 1991 so
zu lesen vermag, dass er auf Befragen über Text und Bilder in deutscher
Sprache eine Antwort geben kann "wie ein Mensch". Gerade diese
Aufgabe, die der Leser durch den Kauf und die Lektüre einer Illustrierten
leicht "durchdenken" kann, zeigt die Vielschichtigkeit und
Komplexität des Einsatzes von C, (D) und (E) bei dieser Tätigkeit. Und doch
lesen solche Illustrierte jede Woche Millionen von Menschen mit nur
"durchschnittlicher Bildung" ohne größere Schwierigkeiten.
(Zufällig befindet sich in der Nr. 45 ein Artikel "Wie Sie im Kopf
jung bleiben. Fitness fürs Gehirn mit STERN-Test: Denken, Knobeln,
Kombinieren.) Unser CO(DI) müsste sich also auch selbst testen können. Es
finden sich im Heft, wie üblich, eine Vielzahl von Reklamen, aber auch
Kreuzwort– und Silbenrätsel, wie auch Witze von GARY LARSON sowie ein TV–Magazin.
Es würde natürlich nicht genügen, CO(DI) so zu programmieren, dass er nur
Nr. 45 des Stern lesen und so verstehen kann, dass er uns nachher über
Befragen über "seine Gedanken, Meinungen, Phantasien" Aufschluss
geben kann. Er müsste so gebaut sein, dass er grundsätzlich alle irgendwie
ähnlichen Illustrierten auch lesen und verstehen kann. Er müsste die
"einfache" Fähigkeit haben, Illustrierte lesen zu können
(QTT-Frage 5).
2.3 Phantasie und Kunstentwicklung durch DI
Bereits unter
1.2.2.2. haben wir im Bereich der inneren Phantasie D(2) festgehalten,
dass in dieser Sphäre, bei unserem Computer CO(DI) hier unendlich viele
Bildwelten erzeugbar sind, die entweder unter Einsatz von Elementen aus (E)
und D(1) oder ohne die Heranziehung derselben erzeugt werden können. Was muss
nun CO(DI) können, damit man sagen kann, er schafft wirklich eigene
Kunstwerke "genau wie ein Mensch"? Wir sagten schon, es käme hier
darauf an, dass er, wie ein Mensch, aus der Kenntnis der bisherigen
Entwicklung der Kunstgeschichte, oder bestimmter Richtungen, in der Lage
ist, INNOVATIV Bilder zu generieren, die etwas "Neuartiges",
bisher nicht Gesehenes, darstellen, so wie man sagen kann, die Bilder von
BRUEGHEL, BOSCH, GOYA, KANDINSKY, KLEE, PICASSO, IMMENDORF usw. sind
unverwechselbar als etwas Eigentümliches in der Kunstgeschichte zu
erkennen. Es geht also um eine Innovationsdimension.Nun
schieben wir natürlich gleich ein, dass ja in der Entwicklung der Malerei,
ähnlich auch in den anderen Kunstgattungen, keineswegs alle Menschen, die
Kunstwerke erzeugen, so unverwechselbar Neues schaffen, dass eigentlich
nur wenige diese Qualität für sich in Anspruch nehmen können. Wir sprechen
von Epigonentum. Eine Vielzahl der derzeitigen Maler bewegt sich zweifelsohne
in den "theoretischen Ansätzen", die in den Jahren 1910 bis 1930
neu erschlossen wurden, ihre Werke sind eigentlich Variationen zu bereits
eroberten Gebieten der Malerei (z. B. gab es in Paris im Palais Royal im
Oktober 1991 eine Ausstellung junger Künstler, für welche dies
größtenteils gilt). Wir bezweifeln nicht, dass es möglich wäre, einem
Computer eine Vielzahl von Kunstwerken der führenden Maler aus der
Malgeschichte von 1910 bis 1930 einzugeben und ein Programm zu schreiben,
wobei Bilder als Variationen und Permutationen dieses eingegebenen
Bildmaterials erzeugt werden sollen. Damit könnte man zweifelsohne Bilder
generieren, die mit denjenigen in der Pariser Ausstellung Ähnlichkeit
besitzen. Auch die Computergrafik, welche 1991 mit dem Prix Ars Electronica
ausgezeichnet wurde, oder der digitalisierte Elemente verarbeitende Video–Film:"MANTRON–The
Tokyo Tape" von Konrad Becker (ORF, FS2 vom 8.11. 1991) könnten in
diesem Bereich generiert worden sein. Aber vergessen wir nicht: Niemals
könnte der besagte Computer CO(DI) sich selbst so planen, dass er die Werke
der Kunstgeschichte aussucht, sammelt, scannt, sich selbst einliest und für
sich dann noch das Programm schreibt, mit dem er Permutationen und
Variationen der Formen und Inhalte des eingelesenen Bildmaterials erzeugt,
nach künstlerischen Gesichtspunkten innerhalb des Programms Teile der Werke
ausfiltert usw. (QTT-Frage 6).Der Computer kann also einerseits nicht so
programmiert werden, dass er sich selbst so programmiert, dass er a)
Kunstdaten aus der Malgeschichte nach bestimmten, z. B. theoretischen oder
ästhetischen Gesichtspunkten sammelt, variiert und nachher wieder selektiv
speichert. Er kann aber noch viel weniger b) so programmiert werden, dass er
alles unter a) kann und sich dann selbst noch so programmiert, dass er über
Variationen vorhandener Kunstdaten hinaus unter WECHSEL DER THEORETISCHEN
GRUNDLAGEN seines Programms unter a) ein neues Programm schreibt, mit denen
er Innovationen in der Kunstentwicklung einleitet (z. B. Bilder von
IMMENDORF malt, die er vorher nie gesehen hat). Um bei unserem Aufsatz aus
3/91 zu bleiben: Der Computer müsste alles können, was wir unter 1.2.2.2.
hinsichtlich unserer Bilder erwähnten: Eine neue Maltheorie erfinden,
oder finden, und die Bilder
OR-OMO.PCX
bis OR.-OM100.PCX in
der gleichen Weise und Reihenfolge erzeugen, indem er ein Programm A, das er
sich vorher selbst für sich schrieb, überschreitet, und das Programm B
schreibt, IN WELCHEM A INTEGRIERT BLEIBT, und in B gemäß B Bilder macht.
B enthält also alle bisherigen Kunsttheorien der Geschichte als
Sonderfälle in sich (vgl. das Buch: "Die Vollendete Kunst"). Der
Leser möge auch durchdenken, welche Vielfalt von Begriffssystemen, also
Kunsttheorien C(S1), C(s2),.., hier verbunden werden, was alles im CO(DI)
simuliert werden müsste (QTT-Frage 7).
Wir betonen
nochmals: Echte Simulation liegt erst dann vor, wenn CO(DI) IN sich in der
Funktionseinheit D(2) nicht nur einen Bildschirm hat, wo er diese
Bilderkombinationen und Generierungen digital darstellt, sondern wenn er,
wie der Mensch, in sich diese Bilder in der gleichen vieldimensionalen,
raumzeitlichen Darstellungen von Bildern in der "Außenwelt" weit
übertreffenden Art von Ineinandergreifen, Überschneiden usw. erzeugt, wie
dies der Mensch in seiner inneren Phantasie D(2) kann (QTT-Frage 8).
2.3.1 Der
Generator aller Bilder
Wir möchten hier
noch ein Gedankenexperiment anfügen. Im Aufsatz von Ernst Riemschneider:
"Deduktive Kunst – Digitalisierung"
wird ein Generator vorgeschlagen, der in einem 8X8 Raster Ornamente generiert. In ca. 82 Jahren vermag das Programm auf einem 33MHz AT alle
möglichen Muster in Schwarz–Weiß mit Bildschirmausgabe zu generieren.
Das Programm
Clastic etwa ist eine Sammlung von Modulen, geschrieben in Clean 3.1. welches
prozedurale Texturen erzeugt: "bitmap" images, die aus
mathematischen Algorithmen hervorgehen:
http://users.info.unicaen.fr/~karczma/arpap/
http://users.info.unicaen.fr/~karczma/Work/Clastic_distr/clastic.html
Der
Generator aller Bilder
Wir
stellen uns nun einen Farbbildschirm mit einer Auflösung von etwa 1000 x 720
Pixeln und 300 Farbnuancen vor, die jedem Pixel definitiv zugeschrieben
werden können. Das Programm, welches wir jetzt kreieren, soll alle möglichen Bilder
erzeugen, die durch Variation aller Pixelpositionen und aller
Farbmodulationen möglich sind. Wenn auch nicht in der
gleichen Qualität wie im Original – dieses ist aber sicher in den
nächsten 100 Jahren wesentlich verbesserbar – werden durch dieses
Programm alle bisherigen Bilder der Kunstgeschichte erzeugt werden, auch alle
Bilder aller zeitgenössischen Maler werden wir zu sehen bekommen, und auch
alle Bilder aller Künstler, die es noch geben wird. Generationen von
Beobachtern des Programmablaufes auf dem Monitor wären allerdings nötig,
um diese Generierung zu verfolgen. Es wäre z. B. möglich, dass der
Computer mit diesem Programm Bilder schon erzeugt hat, bevor in 200 Jahren
ein Künstler das gleiche Bild auf anderem Wege schaffen wird usw. Und doch
berührt eine solche, uns sicherlich sehr faszinierende Bildschöpfung
überhaupt nicht das Problem der DI, weil der Computer mit diesem Programm
nicht einmal dieses einfache Programm für sich selbst geschrieben hat, es
auch nicht versteht, und nicht die geringsten Fähigkeiten besäße, die wir
unter 2.1.1. für den CO(DI) forderten. Das Bildgenerierungsprogramm ist
ja auf einem inhaltlichen Niveau, das – vom Computer der es abarbeitet
einmal abgesehen– für jeden, der seinen Ablauf auf dem Monitor
betrachtet, unendlich viele inhaltliche Interpretationen zulässt. Wir
erinnern nochmals an den Mangel, der darin besteht, dass ein Monitor und seine
Funktionsweise überhaupt nicht mit den Bilderzeugungsverfahren und
Bildqualitäten verglichen werden können, die in der menschlichen Phantasie
D(2) vorhanden sind. Ergänzend sei noch erwähnt, dass natürlich ein
Programmierer, wenn er die digitalen Daten (abgespeicherten Files) der
Bilder
OR-OM0.PCX
bis OR-OM100.PCX
kennt, in der Lage wäre, ein Programm zu schreiben, das diese Bilder genau in
der gleichen Reihenfolge und mit genau den gleichen Pixeldefinitionen
generiert. Der Leser wird aber wohl einsehen, dass dies mit dem Problem, von
dem wir sprechen, nichts zu tun hat. Der CO(DI) wäre hier überhaupt nicht
kreativ und die Kreativität des Programmierers bestünde in der
Herstellung eines Programms, welches vorhandene Daten neuerlich prozessual
kopiert.
2.4 Entwicklung
der Wissenschaft durch DI
Der von uns
besprochene CO(DI) müsste neben den bisher besprochenen Bereichen (E),
D(1) und D(2) und deren komplexen Verbindungen vor allem im Bereich der
begrifflichen Operationen C, C(s), usw. und deren Verknüpfung mit (E),
D(1) und D(2) gleich arbeiten können wie ein Mensch. Gerade in diesem
Bereich bestehen aber, wie wir unter 1.2.3. aufzeigten, schon hinsichtlich
der MI Unklarheiten und unzulässige Grenzziehungstheorien, MI(1), MI(2)
usw. Da der Umfang dieser Arbeit es nicht zuließe, den gesamten Stand der
Erkenntnistheorie, Logik und Mathematik darzustellen, beschränkten wir
uns auf die Axiomatik unter (LO 1–5) und eine Axiomatisierung der Mathematik
(CA1) bis (CA5). Wir halten fest: Hier meint Axiom nicht ein hypothetisches
Postulat, wie etwa in der Axiomatik der natürlichen Zahlen PEANOs aus dem
Jahre 1891, sondern als Grundaxiom den unendlichen und unbedingten Begriff
(Or-Begriff) z. B. der Linie o, in dem deduktiv alle Teilbegriffe usw.
abgeleitet werden. Diese Axiomatik ist auch nicht mit den GOEDELschen
Problemen der Etablierung eines widerspruchsfreien axiomatischen Systems
behaftet, weil bei Anerkennung des Grundaxioms, des unendlichen und
unbedingten Begriffes (Grundwesens) das Axiom kein Satz sondern ein Begriff
ist, der alle anderen Begriffe, Sätze, Ableitungen usw. IN sich hat. Der
Gedankengang GOEDELs ist etwa: Die Widerspruchsfreiheit eines axiomatischen
Systems lässt sich nicht in ihm, mit seinen Methoden beweisen. Das schließt
nicht aus, dass ein System bewiesen werden kann, allerdings nur mit
Methoden außerhalb des untersuchten Axiomensystems. Man muss aber die
Prüfung der Widerspruchsfreiheit auch für das System
"außerhalb" anstellen, wieder in einem neuen System usw. Wir
geraten in einen endlosen Prozess (infiniten Regress). In der hier
dargestellten Axiomatik ist dieses Problem behoben, weil das höchste Axiom,
das vom Leser nicht als Hypothese angenommen, sondern als Linie o auch
einsichtig erkannt wird, die unendliche unbedingte Linie o als Or-Linie ist
(LO 1), die nichts außer sich hat, wenn man unser Gedankenmodell unter
1.2.3.1.1 benützt. (In der allgemeineren Formulierung: Weil das höchste
Axiom das Eine, unendliche und unbedingte Grundwesen ist, nicht als ein Axiom,
AUSSER dem etwas wäre. Das unendliche, unbedingte Grundwesen ist der
oberste BEGRIFF, der alle anderen in sich hat, daher auch alle anderen
axiomatischen Systeme in sich hat usw. Der unendliche Regress "hört dort
auf" wo man zum Einen Unendlichen und Unbedingten Grund gelangt.)
Bleiben wir beim Beispiel der Linie o mit (LO) so hört der
unendliche Regress aller Axiomensysteme, die sich mit den Teillinien in
der Linie o beschäftigen, was heute in Logik und Mathematik geschieht, beim
Begriff: "Eine, selbe, ganze, unendliche und unbedingte Linie"
auf. Das hat GOEDEL nicht erkannt! Hier wird auch in die derzeitige
Diskussion eingegriffen. PENROSE weist auf das nicht-algorithmische Wesen
der mathematischen Erkenntnis unter Bezug auf GÖDEL hin (S. 406) und
WANDSCHNEIDER führt in der Einleitung zu diesem Buche aus:" Dass in
einem System Grenzen formal-algorithmischer Beweisbarkeit existieren, kann
der Mathematiker allein unter der Bedingung beweisen, dass er zu einem Metasystem übergeht. Für den
Mensch-Maschine-Vergleich wäre somit vor allem zu klären, ob die
Möglichkeit eines solchen Übergangs nur für den Menschen, oder
grundsätzlich auch für die Maschine besteht. "Die Lösung dieses
Diskurses unter Bezug auf MI(5) und (LO) ist: Das Gödeltheorem gilt nur
für bestimmte logische, vor allem formal-logische Systeme, nicht jedoch
für die Synthetische Logik, die sich aus der GRUNDWISSENSCHAFT und (LO)
ergibt. Es ist also zweierlei weiterzubilden: a) die menschliche Erkenntnis bis zur
Einführung der Synthetischen Logik, mit unendlichen Grundbegriffen (also
eine Verbesserung der derzeitigen logischen Systeme) und b) daraus
die Einsicht zu gewinnen, dass im Mensch-Maschine-Vergleich nicht nur zu
erreichen wäre, dass Maschinen im GÖDELschen Sinne infinit zu immer neuen
Meta-Systemen übergehen können, sondern auch, dass sie von sich aus die
Erkenntnisbereiche überschreiten, in denen GÖDEL selbst sich bewegt
hat, zu MI(5) voranschreiten, sich nach (LO) und der Synthetischen Logik
programmieren, natürlich unter Zugrundelegung der Grundsätze in (LO)
und der Synthetischen Logik (QTT-Frage 9).
2.5 Der Computer
und das Unendliche
2.5.1 Ein BASIC–Programm
10
PRINT "Ich zähle von
der Zahl 1 ausgehend jeweils"
20
PRINT "gegenüber dem
vorigen Zählschritt um 1 weiter."
30
PRINT "Mir ist nach
Studium des hier abgedruckten"
40
PRINT "Artikels
einsichtig, dass nach den darin
dargelegten"
50
PRINT "Grundlagen der
Mathematik die unendliche"
60
PRINT "Or–Zahl,
repräsentiert durch die Linie o und"
70
PRINT "die beiden
einseitig unendlichen
Zahlen i und e,"
80
PRINT "repräsentiert
durch die beiden Linien i und e,"
90
PRINT "in dem
Programm, in dem ich ablaufe, nicht
repräsentierbar
sind."
100
GOTO 10
2.5.2
Anforderungen
Im Rahmen der
Ausstattung unseres CO(DI) müssen wir nun fordern, dass seine Hard- und
Software in der Lage sind, unsere Ausführungen unter 1. zu verstehen,
insbesondere die erkenntnistheoretischen Überlegungen und die Stufung der
Erkenntnisschulen. (Z. B. auch Reflexion auf Begriffe C, C(s), daher auch
Reflexion auf die Begriffe des Programms, die Grundlage seines
Funktionierens sind, Reflexion auf die begrifflichen Grenzen der Stufen der
Erkenntnistheorien nach MI(1) bis MI(5).) CO(DI) müsste daher sagen können:
"Die logisch-mathematischen Grundlagen, mit denen in den Programmen,
nach denen ich arbeite, vorgegangen wird, entsprechen nicht
erkenntniskritischen Überlegungen in den Systemen MI(4) und MI(5), weshalb
ich vorschlage, sie hinsichtlich folgender Aspekte zu modifizieren, weshalb
ich mich selbst danach neu programmiere", usw. (Ansatzweise vgl. etwa
PARTRIDGE, 7.4 Meta-Wissen;(QTT–Frage 10.)CO(DI) müsste aber vor allem in
der Lage sein, die Sätze in (LO) zu verstehen und sie in einem eigenen
Programm, das er selbst schreibt, zu simulieren. ER MÜSSTE DIE AXIOMATIK (LO)
DIGITALISIEREN! Dies erweist sich aber deshalb als LOGISCH UNMÖGLICH, weil
die herkömmliche Digitalisierung eine Logik voraussetzt, eine Logik benützt,
die als teilirriger Sonderfall IN der Logik enthalten ist, die in (LO)
etabliert werden soll. Das wäre so, um ein Beispiel im ENDLICHEN
Bereich zu verwenden, als wollte man mit einem Finger die Funktionen des
gesamten Körpers simulieren. Es sind insbesondere alle Axiome (LO 1–3)
in der digitalen Logik nicht repräsentierbar, nicht integrierbar und die
Axiome (LO 4) nur in einer sehr spärlichen Form, weil ja der gesamte
axiomatische Zusammenhang mit (LO 1–3) fehlen müsste. Auch in (LO 4) sind
aber nur UNENDLICH-ENDLICHE Größen und deren Operationen digitalisierbar
(natürlich dies alles nur von Programmierern, nicht von CO(DI) selbst
(QTT-Frage 11)!Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:1. Der Aufbau der Wissenschaft, aller
ihrer Teildisziplinen ist bei Anerkennung einer Erkenntnistheorie im Sinne
MI(5) und Grundwissenschaft weder vom Menschen noch von einem CO(DI)
digitalisierbar, weil die Axiomatik in MI(5) mit der Axiomatik der digitalen
Logik nicht simulierbar ist. Der Aufbau der Wissenschaft ist daher logisch–präzise
möglich, aber nicht im Rahmen der bisher erkannten logischen und
mathematischen Systeme.2. Die sich aus der Grundwissenschaft in
MI(5) ergebende Logik ist weder vom Menschen noch von CO(DI) digitalisierbar,
weil die Grundlagen der digitalisierenden Logik ein teilirriges logisches
Sondersystem in der Logik der Grundwissenschaft ist.3. Die Axiomatisierung der sich aus der
Grundwissenschaft im System MI(5) ergebenden Mathematik ist weder durch
einen Menschen, noch durch CO(DI) digitalisierbar, weil die Grundaxiome
dieser Mathematik in einer digitalisierten Mathematik des Programms nicht
simulierbar ist.4. Bei der Umsetzung von MI in DI gibt es
daher nicht nur technische Probleme, die sich im Laufe der Entwicklung der
Technik und durch Verfeinerung der Maschinen beheben lassen (z. B.
Verarbeitung noch beträchtlich höherer Datenmengen in kürzerer Zeit),
sondern es gibt QUALITATIVE UND LOGISCHE GRÜNDE, weshalb bestimmte Teile
der MI ÜBERHAUPT NICHT DIGITAL SIMULIERT WERDEN KÖNNEN.5.
Um in unserem
Bild zu bleiben: DI oder KI kann sich auch in aller Zukunft nur in
Teilbereichen von (LO 4) also im Bereiche unendlich endlicher Linien in/unter
Linie o betätigen, Simulationen programmieren (teils durch die MI, teils
durch Implementierung von Programmierfähigkeiten in die DI), sie kann
niemals die Ableitung (LO 1–4) algorithmisch repräsentieren und diese
Axiomatik auch nicht sich selbst als DI VERSTÄNDLICH MACHEN (QTT-Frage
12).6. DI
wird durch gigantische Ausweitung in den geschilderten Sphären im
Bereiche von MI, die alle Bereiche C, (D) und (E) und deren
Wechselwirkungen erweitern, soziale Umwälzungen einleiten, die
Etablierung wesentlich differenzierterer und komplexerer Sozialsysteme
ermöglichen, wo alle Untersysteme verfeinert aufeinander abgestimmt werden
können, aber die MI muss im Laufe der Evolution die gesamte Wissenschaft
und Kunst auf die Grundlagen MI(5) hin weiterbilden, IN der dann die DI
ihren untergeordneten Platz einnimmt.7. Werden diese Unterschiede und
Wechselwirkungen zwischen MI(5) und DI erreicht, wird die weitere
Entwicklung der Weltgesellschaft in einem neuen Stadium harmonisiert.

Ausgewählte
Literatur
BOCHENSKI–MENNE: Grundriss der formalen
Logik. 1983
DREYFUS:
Die Grenzen künstlicher Intelligenz. 1985
EBELING:
Gehirn, Sprache und Computer. 1988
HANDKE:
Sprachverarbeitung mit LISP und PROLOG auf dem PC. 1987
JACKSON:
Expertensysteme. 1987
KRAUSE:
Vorlesungen über das System der Philosophie, 1928 und 1981.
KRAUSE:
Vorlesungen über Synthetische Logik. 1884
LEOPOLDSEDER:
Der Prix Ars Electronica. 1991
PARTRIDGE:
KI und das Software Engineering der Zukunft, 1986
PENROSE:
Die Debatte um Künstliche Intelligenz, Bewusstsein und die Gesetze
der Physik. 1990
PFLEGERL:
Die Vollendete Kunst. 1990
PINZ:
Wissensbasierte Mustererkennung. 1989
SHAPIRO:
Structured Induction in Expert Systems.1987
STUMM–WIRTH:
Psychoterapie. Schulen und Methoden. 1991
WINSTON:
Künstliche Intelligenz. 1987