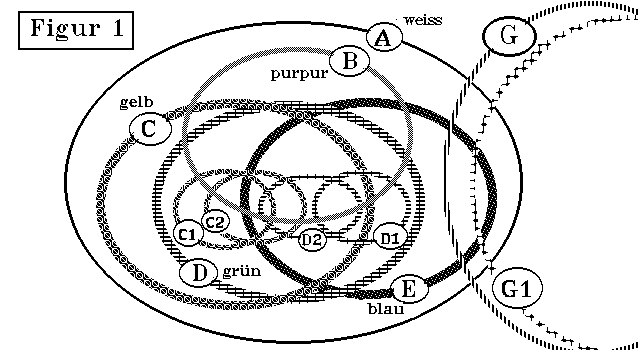
Was Gott vor dem "Urknall" dachte oder Zeilingers "Quelle" 2
Ein Beitrag zur Philosophie der Physik 2
Was bietet dieser Beitrag – Übersicht 3
1. Menschliche Erkennntnisoperationen 8
1.1 Erkenntnis der menschlichen Erkenntnis 9
1.2 Gliederung, Struktur der menschlichen Erkenntnisoperationen 9
1.2.1 Erkenntnis von Außenwelt 11
1.2.1.1 Äußerlich sinnliche Erkenntnis mittels E, D(1), D(2), C, B, A 11
1.2.1.1.4.1 "Ich sehe eine Rose" 18
1.2.1.2 Integrative Koordinierung der Zustände, "Daten" aller Sinne 19
1.2.2.1 Äußere Phantasie D(1) 22
1.2.2.2 Innere Phantasie D(2) 22
1.2.2.3 Phantasie bei der Bildung neuer Begriffe in physikalischen Theorien 23
1.2.3 Begriffswelten (Logik, Mathematik, Theorien) 23
1.2.3.1 Systematische Analyse der Erkenntnisbegriffe 24
1.2.3.2 Grenzziehungsverfahren- Grenzen der Erkenntnisschulen 25
1.2.3.2.1 Die Kategorien bei Kant 32
1.2.3.3 Intermezzo 1 - Postmoderne 34
1.2.3.4 Intermezzo 2 – Oszillation der Physik in den Erkenntnisschulen (1) bis (3) 38
1.2.3.5 Theorien über die Wahrheit 44
1.2.3.6 Arten der Begriffe C 44
2. Die Essentialistische Wende 46
Die analytischen Erkenntnisse des Ichs als erkennendes Wesen 47
Erkenntnis des Geistes in Gott, in Vernunft und Natur 51
3. Wesenschau und Göttliche Kategorien 53
Grundlagen der Göttlichen Mathematik und Logik 53
Der Kategorienorganismus der Grundwissenschaft 53
Struktur der Universalsprache, Or-Om-Sprache 75
Ableitung der Mathematik aus der unbedingten und unendlichen Wesenheit Gottes 77
Behebung der Antinomien der Mengenlehre (Cantors) 78
Was Gott in sich ist – Weitere Gliederung der Wesen in Gott 82
Verhältnis von Gott, Geist und Natur 83
Die innere Gliederung des Vereinwesens a2 85
Weitere Ausführung der Position der Menschheit 85
4. Deduktion – Intuition - Konstruktion 89
4.1 Die Ableitung (Deduction) 90
4.2 Die Selbeigenschauung (Intuition) 92
4.3 Die Vereinbildung der Ableitung und Selbeigenschauung, als Schauvereinbildung (Construction) 95
5.1 Das Denkgesetz der gesetzten Wesenheit 101
5.2 Das Denkgesetz der gegengesetzten Wesenheit 102
5.3 Das Denkgesetz der vereingesetzten Wesenheit 105
6. Grundlagen einer neuen Naturphilosophie (wi) 106
Weitere Deduktionen hinsichtlich der Naturwissenschaft 110
Exkurs über die Entwicklung der Raum- und Zeittheorien 113
Allbegriff – Ideen der Natur – Theorien der modernen Physik 116
I. Beispiel: Quantenlogik nach (Mi 89, S. 216 f.) und Or-Om-Logik 117
II Beispiel: Abstrakte Quantentheorie der Ur-Alternativen (Weizsäcker und Lyre) 122
Die Grundargumentation der Urtheorie in Kurzform: 123
Philosophische Grundlagen der AQT 126
Verbindung von Ur-Theorie und Inhaltslogik der Wesenlehre 131
Die Or-Om-Logik der unendlich langen, geraden Linie 132
Der karidonische Weizsäcker 146
Zusammenfassung der deduktiven Analyse des karidonischen Weizsäcker 165
7. Abschließender Ausblick 168
"Die wahren Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung werden eines Tages am Anfang einer abstrakten Begründungskette unserer fundamentalen Naturgesetze stehen. Zwar werden wir sie niemals zweifelsfrei kennen, doch sie werden durch keine Erfahrung mehr hintergehbar sein. Und wir sollten darauf gefasst sein, letzten Endes auf sehr abstrakt allgemeine Konzepte zu stoßen." (Lyre)
M. Morrison schreibt in seinem Artikel: "The one and the many: the search for unity in a world of diversity": "Ontological reductionism is characterized as 'less rewarding because it is tainted by a dogmatic faith that everything emanates from some supreme existent that science has the power to grasp.' "
Die folgende Darstellung versucht zu zeigen, dass es einen wissenschaftlich-undogmatischen Erkenntnisweg bis zur Erkenntnis des höchsten Wesens gibt, an und in welchem die wissenschaftlichen Grundlagen (Axiome) einer neuen Mathematik, Logik, Sprachstruktur und Naturwissenschaft ableitbar sind. Darin liegt auch die Möglichkeit einer Vereinheitlichung und Weiterbildung aller bisherigen physikalischen Theorien. Eine kühne Behauptung! Möge jeder selbst prüfen!
Die moderne Physik befindet sich in einer postmodernen Situation. Eine Vielzahl nicht kompatibler Theorien, die alle in sich noch differenziert sind, stehen in einem unverträglichen Gegensatz zueinander. Es sind dies vor allem die Relativitätstheorien (RT), die Quantentheorien (QT), die Stringtheorien (STT) und die Theorien, welche eine Vereinheitlichung dieser drei Theorietypen (VT) versuchen. Die einzelnen Schulen und ihre Vertreter besitzen oft unterschiedliche erkenntnistheoretische Annahmen, gehören daher verschiedenen Erkenntnisschulen an, was sowohl die Art ihrer Arbeit, als auch die Interpretation ihrer Ergebnisse maßgeblich beeinflusst. Wir fragen daher:
1. In welche der unten systematisierten Erkenntnisschulen (1) bis (5) ist das System, bzw. jeder ihrer Vertreter einzuordnen? Daraus ergeben sich grundsätzliche, oft auch deutlich vom System gewünschte Grenzen des Systems. Überwiegend befinden sich die Systeme in den Schultypen (1) bis (3). Die in der heutigen Philosophie entwickelte Schulenpalette der "schwachen Vernunftarten" wie der Postmoderne usw. wirken kaum in die Reflexionsbereiche physikalischer Theorien. Der Beitrag weist auf eine NEUE Erkenntnistheorie hin: Erkenntnisschule (5), welche die bisherigen Erkenntnisschulen überschreitet, eine undogmatische Metaphysik begründet, die eine begriffliche Klarheit besitzt (Grundwissenschaft), welche gerade den Theoretikern der Physik neue Perspektiven eröffnen kann. "Undogmatisch" meint, dass niemand verschwommene Spekulationen akzeptieren müsste, sondern schrittweise in eigener Einsicht bis zu den Basisbegriffen der neuen, auf der Unendlichkeit und Absolutheit der Göttlichen Wesenheit beruhenden Grundwissenschaft geführt werden kann. Jeder hat allerdings nach eigener Prüfung zu entscheiden.
In allen betroffenen Theorietypen spielen bestimmte Arten der mathematischen Logik und ein bestimmter Typ der Mathematik eine konstitutive Rolle. Auf höchste begriffliche Präzision wird besonderer Wert gelegt. Spekulative Verschwommenheit wird abgelehnt. Wir fragen daher:
2. Welche Erkenntnistheorie benutzt die Theorie hinsichtlich der von ihr eingesetzten Logik und Mathematik? Wie wird insbesondere das Unendlichkeitsproblem in Logik und Mathematik gesehen (Verhältnis von Aktual-Unendlichem zu Potentiell-Unendlichem, Unendlichkeiten unterschiedlicher Grenzheitsstufen, zu den Antinomien der Mengenlehre)? Welche Theorien für Zeit, Raum oder Raumzeit werden benutzt? Hier bieten unsere Untersuchung eine neue Logik, und eine neue Mathematik, die beide an der unendlichen Absolutheit der Göttlichen Wesenheit abgeleitet werden.
3. Wie
interpretiert die Theorie die unerlässliche Verbindung von (konstitutiv
wirkender) Umgangssprache und (konstitutiv wirkenden) Wissenschaftssprachen?
Sowohl die Umgangssprache als auch die Begriffe der jeweiligen Theorie sind
konstitutive Bestandteile jeder Theorie, ihrer Beobachtungen, der
Ergebnisse der Untersuchungen, der Vergleiche zwischen theoretischen
Annahmen und beobachteten Fakten.
Die Relativitätstheorien (RT) , die Quantenphysikalischen Theorien (QT) und die Stringtheorien (STT) akzentuierten in unterschiedlichen Bereichen die Bedeutung des Beobachters, seine relativen Zustände im Messvorgang und die Beeinflussung des Messvorganges durch seine Beobachtung. Wie aber stellen sich die Theorien zu folgender
Relativitätstheorie der Naturerkenntnis
Werden
Mikroerscheinungen im subatomaren Bereich in der Natur mit Licht beobachtet,
wird durch die Wirkung des Lichtes des Beobachtungsvorganges der beobachtete
Bereich verändert (Heisenbergsche Unschärferelation). "Dies demonstriert nach
der Kopenhagener Standardauffassung eine irreduzible Einflussnahme des
Beobachters auf die zu messende Größe, genauer, der Beobachter legt durch die
Wahl der Messanordnung fest, was gemessen werden soll. In diesem Sinne ist der
Beobachter an der Erzeugung von Elementen der Realität im Messakt beteiligt.
Vor der Messung kann vom objektiven Vorliegen des Spins nicht gesprochen
werden – zu einem Element der Realität wird er erst im Monment
der Messung, also der irreversiblen Registrierung in einem Messapparat."
(Lyre). In den Relativitätstheorien wiederum werden die idealistischen Annahmen
der klassischen Physik durch die Berücksichtigung der Systembedingungen des
messenden Beobachters qualitativ und quantitativ berücksichtigt. So wie aber die
Relation der unterschiedlichen Systemzustände unterschiedlicher Systeme in
diesen Theorien in einer alle möglichen Systeme umfassenden Allgemeinheit
mathematisch formelhaft erfasst wird, gehen wir einen Schritt weiter und
formulieren eine allgemeinere Theorie, in der die Relation zwischen
unterschiedlichen physikalischen Theorien allgemein relativiert
wird.
Wir sehen bekanntlich
nicht diese subatomaren Mikrobereiche (in der QP) oder Gegenstände
(in SRT und ART), die sich bewegen,
wie sie wirklich sind. Wir machen uns ja nur aus Zuständen in den
Augen E mit Phantasiebildern D und Begriffen, z. B. der wissenschaftlichen
Theorie C(QP), C(RT) und C(STT), ein inneres Bild von der Sache (in den
folgenden Kapiteln werden diese Erkenntnisoperationen genau nuntersucht).
Nun die entscheidende Überlegung: Nicht nur durch die Lichtstrahlen, die wir auf das Beobachtungsobjekt lenken, wird verändert, was wir beobachten (QP), nicht nur die Bewegungsform unseres Systems präformiert unsere Messergebnisse (RT), sondern auch durch eine Veränderung in den Begriffen C(QP/RT/STT) und in den Phantasiebildern D wird unsere Beobachtung, das Beobachtungsergebnis, verändert. Bei Veränderung der Begriffe "verschwindet" das eine Bildergebnis, und es ergibt sich ein anderes.
Hinzu kommt: Wir können das Bild, das wir uns in der Beobachtung gemacht haben, niemals mit der Wirklichkeit außerhalb unser vergleichen, wir können nicht feststellen, ob unser Bild dem entspricht, was außerhalb unser ist, denn wir kommen niemals hinaus zu den Dingen, wir können nur verschiedene, in verschiedenen oder gleichen Begriffssystemen gewonnene Bilder in uns miteinander vergleichen.
Es wäre sehr wichtig, allen theoretischen Physikern diese Überlegungen näher zu bringen. Wenn daher Zeilinger (S. 216) meint, die Naturgesetze dürften keinen Unterschied machen zwischen Wirklichkeit und Information, dann meint er damit: Wir haben es immer nur mit unseren Informationen über die "unzugängliche Wirklichkeit" zu tun, eine echte Relation zur "Wirklichkeit" können wir nicht herstellen, daher können wir unsere Information, unsere Konstruktion der Wirklichkeit, mit der "Wirklichkeit" gleichsetzen. Das ist zweifelsohne eine bereits seit langem etablierte Erkenntnisschule, die im Schultyp (3) einzuordnen ist. Hierzu sind etwa auch die Untersuchungen Lyres, die wir unten behandeln, und die sich in seinem Artikel "Zur apriorischen Begründbarkeit von Information" http://www.lyre.de/dkp18.pdf zeigen, von Interesse.
Hieraus entnehmen wir die enorme Bedeutung der überhaupt nicht aus der Erfahrung stammenden abstrakten Begriffe C (und deren Systematik) beim Aufbau einer jeden wissenschaftlichen Theorie (Erkenntnisschulen).
Es zeigt sich also, dass jede empirische Beobachtung, was man auch als empirische Fakten bezeichnet, bereits durch das System der theoretischen Begriffe des Forscher vorgeformt wird, dass also diese Begriffe eine Brille mit bestimmter Färbung und bestimmtem Schliff sind, mit der wir überhaupt erst Beobachtungen konstruieren. Setzen wir uns andere Brillen mit anderer Färbung und anderen Schliffen auf, erhalten wir andere Beobachtungen.
Die theoretischen Begriffe sind bereits beobachtungs-konstitutiv, sie sind an der Erzeugung der Beobachtung grundlegend beteiligt. Folgerung: Wir erhalten andere Beobachtungen (empirische Fakten), wenn wir andere theoretische Begriffe benutzen. Die Benutzung jeder Theorie hat die Erzeugung spezifischer Fakten zur Folge. Die "Außenwelt" wird eine Funktion unserer theoretischen Begriffe. Die 4 Schritte Theoriebildung, Erzeugung der Brillen für die Beobach-tung, Beobachtungsvorgang mit der Brille und Interpretation der Ergebnisse durch die Brille der Theorie bedingen einen selbst-immunisierenden Zirkulärvorgang.
Daraus ergibt sich das Problem der Relativität der physikalisch erkannten Welten, das natürlich sehr wohl bereits erkannt wurde. "Der Auffassung, dass es eine Basismenge von Fakten gibt, die unabhängig von theoretischen Annahmen existieren und die darauf warten, in einer begrifflich kohärenten Form systematisiert zu werden, steht der Einwand gegenüber, dass eine hypothesenfreie Tatsachensammlung nicht möglich ist, dass schon die Bedeutung der charakterisierenden Ausdrücke kontextabhängig und damit nicht frei von theoretischen Annahmen ist. (...) Folgt daraus nun, dass jeweils nur eine fest gewählte Theorie ihren Objektbereich spezialisieren kann, dass mit der Wahl eines neuen Blickpunktes auch andere Teile der Realität in das Gesichtsfeld treten derart, dass ein Vergleich zwischen mehreren Theorien gar nicht möglich ist, da sie über Verschiedenes reden? Ist mit der hypothesenabhängigen Statuierung der Faktenmenge auch der Verzicht auf eine objektive Wiedergabe der Strukturen des Realitätsbereiches angesprochen? Wenn das der Fall ist, wäre es überhaupt unmöglich von äquivalenten oder von konkurrierenden kosmologischen Theorien zu sprechen, d. h. solchen, die über einen Bereich isomorphe Strukturbehauptungen aufstellen und damit auch dieselbe prognostische Relevanz besitzen, bzw. solchen, die unvereinbare Aussagen machen, wie etwa die Relativitätstheorie und die Steady State Theorie über die Verteilung von Galaxien und Quasaren. Anstatt eines Universums, das mit verschiedenen Theorieansätzen angegangen wird, hätte man einen theorieabhängigen epistemischen Zerfall der Welt in so viele unvergleichbare Objekte vor sich, wie es kosmologische Theorien gibt" (Ka 91, S. 404 f.).
Gerade dies ist unsere Behauptung. Die über die jeweiligen Theorien erzeugten beobachteten Fakten in Verbindung mit dem konstitutiven Begriffsvolumen der Theorie schaffen eine Welt, die zu den Welten der anderen Theorien in gewisser Hinsicht inkompatibel sind. Hinzu kommt nach unserem Dafürhalten, dass die verschiedenen Welten, die hierdurch entstehen, sich auch noch durch die Art der Erkenntnisschulen (1) bis (4) unterscheiden, in welche die Theorien einzuordnen sind. Es entstehen daher qualitativ unterschiedlich konstituierte Welten, bezogen auf die erkenntnistheoretischen Begrenzungen, welche die jeweilige Theorie besitzt. Aber auch die obigen Sätze Kanitschneiders sind selbst bereits, ohne dass er es explizit beachtet, jenseits und über allen geschilderten Welten angesiedelt, welche die Physik erzeugt. Sie befinden sich auf einer reflexiven Metaebene, die offensichtlich gegenüber den einzelnen kosmologischen Theorien als invariant, von Raum und Zeit unabhängig und wohl auch universell gelten soll. Wie ist diese Ebene legitimierbar? Offensichtlich sind wir in der Lage, über alle derart limitierten Weltbilder hinaus und sie alle gleichzeitig zu denken, mit Begriffen, die nicht einer der Theorien angehören.
Kanitschneider fährt fort: "Die tatsächliche Verfahrensweise der Kosmologie legt nicht diesen Relativismus nahe, sondern ist in Einklang damit, daß alle Modelle, die aufgrund verschiedener Theorien entworfen werden, trotz ihrer unterschiedlichen Behauptungen einen gemeinsamen Referenten intendieren. Das ergeben auch allgemeine semantische Untersuchungen. Dudley Shapere konnte durch eine Analyse der Verwendung von Existenzaussagen in der Physik zeigen, daß man durchaus von einer transtheoretischen Referenz der Terme sprechen kann, wonach also der semantische Bezug theoretischer Begriffe auch im Rahmen von verschiedenen Theorien aufrechterhalten werden kann. Die radikale Bedeutungsverschiebungshypothese ist danach weit überzogen. Nicht die Bedeutung der Ausdrücke, sondern das Wissen über die Referenten verändert sich. Beobachtungen besitzen eine relative Autonomie gegenüber den Theorien, für die sie bestätigende Instanzen darstellen, und wahren ihre Relevanz, ihre Kooperationsfähigkeit für verschiedene Theorien, auch wenn ihr Entstehen wiederum durch Hintergrundannahmen geleitet ist. Eine solche Position impliziert keinen naiven Realismus in der Kosmologie, wonach es eine unmittelbare Erfassung von Eigenschaften auf einer 'Ding an sich'-Ebene gäbe, sondern sie behauptet, daß die Kosmologie in Einklang mit einem kritischen Realismus steht, der mit Rücksicht auf die komplizierte Verflechtung von der semantischen Darstellungsfunktion und der methodologischen Rolle der Prüfung an der objektiven – vom Subjekt des Forschers und seiner sprachlichen Hilfsmittel unabhängigen – Existenz des Untersuchungsgegenstandes festhält."[1]
Kritik: Eine transtheoretische Referenz der Terme wird zwar stillschweigend vorausgesetzt, wie wir für die Sätze Kanitschneiders selbst oben bemerkten. Diese transtheoretische Referenz impliziert eine Unabhängigkeit der Terme von den Einzeltheorien selbst, damit aber von der Summe aller Kosmologien, die überhaupt möglich sind. Ihre Universalität und Unabhängigkeit von Raum und Zeit, sowie von Evolutionsstufen des Bewusstseins, wird zwar auch hier wieder postuliert, ist aber nirgends legitimiert. Wie können transtheoretische Terme jenseits aller physikalischer Universen postuliert und legitimiert werden? Gehören Teile unseres Bewusstseins nicht den unendlich vielen konzipierbaren Universen an? Wo sind diese Terme und die Gedanken, mit denen sie entworfen werden?
Die unmittelbare Erfassung von Eigenschaften auf einer 'Ding an sich'-Ebene wird zwar von Kanitschneider angeblich ausgeschlossen, die Annahme einer 'objektiven – vom Subjekt des Forschers und seiner sprachlichen Hilfsmittel unabhängigen – Existenz des Untersuchungsgegenstandes' führt aber wiederum zur Hypothese des 'Dinges an sich' zurück, denn die Annahme der objektiven Existenz des Untersuchungsgegenstandes erschließt uns keinerlei Möglichkeiten, uns diesem zu nähern. Wir haben es immer mit von diesem "Ding" mitbegründeten Sinneseindrücken E unseres Körpers zu tun, die wir mit Phantasie D(1) und D(2) und eben mit unterschiedlichsten Begriffsapparaten ausschließlich als innersubjektive (intersubjektive, kommunikative) Bewusstseinskonstrukte erzeugen. Die obigen Annahmen besitzen daher eine bestimmte Naivität. Der "illusionistische" Charakter der von uns erzeugten Weltbilder bleibt auf den erkenntnistheoretischen Ebenen der Theorien der modernen Physik erhalten.
Die Quantenphysik hat bekanntlich eine Mehrzahl theoretischer Interpretationen erfahren (Zeilinger, S. 145 ff.), die hier wegen des hohen spekulativen Anteils in der modernen Physik erwähnt seien: Viele-Welten-Interpretation, Quantenpotential, Varianten der Reichweite der Superposition, Kopenhagener Interpretation. Schon zwischen diesen besteht trotz bestimmter gleicher Ausgangsbedingungen keine inhaltliche Kompatibilität.
Kann die moderne Physik aus diesem Korsett unserer Relativitätstheorie der Naturerkenntnis, aus diesem Käfigen der Illusion (z.B. RT, QT, STT, VT) ausbrechen, oder müssen wir uns mit jenen Begrenzungen begnügen, in die uns die Physiker selbst in einer Art Bescheidenheit einweisen. Die Grundlagen einer nicht relativen sondern absoluten Naturerkenntnis kann nur dann gefunden werden, wenn es absolute und unendliche Essentialität (als absolutes Sein) gibt, und dieses auch dem Menschen erkenntnistheoretisch begrifflich zugänglich ist. Dass dies grundsätzlich möglich ist, wird hier darzustellen versucht. Was geschieht mit den bisherigen physikalischen Theorien, wenn sie in diesen unendlichen und absoluten Zusammenhang aufgenommen werden? Sie werden nicht annulliert, sondern erhalten ihren beschränkten und teilweise mangelhaften Platz in einem anderen Konnex. Ihre eigene Weiterbildung ist durch den Vergleich mit den absolut-unendlichen Grundlagen der Wesenlehre vorgezeichnet. Auch hier erfolgt nur die Anregung zur eigenen Prüfung!
Die Begriffe der modernen Physik sind im Rahmen einer gründlichen Analyse der bisherigen Erkenntnistheorien zu untersuchen. Es zeigt sich nämlich, dass die Qualität und Reichweite der Begriffe der modernen Physik sehr stark durch den Umstand geprägt werden, inwieweit der Theoretiker, wie Einstein oder Hawking usw. alle erkenntnistheoretischen Voraussetzungen reflexiv mitberücksichtigen,
a) die wir alle, daher auch der theoretische Physiker (TP) für den Aufbau der "wirklichen" Außenwelt benützen;
b) welche gegeben sind, wenn ein TP mit Experimenten physikalische Beobachtungen unternimmt.
Zweierlei wird zu zeigen sein. Hinsichtlich der Voraussetzungen zu a) zeigt sich, dass TP häufig nicht gründlich genug reflektieren, inwieweit wir alle und auch sie selbst, wenn sie sich in die Gerüste ihrer Theoriestruktur begeben, unweigerlich zusätzliche Begriffsapparate stillschweigend mit hineinschleppen und damit voraussetzen, die aber nicht sichtbar bleiben, und damit zu einem mutwilligen, teils phantastischen Ausufern der Theoriegebilde führen.
Bei den Theoriebildungen unter b) den physikalischen Theorien im engeren Sinne wird ebenfalls durch zu naive Auffassungen über die Voraussetzungen der Theoriebildung unbedacht gelassen, dass die von TP selbst geschaffenen Begriffe der Theorie eine Art Brille sind. Der Schliff der Brille bedingt, dass er nur Beobachtungen machen kann, die bereits durch den Schliff der Begriffsbrille konstitutiv vorgeformt sind. Er verformt (präformiert) daher bereits durch den Schliff der Brille den gesamten Beobachtungsvorgang und kann daher immer nur Ergebnisse erhalten, die er bis zu einem bestimmten Grad aber unweigerlich bereits durch seine Begriffsbrille selbst gestaltet, konstruiert hat. Mit einer anderen Begriffsbrille verliefe der gesamte Beobachtungsvorgang anders und der TP erhielte andere Ergebnisse und damit eine andere Wirklichkeit (Weltbild) oder Natur. So selbstverständlich es scheinen mag: Keiner der prominenten TP hat in der letzten Zeit diese Relativität explizit auf seine eigenen Theorien angewendet. Noch viel weniger wurde natürlich danach gefragt, ob diese begrenzten Erkenntnisgefängnisse, in denen sich die TP mit ihren Modellen bewegen, für das menschliche Bewusstsein und damit für die Welterkenntnis tatsächlich die letzten Grenzen darstellen.
Zu zeigen wird auch sein, dass in den Theorien unter b) eine Fülle von Begriffsinventaren weiterhin vorausgesetzt werden, ohne dass diese vom TP ausdrücklich beachtet und berücksichtigt würde. Seine Theorien unter b) sind daher in ihren Voraussetzungen weiterhin in die Begriffsapparate a) eingebettet und werden auch durch diese bestimmt.
Schließlich wird die systematische Erfassung aller derzeitigen Typen von Erkenntnisschulen, die sich nach der Art und dem Ausmaß der Grenzziehung für das menschliche Erkenntnisvermögen unterschieden, zeigen, dass der derzeitige Streit zwischen Philosophie und Naturwissenschaft zum Teil naiv geführt wird. Wenn Vertreter einer "weiteren" Erkenntnisschule mit einem einer "engeren" kommuniziert, kann es zu einer Einigung nicht kommen, weil durch die Brillen der jeweiligen Grenzen eigentlich der eine rot sieht und der andere grün. Beide glauben aber, dass sie farblos denken.
Die LeserInnen werden vielleicht schon merken, wie wichtig es für unseren Problemkreis ist, die menschlichen Erkenntnisfähigkeiten genau zu analysieren. Das heißt aber eigentlich nichts anderes, als sich die gesamte Geschichte der Philosophie auf diesem Planeten vor Augen zu führen und zu sehen, welch unterschiedliche Antworten auf diese Frage bisher gegeben wurden. Wie weit oder wie eng wurden da die Grenzen gezogen? Wie haben sich trotz Änderung der Wortkleider der Theorien die Grundfragen erhalten? Hier können und wollen wir diese Entwicklung nicht darstellen. Wohl aber möchten wir nicht verhehlen, dass wir in den folgenden Ausführungen über die Fähigkeiten der Menschlichen Erkenntnis für die Zukunft richtungsweisende neue Gedanken vorbringen, die eigentlich alle bisherigen Erkenntnistheorien der Geschichte vervollständigen und eine neue Grundlage der Logik und Mathematik enthalten. Die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit sind anders zu ziehen, als dies bisher geschah. Es fallen bestimmte Mauern, Fesseln werden gelöst, ohne dass die bisherigen Erkenntnistheorien negiert oder bekämpft werden. Sie bilden teilirrige, zu enge oder einseitige Sonderfälle. [Alle Erkenntnisschulen (1), (2) usw. sind in/unter der Erkenntnisschule (5) enthalten.]
Die folgenden Ausführungen werden sicher manchem Leser ungewohnt sein. Mögen sie wenigstens dazu beitragen, ihm sichtbar zu machen, um welche Probleme es eigentlich geht, wenn man beginnt, die Erkenntnis des menschlichen Erkenntnisvermögens und der Erkenntnisoperationen zu untersuchen.
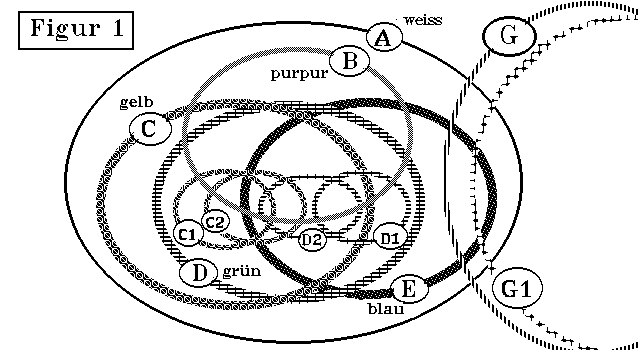
Wir benützen die FIGUR 1. Ein Mensch erkennt die Welt außer sich, Natur G (Landschaft, Bäume usw.) und die Gesellschaft G(1) um sich, also z. B. seine Familie, die deutsche Sprache, die Zeilen, die er hier liest. Eine Außenwelt, Natur G und eine Gesellschaft G(1), erkennen wir nicht unmittelbar. Zugänglich sind uns von ihr nur Zustände unserer Sinnesorgane des Körpers E (blau) – vgl. unter 1.2.1 –, die wir hereinnehmen in die Phantasie D (grün). Durch die nachbildende äußere Phantasie D(1) und die schöpferische, innere Phantasie D(2) und mit Begriffen C (gelb), die wir teilweise bereits bei der Geburt in unserem "Bewusstsein" besitzen (C1), teils aus dem Gesellschaftssystem G(1) übernehmen, in welches wir hineingeboren werden C(2), bilden, konstruieren und konstituieren wir eine in der Person, im Subjekt, in uns bestehende (subjektimmanente) Erkenntnis der "Außenwelt". Für jeden Ungewohnten erscheint es ein wenig kühn, wenn er hört: "Ich weiß gar nicht, wie die 'Außenwelt' aussieht, denn was ich von ihr weiß, ist nichts als ein Bild, ein Konstrukt, das ich mir davon mache. Ich sehe nur, was in meinen Augennerven ist, aber nicht die Abendsonne, die ein Blatt durchleuchtet."
Nur das Angewirktsein der Sinne durch die "Außenwelt" kommt von außen, alle übrigen Tätigkeiten sind aktive, erzeugende Handlungen im Bewusstsein des Menschen. Die genaue Unterscheidung von D(1) und D(2) ist dabei ebenso wichtig wie die Unterscheidung der Begriffe, die schon bei Geburt gegeben sind, von jenen, die über die Gesellschaft und deren Sprache im Rahmen der Sozialisation erworben werden. Da jeder in einer sozialen Umwelt geboren wird, die durch die Faktoren der Gesellschaft (wie z. B. Sprache, Kultur, Wirtschaft, Politik, Schichtung) bestimmt ist, tritt eine Einwirkung aller dieser Faktoren auf E, D und C ein, die zu einer Kanalisierung und Regulierung, entsprechend den Färbungen der Gesellschaft, führt.
Die Probleme der Erkenntnis der Außenwelt über die Sinne wollen wir jetzt ausführlicher behandeln.
Für die Kenntnis der Welt um uns brauchen wir einen Leib. Der Zustand der Sinnesorgane, also der "Stempel", den das Außen auf ihnen erzeugt, ist alles, was von außen ist. Ein Blinder erhält auf der Netzhaut keine "Spuren". Er lebt daher in einer "anderen" Welt. Wir zitieren im folgenden, oft leicht verändert, aus den erkenntnistheoretischen Schriften KRAUSEs. Von diesen Zuständen in den Sinnen behaupten wir, sie seien Wirkungen äußerer, "wirklicher" Gegenstände, die in Raum und Zeit sind, die mit unserem Leib, also mit Augen, Nase, Ohren, Haut usw., in einer Wechselwirkung stehen, wobei aber diese Sinnesorgane bei der Erzeugung dieser Empfindungen selbst auch aktiv mitwirken. Wir behaupten dann auch gleich – eigentlich sehr kühn –, dass einerseits diese Gegenstände auch unabhängig davon, dass sie in unseren Sinnen Wirkungen erzeugen, existieren und dass sie andererseits unabhängig von unserer Sinnlichkeit und unserer Fähigkeit und Möglichkeit, sie wahrzunehmen, gegeben sind. Allgemeine Bedingungen für die Sinneswahrnehmung sind:1. Ein organischer Leib, seine Sinnesorgane, das Nervensystem, durch welches alle Sinnesorgane unter sich mit dem gesamten Nervensystem und mit dem ganzen Leib in Verbindung stehen (Koordinierungs– und Integrierfunktion des Nervensystems und des Hirns). Einzelne Sinne können manchen Menschen fehlen, kein einziger aber allen. Die "Welt" würde sich schlagartig ändern, wenn alle Menschen plötzlich taub wären. 2. Dasein und Wirksamkeit der unseren Leib umgebenden Sinnenwelt, wobei wir auch noch annehmen können, dass die "Naturprozesse", die in unserem Körper ablaufen, wenn wir die Natur erkennen, zu den "Naturprozessen außerhalb unser" in einem bestimmten Verhältnis stehen.3. Schließlich müssen wir uns den Sinneseindrücken hingeben, hinmerken, darauf acht geben. Jeder Sinn stellt ihm Eigentümliches dar. Die Bestimmung der Größe und des Grades der Anwirkung ist für die Wahrnehmung wichtig.
Hauptsitz im Organ der Haut, besonders Zunge und Fingerspitzen. Jeder Nerv aber ist Teil des Tastsinns. Der Tastsinn ist der allgemeinste Sinn, der sich auf die allgemeinsten Eigenschaften der Körper, auf den Zusammenhalt in festem und flüssigem Zustand nach Wärme und Kälte bezieht. Die Anwirkungen halten in ihm am relativ längsten an, er ist aber der beschränkteste Sinn, denn man muss ja "den Gegenstand" selbst berühren. Man nimmt auch im Verhältnis zu anderen Sinnen mit dem Tastsinn die kleinste Mannigfaltigkeit wahr. Wir nehmen im Tastsinn nur Zusammenhaltbestimmtheiten des Tastnervs selbst wahr, mögen sie nun mechanisch oder durch Erwärmung und Erkältung erfolgen, wobei sich eine große Mannigfaltigkeit einzelner besonderer Empfindungen ergibt. Fast jede dieser weiteren Bestimmtheiten des Tastgefühls zeigt durch das Gefühl von Lust und Unlust eine wesentliche Beziehung zum Leib. In diesem Sinne gibt es einen weiten Bereich von Gradverschiedenheiten, wodurch dieser Sinn zur Orientierung in der äußeren Sinnenwelt und zur Untersuchung der Organe des eigenen Körpers hinsichtlich der Kohäsion besonders geeignet ist. Mittelbar aber schließen wir von den unmittelbar wahrgenommenen Kohäsionsbestimmtheiten unserer Nerven auch auf Gestalt, Ort, Stelle und Bewegung desjenigen Stoffes, welcher die wahrgenommenen Kohäsionsbestimmtheiten unseres Nervs innerhalb der Wechselwirkung dieses Gegenstandes mit allem ihn umgebenden Leiblichen verursacht. Dies erreichen wir aber nur durch Schlüsse. Bei dieser Auslegung des Tastgefühls dienen uns als Grundlage bestimmte, nichtsinnliche Begriffe, Urteile und Schlüsse (C in FIGUR 1), die wegen der Allgemeinheit und Allgemeingültigkeit, die wir ihnen beimessen, nicht aus der Sinneswahrnehmung entsprungen sein können.
Solche Begriffe sind etwa: Das Gefühl im Tastsinn ist weder lang, noch breit, noch tief, ist gar kein Stoff. Daher müssen wir diesen Gedanken schon unabhängig von dieser Empfindung des Tastgefühles haben, wenn wir behaupten, einen Stoff wahrzunehmen.
Wir benötigen daher eine sehr allgemeine Vorstellung (Kategorie, Begriff ) von RAUM I, damit wir überhaupt das Gewirr der Eindrücke auf der Haut als etwas außer uns erfassen können. Die Raum-Vorstellung konstruiert erst aus dem Wirrwarr ein geordnetes Gerüst.
Probleme in der Physik: Wie wir später sehen werden, bereiten die klassischen Vorstellungen von Raum und Zeit (a priori Kategorien bei Kant, Raum- und Zeitvorstellungen in der Physik Newtons usw.) weiterhin große theoretische Schwierigkeiten. Die Raum-Zeit Theorien Einsteins in seinen beiden Theorien aber vor allem die Probleme der beiden Begriffe in der Quantenphysik geben zu denken.
Bereits hier sei aber auf eine äußerst wichtige Tatsache hingewiesen, die gerne nicht so sorgfältig herausgearbeitet wird. Die Ort-Impulsbeziehung beim Doppelspaltexperiment nach Niels Bohr[2] enthält auch nach den präzisen Ausführungen (Ze 03) das Problem, dass wir für die Beobachtung einen nach der klassischen Physik gebauten (und daher mit traditionellen Raum-Zeitbegriffen konstruierten und auch von uns erkannten, Apparat bauen mit dem wir im Sinne der klassischen Physik übliche Beobachtungen machen, die daher auch schon durch unsere hierbei benützten Begriffe und die gesamte Intention des klassisch ausgelegten Versuches konstitutiv durch "Brillen" der klassischen Physik konstruiert werden.
Zeilinger sagt daher richtig: "Wovon wir weiter noch sprechen können, sind die Elemente des experimentellen Aufbaus, so etwa die Linse, sowie der Ort, an dem sich diese Linse befindet, sicherlich auch noch die Quelle, mit der wir unsere Elektronen erzeugen, die Lichtquelle, aus der das Photon kommt, das am Elektron gestreut wird, und die für den gesamten Aufbau benötigten Teile des notwendigerweise klassischen Apparates, die das Ganze zusammenhalten. Genaugenommen können wir nur über diese klassischen Objekt sprechen. Alles andere sind unsere mentalen Kostruktionen. (...) Es läuft alles darauf hinaus, dass der Zustand, den die Quantenphysik den Systemen dann zuordnet – wie z.B. die Superposition des Photons in allen diesen Möglichkeiten – zu nichts anderem dient, als eine Verbindung zwischen klassischen Beobachtungen herzustellen."(Ze 03, S.169).
"Die Komplementarität ist letztlich eine Konsequenz der Tatsache, dass zur Beobachtung der beiden Größen, in unserem Fall Ort und Impuls, makroskopische klassischer Apparate notwendig sind, die einander ausschließen" (S. 170). Wir würden sagen: die zwei unterschiedliche Brillen sind, welche bereits die Beobachtung konstitutiv prägen. Ähnlich auch: "Die Komplementarität ist in diesem Falle wieder die Konsequenz der Unmöglichkeit eines gleichzeitigen Aufbaus zweier verschiedener makroskopischer Apparate" (S. 171)
Gedankenexperiment: Wie müsste eine Beobachtungsapparatur aussehen, die nicht in klassischen Kategorien und Begriffen aufgebaut ist und andere als klassische Begriffe von Raum und Zeit benützt, die also nur Begriffe der Quantentheorien selbst benützt und nur "Objekte" baut, die diesen Theorien entsprechen[3]?
Ergebnis: Die offensichtlich zwangsweise inhaltliche Verknüpfung der von klassischen Begriffsstrukturen konstitutiv miterzeugten Beobachtungen mit quantentheoretischen Ergebnissen ist ein Problem, das man u.U. wohl nur dadurch lösen könnte, dass wir als Menschen uns von den "Illusionen" der "klassischen Welt", aus ihrem Traum lösen und nur mehr in den Begriffen der Quantenmechanik denken, unsere Welt erzeugen und verändern und unsere Beobachtungsapparaturen in ihr entwerfen usw.[4]
An dieser Stelle halten wir lediglich fest, dass wir weder die "objektive Sachgültigkeit" der Raum-Zeit-Aprioris Kants noch jene der klassischen Physik Newtons verteidigen. Im weiteren werden wir eine Begründung dieser Begriffe als Vernunftkategorien in der unendlichen und unbedingten göttliche Essentialität versuchen.
Es ist aber schon hier wichtig, zu zeigen, wie sehr wir offensichtlich weiterhin gezwungen sind, die "üblichen" sicher eher verschwommenen und umstrittenen Raum-Zeit-Begriffe für die einfachsten Erkenntnisse in der Umwelt einzusetzen.
Ferner bringen wir den Gedanken der Bewegung hinzu, denn auch dieser liegt nicht in dem einfachen Gefühl. Bewegung können wir nicht anschauen ohne Zeit, weil Bewegung Änderung ist. Folglich bringen wir auch den Gedanken der Zeit hinzu.
Wir benötigen daher eine sehr allgemeine Vorstellung (Kategorie, Begriff ) von ZEIT I, damit wir überhaupt das Gewirr der Eindrücke auf der Haut als etwas außer uns erfassen können. Die Raum-Vorstellung konstruiert erst aus dem Wirrwarr ein geordnetes Gerüst.
Nun beobachten wir aber, dass wir uns mittels dieser Gedanken des Räumlichen und Zeitlichen in unserer Phantasie dasjenige vorstellen, woran wir diese Empfindung als seiend denken und wodurch wir sie uns als verursacht vorstellen. Dies wird recht offenbar, wenn man sich einen Blinden denkt oder wenn man sich selbst denkt, wie man sich an finsteren Orten durch das Gefühl weiterhilft. Da kann man weder seinen Leib noch das Äußere sehen. Trotzdem wird das bestimmte einfache Tastgefühl Anlass dazu, dass sich der Blinde, der geblendet Sehende oder der Mensch im Finsteren innerlich in Phantasie (D in FIGUR 1) ein Bild vom Äußeren entwirft, das ihn umgibt. Nun beinhaltet aber das, was der Blinde, der Geblendete oder der Mensch in Dunkelheit mit tastenden Händen erspüren, weder Raum noch Stoff, auch erkennen diese gar nicht durch das Gesicht, und dennoch bilden sie diese innere Welt der Phantasie. Sie behaupten, dies geschehe der äußeren Welt entsprechend. Daraus sehen wir, dass das Vorhandensein der Welt der Phantasie (D) und unser freies Schaffen darin auch eine Grundbedingung dafür ist, dass wir die einzelnen Tastgefühle auf Raum und Materie beziehen können.
Aber bei dieser Auslegung des "dumpfen" Tastgefühles sind noch viel höhere Voraussetzungen erforderlich, und es sind dabei viel höhere geistige, kognitive Verrichtungen wirksam als nur die Welt der Phantasie, die wir weiter unten noch ausführlich analysieren werden. Denn wir müssen ganz allgemeine Begriffe, Urteile und Schlüsse (C in FIGUR 1) – z. B. "etwas", "etwas Bestimmtes" – hinzubringen, von welchen die einfache Empfindung des Tastgefühls gar nichts enthält. Hätten wir einen solchen Begriff nicht, so könnten wir gar nicht denken, dass wir etwas fühlen oder etwas durch Gefühl wahrnehmen. Weiterhin benützen wir den Gedanken "Eigenschaft", indem wir die Tastempfindung als Eigenschaft dessen, was wir im Gefühle wahrnehmen, betrachten. Überdies verwenden wir die Begriffe: Ganzes, Teil , Verhältnis, Beziehung, Grund und Ursache. Denn wir denken ja, dass das äußere Objekt und unsere Sinne Grund und Ursache dieser Empfindung sind. Wir benützen aber auch Urteile und Schlüsse. Zum Beispiel: "Hier ist etwas, ein Objekt; hier ist eine Wirkung; hier ist eine Empfindung." Demnach muss die Empfindung, wie alles Bestimmte, eine Ursache haben. Da ich selbst nicht die Ursache bin, folglich muss etwas anderes da sein, was Ursache der Empfindung ist. Hier ist eine Eigenschaft, also muss etwas sein, woran die Eigenschaft gebunden ist, etwas im Raum Selbständiges, das auch in der Ausdehnung über längere Zeit anhält.
Diese Begriffe, Urteile und Schlüsse sind uns bei der Auslegung des Sinnes in unserem gewöhnlichen Bewusstsein so geläufig, wir wenden sie mit so großer Kunstfertigkeit an, dass wir uns derselben nur selten bewusst werden. Durch diesen Umstand des Nichtbewusstwerdens dieser Voraussetzungen lassen sich viele verleiten zu behaupten, die Anerkenntnis der äußeren Gegenstände mittels der Sinne sei unmittelbar, und zwar geschehe sie auf eine uns unbegreifliche Weise. Aber wer auf sich selbst hinmerkt, der findet, dass es so geschieht, wie wir hier feststellten. Und wir dürfen unser gebildetes Bewusstsein, das sich bereits eine kunstfertige Beherrschung unseres Leibes erworben hat, nicht mit dem Zustande des Kindes verwechseln, welches sich erst jene Fähigkeit nach und nach erwerben muss. Bei dieser geistigen Arbeit können wir auch die Kinder beobachten. Es geht uns in unserem reifen Bewusstsein mit der Auslegung der Sinne so wie einem Weber oder Orgelspieler. Wir bringen die kognitive Tätigkeit und die Tätigkeit unserer Phantasie, während wir sie durchführen, nicht ins Bewusstsein, weil wir sie schon beherrschen. Wie sich auch der Orgelspieler dessen nicht bewusst wird, wie er die Noten sehen, verstehen und durch ganz bestimmte geistige Tätigkeit seine Finger und Füße bewegen muss. Wenn aber der Orgelspieler oder der Weber sich an die Zeit erinnert, wo er die Kunst erst erlernte, so wird er sich auch erinnern, wie er sich anfänglich jeder dieser Tätigkeiten bewusst werden musste, wie er alles einzelne einzeln einüben musste, um endlich zur Kunstfertigkeit zu gelangen. Ein solches aber noch viel höherartiges Instrument als die Orgel dem Orgelspieler ist jedem Bewusstsein (jeder "kognitiven Instanz") der Leib. Erst nach und nach werden wir des Leibes mächtig, erst nach und nach lernt der Mensch die Sinne verstehen und seinen Leib zu gebrauchen.
Wir können uns z. B. in einem finsteren Keller beim Tasten im Dunkeln täuschen. Was täuscht sich da? Die Wirkung auf den Tastsinn ist wie immer. Aber wir legen diese Eindrücke falsch aus, wir machen uns "falsche Bilder" von dem, was wir da tasten, und wir schließen falsch auf das, was da "draußen" ist. Wir können uns auch z. B. bei Helligkeit täuschen, wenn wir sitzen und plötzlich einen Druck am Fuß verspüren. Wir wissen dann nicht, ob wir angestoßen werden oder ob es ein Gegenstand ist, den jemand an den Fuß gebracht hat. Hier sei auch erwähnt, dass man natürlich einwenden könnte, die Gedanken, Begriffe usw., die hier zur Auslegung der Sinne benützt werden, hätten wir nicht ursprünglich, sondern Begriffe, Urteile und Schlüsse (also C in FIGUR 1) lernten wir erst durch eine Sprache in einem Gesellschaftssystem. Zum einen legt aber das Kind, wie wir sehen, die Sinne schon aus, bevor es sprechen lernt. Ja das Erlernen einer Sprache ist selbst ein Vorgang der Auslegung der Sinne mittels Begriffen, Urteilen usw. – also mittels "kognitiver Strukturen". Das Kind legt hierbei Sinneseindrücke (Laute und Zeichen) so aus, dass es darin Elemente und Zeichen erkennt, die über die sinnliche Dimension hinaus etwas anderes bedeuten (Erkennung der Bedeutungsdimension von Zeichen). Ein Kind hat also schon C-Begriffe bevor es C(s) -Begriffe, C(s) -Urteile einer Sprache lernt. Eben weil das Perlhuhn das nicht kann, obwohl es auch Sinne hat, kann es unsere Sprachen nicht erlernen.
Wir müssen weiterhin unseren aktiven Einsatz des Tastsinnes beachten. Wir liegen nicht irgendwo und lassen die "Dinge auf uns einwirken", sondern wir bewegen ja unseren Körper, um seine Tastempfindungen gezielt, intentional auf etwas Hartes, auf eine Gegenwirkung hin, eben auf einen "Gegenstand" zu richten, etwas abzutasten. Wir veranlassen unseren Körper zu Bewegungen. Auch hier spüren wir in den Tastnerven das Heben des Armes, die Bewegung des Fußes, und wir spüren das Anstoßen, die "Eigenschaften" des Körpers. Wir steuern auch Richtung und Stärke der Bewegung, z. B. des Tastens. Wir können durch diesen aktiven Einsatz des Tastsinnes unseren eigenen Körper mit Zunge, Händen und Füßen in absichtlicher Beobachtung kennen lernen. Wir werden uns damit der Teile unseres Körpers und seiner Gestalt in gleicher Weise wie der "Gegenstände" außerhalb des Leibes bewusst.
Der Geschmacks- wie auch der Geruchssinn kommen dem Tastsinn insofern nahe, als auch bei ihnen stoffliche Berührung nötig ist. Die Angewirktheit, der "Stempel", der hier in den beiden Sinnen wahrgenommen wird, ist die Bestimmtheit des chemisch-organischen Stoffes im Sinnesorgan selbst. Die Empfindung des Schmeckens enthält eine große Mannigfaltigkeit, mit starken Tendenzen einer begleitenden Lust- oder Unlustempfindung (Ekel beim Essen bestimmter Stoffe; Verfeinerung und Differenzierung der Geschmacks"kultur"). Wir nehmen schmeckend nur die chemische Tätigkeitsstimmung unseres Organs, der Zunge, wahr, keineswegs aber einen äußeren Gegenstand selbst noch dessen chemische Beschaffenheit. Aber wir übertragen das Wahrgenommene nach den gleichen Voraussetzungen wie unter 1.2.1.1.1 auf die Außenwelt. Auch hier benützen wir zur Erzeugung der sinnlichen Erkenntnis Phantasie D und begriffliche Operationen C und C(s).
Gedankenmodell: Jemand muss etwas mit verbundenen Augen essen und feststellen, was es ist; oder wir stellen uns vor, wie ein Rindsbraten mit Kartoffelsalat schmeckt. Ein Österreicher kann sich aber in der Regel nicht vorstellen, wie Imam Bayildi schmeckt.
Der Geruchssinn ist bereits freier als der Geschmacks– und Tastsinn. Man kann auch von fern Gerüche wahrnehmen. Auch der Tastsinn ist fein und mannigfaltig, womit neue Schlüsse auf die Beschaffenheit von Körpern oder Erscheinungen in der Natur möglich sind (z. B. bei einem Rasenbrand oder Ölteppich auf dem Meer). Erinnert sei hier an den Versuch, in Filmen eine Geruchsdimension zu integrieren.
Er ist unter allen Sinnen der freieste, von Lust und Unlust des Körpers unabhängigste, das Organ des Auges selbst ist rasch und vielseitiger orientierbar. Unmittelbar sehen wir keine Welt außerhalb unser, sondern nur auf der Fläche des Auges Bestimmtheiten des Lichts an Helle und Farbe. (Auch dies sind schon sehr abstrakte Konstruktionen mit Begriffen und durch Phantasie.) Aber durch die sprunghaften, ganz oder teilweise scharf begrenzten Umrisse mehr oder weniger durchsichtiger Körper sowie durch die mittels der Schatten und des abgestrahlten Lichtes bestimmten, allmählichen Übergänge der Helligkeit und der Farben begründet das Bild im Auge die weiteren Schlüsse auf die Lichtbestimmtheiten und Beschaffenheiten der Gegenstände und auf deren Gestalt, Ort, Stelle und Bewegung. Bei der Auslegung des Bildes im Auge kommt der bereits ausgelegte und richtig verstandene Tastsinn dem Bewusstsein erheblich zu Hilfe (integrative Koordinierung der Auslegungsergebnisse aller Sinne in den kognitiven Leistungen des Bewusstseins). Dass es aber nur unser erleuchtetes, farbig bestimmtes Auge, eigentlich eine "physio-chemische Reaktion", ist, was wir äußerlich sinnlich sehen, wahrnehmen und unter Anwendung nichtsinnlicher Voraussetzungen C und mit Hilfe von Phantasie D auslegen, zeigt uns folgende Tatsache: Vernichtung und Krankheit des Organs vernichtet oder verändert das Sehen; sind die Augen verbunden, sehen wir nichts. Folgende Erscheinungen können als weitere Denkanstöße für diese komplizierten Zusammenhänge dienen: Jedes Auge gibt ein besonderes Bild; solange wir nicht ein Auge schließen, koordinieren wir die beiden Bilder zu einem Doppelbild; Schwindel bei Aufsetzen einer schlechten Brille; Farbenblindheit; bei Stoßen oder Drücken des Auges auftretende Lichterscheinungen; optische Täuschungen; Zusammensehen schnell bewegter Bilder im Film; perspektivische Verzerrung in die Ferne hin; Benützung dieser Eigenschaften in der Zentralperspektive der Malerei; Verzerrung durch Gläser; Benützung von Brillen bei Sehfehlern oder Sehschwäche; Teleskope; Mikroskope; Reproduzierung des Sehvorganges in Fotografie, Film, Video, wo wiederum nur Sinnesdaten des Auges ausgelegt werden.
Hier ein wichtiger Einschub über die Grenzen der Beobachtbarkeit der Natur in der Naturwissenschaft: Werden Mikroerscheinungen in der Natur mit Licht beobachtet, wird durch die Wirkung des Lichtes des Beobachtungsvorganges der beobachtete Bereich verändert: Der Vorgang der Beobachtung selbst verändert das zu Beobachtende, das Beobachtete "verschwindet" in eine neue Konstellation. Beachten wir aber weiter. Wir sehen ja nicht diesen Mikrobereich, wie er wirklich ist, wir machen uns ja nur aus Zuständen in den Augen E mit Phantasiebildern D und Begriffen, z. B. der wissenschaftlichen Theorie C(T), ein inneres Bild von der Sache. Nun die entscheidende Überlegung: Nicht nur durch die Lichtstrahlen, die wir auf das Beobachtungsobjekt lenken, wird verändert, was wir beobachten, sondern auch durch eine Veränderung in den Begriffen C(T) und in den Phantasiebildern D wird unsere Beobachtung, das Beobachtungsergebnis verändert. Es "verschwindet" das eine Bildergebnis, und es ergibt sich ein anderes. Hinzu kommt: Wir können das Bild, das wir uns in der Beobachtung gemacht haben, niemals mit der Wirklichkeit außerhalb unser vergleichen, wir können nicht feststellen, ob unser Bild dem entspricht, was außerhalb unser ist, denn wir kommen niemals hinaus zu den Dingen, wir können nur verschiedene Bilder in uns miteinander vergleichen. Es wäre sehr wichtig, allen TP sich diese Überlegungen näher zu bringen.
In den letzten Zeilen haben wir zwei wichtige Grundsätze erwähnt:
· Das Problem der Relativität jeglicher naturwissenschaftlicher Erkenntnis, weil sie von den eingesetzten Begriffen C und den Phantasiebildern D abhängig ist, und
· das Problem, dass wir die Wahrheit naturwissenschaftlicher Erkenntnis überhaupt nicht durch einen Vergleich zwischen unserer Erkenntnis und einer "objektiven" Außenwelt überprüfen können. Beides wird uns weiter unten noch beschäftigen.
Die sensorische Relativität jeder Beobachtung etwa mittels des Lichtes, weil die Sinnesorgane eines jeden Menschen die Eindrücke des Lichtstrahles auf der Netzhaut im Wege zum Gehirn usw. mit anderer Geschwindigkeit verarbeitet.
Um diese Pointe klarer sichtbar zu machen, noch ein Hinweis: "Ich sehe eine Rose", sagt man. Das unmittelbar Wahrgenommene der sinnlichen Erkenntnis ist hierbei lediglich dieses bestimmte flächige Bild im Auge E. Aber sogleich bearbeite ich das Bild weiter, indem ich dasselbe durch Phantasietätigkeit gleichsam plastisch vollende, wobei ich dann auch früher durchgeführte Anschauungen davon erneuere und aktiv mit Phantasie hinzufüge, was ich sonst schon einzeln sinnlich in Erfassung der Rose erkannt habe. Ich besitze sodann eigentlich ein vereintes Bild aus dem reinen Augenbilde und dem Phantasiebilde, wobei ich aber dieses vereinte Bild für das Bild der Rose selbst halte. Ich glaube also, dies alles soeben an der Rose selbst zu erblicken. Ich vermeine, die Farben, die in meinen Augennerven wahrgenommen werden, als an der Rose selbst haftende und als außerhalb meines Leibes an dem Ort, wo die Rose selbst ist, vorhandene wahrzunehmen. Aber auch dabei lässt es das denkende und schauende Bewusstsein nicht bewenden, sondern es trägt dieses Vereinbild, ein plastisch raumzeitliches (RAUM I und ZEIT I) Phantasiebild im Bereiche D(1), in welches es seine reinsinnliche Anschauung aufgenommen hat, dann wieder hinaus in die angeblich äußere Natur.
Indem ich die Rose an einem Rosenstock erblicke, der vor mir in einem Garten steht, trage ich das innerlich vollendete Vereinbild davon auch im Bewusstsein hinaus. Ich projiziere das Bild hinaus, ich sage mir: "Das Bild ist nicht in dir, es ist außer dir im Garten.'" Ich trage es hinüber an diese bestimmte Stelle im Raum und eben dann, wenn der Mensch dies in seinem "vorwissenschaftlichen Bewusstsein" vollbracht hat, meint er, er habe den Gegenstand selbst gesehen und wahrgenommen.
Auch hier ist wieder für den TP viel Wichtiges enthalten. Alle unseren physikalischen Beobachtungen in der "Außenwelt" mit den raffiniertesten Versuchsanordnungen (Teilchenbeschleunigern usw.) sind eigentlich Projektionen von subjektiven Bildern (Konstrukten), die der TP in sich mit Sinneseindrücken, Phantasie und einer Vielzahl von Begriffen aufbaut. Wir gelangen nicht zu den Dingen. Wir schaffen uns die Dinge. Wir schaffen uns jeweils die Dinge, die wird durch die Färbung und den Schliff unserer Begriffe und unsere Phantasie bereits konstruieren, indem wir ein Wirrwarr von Sinneseindrücken ordnen. Wir sagen nicht, dass es die Dinge nicht "unabhängig" von den (inter-) subjektiven Konstrukten unserer Bilder gibt, aber inwieweit unsere Bilder mit den Dingen inhaltlich Ähnlichkeit, "wahren" Abbildchrakter u.ä. besitzen, kann auf dieser Ebene der Betrachtung nicht geklärt werden.
Der Gehörsinn nimmt im Inneren des Ohres die Bestimmtheit der inneren, stofflichen Selbstbewegung (Vibration) des Hörnervs wahr. Auch hier legen wir diese sinnliche Bestimmtheit E mit Phantasie D und Begriffen C aus und machen uns ein Bild von dem, was klingt, lärmt, quietscht usw. Die Schallbewegung enthält in sich mannigfaltige Bestimmtheiten, z. B. Artverschiedenheit der Stimmen, Laute, Höhen und Tiefen, Stärke oder Schwäche; menschliche Musik ist eine aktive Erzeugung sinnlicher Schallqualitäten; beim Bau von Musikinstrumenten benützt man bestimmte Tonsysteme, wo mathematische Relationen maßgeblich sind. Erwähnt seien bestimmte Gesellschaften, in denen Sprache nur als gesprochene, nicht als geschriebene Sprache vorkommt (orale Kultur), also Gesellschaftssysteme, in denen der Gehörsinn stärker aktiviert wird als in Systemen mit Benutzung der Schriftsprache.
Jeder einzelne Sinn ist selbständig und eigentümlich. Aber das wahrnehmende Bewusstsein verbindet in Phantasie D die Wahrnehmungen jedes einzelnen Sinnes mit Hilfe der erwähnten begrifflichen Operationen C in ein Ganzes der Wahrnehmung und bezieht sie alle auf die gleichen einzelnen Gegenstände in der äußeren Natur. Diese integrierende, synthetisierende Koordinierung und Verbindung des Einzelnen zu einem Gesamten ist ein wichtiger kognitiver Akt.
Wir behaupten hier, dass die oben erwähnten Begriffe RAUM I (gelb) und ZEIT I[5] (blau) jedenfalls Begriffe sind, die eine derartige integrierende Funktion besitzen.
Wir stellen uns etwa in
der Physik das Experiment von Hafele und Keating 1970 vor. Aus diesem soll
ableitbar sein, dass es keine absolute Zeit gibt.
Es wurde das Verhalten dreier
Uhren verglichen. Die Forscher umflogen in normalen Verkehrsflugzeugen und
vergleichbaren Flughöhen die Erde einmal in westlicher und einmal in östlicher
Richtung. Es wurden jeweils vier Atomuhren mitgenommen, um die gemessenen
Flugzeiten zu mitteln. Vom Boden aus wurden die Flugzeiten ebenfalls gemessen,
und zwar mit Hilfe der in Washington aufgestellten Atomuhr. Mit Hilfe der
Bodenuhr B haben die Forscher für die beiden Erdumkreisungen Flugzeiten
gemessen, die deutlich unterschiedlich waren zu den Anzeigen der jeweiligen
Borduhren. Der Geschwindigkeitseffekt verlangt, dass sich der Uhrengang bei
rascher bewegten Uhren verlangsamt und damit kürzere Zeiten für den Ablauf von
Ereignissen anzeigt. Die Zeiteinheit wird bei langsamerem Uhrgang quasi
"gedehnt". Am raschesten flogen die Borduhren O während des Ostfluges, am
langsamsten die Borduhren W des Westfluges. Die Bodenuhr B bewegte sich mit
einer dazwischen liegenden Geschwindigkeit. "Insgesamt verlangt die moderne
Physik, dass beim Westflug die mitfliegenden Borduhren W eine um 275
Nanosekunden längere Flugdauer zeigen als die Bodenuhr B. Damit ist die
Übereinstimmung zu den tatsächlich gemessenen 273 nSec unüberbietbar, die
Abweichung ist weniger als ein Prozent. Für den Ostflug ist die Übereinstimmung
weniger gut, die prognostizierten 40 nSec weichen deutlicher von den gemessenen
59 nSec ab". "Die an einer Uhr abgelesene Zeit hängt unzweifelhaft und
unreparierbar davon ab, in welchem Bewegungszustand sich die Uhr befindet und
welcher Schwerkraft die Uhr ausgesetzt ist".
Wenn also erklärt wird,
die drei Uhren gingen unterschiedlich schnell, was mit den Höhe ihrer
Geschwindigkeit und der Schwerkraft zusammenhänge, so denken wir uns aber, indem
wir das GESAMTE EXPERIMENT betrachten, offensichtlich neben diesem relativen
(grünen) Zeitbegriffen (grün1 für die Uhr 1, grün2 für die Uhr 2 und grün3 für
die Uhr 3) , die sich aus der Bewegung der Uhren ergibt, alle diese einzelnen
Uhren mit ihren relativen Zeiten übergreifend, zusammenfassend, oder
universell, zusammen mit allen anderen Uhren und sonstigen
Gegenständen erfasst von dem früher von uns als ZEIT I (blau) bezeichneten
Begriff. Die relativen Zeiten erfassen wir als "in einer allgemeineren Zeit
enthalten". Wäre dies nicht so, dann könnte Einstein oder ein anderer TP
überhaupt keine sinnvolle Aussage über drei Uhren und ihre grünen Zeiten und die
Beziehung, das Verhältnis der drei Zeiten zueinander treffen. Jede theoretische
Formulierung, welche die Zeit als Funktion der Bewegung von Objekten, oder
Subjekten usw. definiert, soll ja für alle Objekte (oder Subjekte), ihre
Relationen und alle möglichen Konstellationen gelten. Diese Allgemeinheit der
Theorie ist aber nur dann sinnvoll, wenn es möglich ist, alle möglichen
Konstellationen aller möglichen relativen grünen Zeiten aller Uhren, Objekte und
Subjekte in einem ÜBERGEORDNETEN ZEITBEGRIFF[6], der
offensichtlich fürs erste einmal der blaue Zeitbegriff I ist, erfasst werden,
was auch bei Einstein der Fall ist. Er müsste sonst sagen: Meine allgemeinen
Aussagen über die Relativität des Zeitbegriffes bedingt, dass sie selbst auch
als Theorie nur insoweit gelten, als ich als Subjekt mich mit einer bestimmten
Geschwindigkeit bewege. Ändert sich etwa meine Geschwindigkeit in extremer
Weise, dann gelten diese Theorien nicht mehr, weil dann die Art meiner Gedanken
sich völlig verändern würde und ich jetzt gar nicht wissen kann, wie meine
Theorien über die Zeit dann wären. Die Sinnhaftigkeit der Sätze einer Theorie
über die Abhängigkeit aller Qualität physikalischer Zustände und Veränderungen
von der Art und Höhe einer Geschwindigkeit und der Schwerkraft im Rahmen eines
hierdurch definierten Zeitbegriffes, hängt offenbar davon ab, dass diese Sätze
aus dem Strudel des (subjektiven) oder relativen Zeitbegriffes
herausgehalten werden. Das ist aber bei strikter Anerkennung des relativen
Zeitbegriffes unmöglich. Denn jeder Gedanke eines Menschen, alle Begriffe,
Mathematik und Logik würden bei Selbstanwendung dieser Theorie nur bei gewissen
Geschwindigkeitsbedingungen des TP oder anderer Menschen Gültigkeit haben. Bei
anderen Geschwindigkeiten würden sie automatisch verschwinden!
Entweder sind die Gedanken eines Menschen, der sich bewegt, auch "Teile" des untersuchten Systems, dann müssen sie sich mit Änderung der Bewegung des Systems ändern oder die Gedanken der Theorie (Logik, Mathematik) sind nicht Teile des physikalischen Systems, sondern invariante Elemente einer "anderen Instanz" im Menschen. Was ist das für eine andere Instanz, und wie hängt sie mit dem "physikalischen System Mensch" zusammen, bzw. wie kann diese Instanz vom "physikalischen System Mensch und seinen Sinnen" unabhängig sein?
Eine derartige
Interpretation relativer physikalischer Zeitbegriffe würden die TP, die sie
erstellen, wohl nur ungerne
akzeptieren. Offensichtlich machen sie also Zusatzannahmen, die sie aber nicht
ausdrücklich angeben und auch selbst nicht mitgedacht haben. Woher stammt die
Allgemeingültigkeit der Theorieannahmen? Offensichtlich neben vielen anderen
Begriffen aus einem Zeitbegriff I, der notwendigerweise "weniger relativ" ist,
und daher diese Theorien mit seiner integralen Funktion "durch und durch" "
durch alle relativen Zeitbegriffe hindurch" sinnvoll trägt, ihnen überhaupt erst
Sinn verleiht. Invariante, allgemeine Begriffe des Denkens bedürfen daher bei
Theorien der Relativität der Zeit einer Begründung innerhalb eines
Zeitbegriffes, der ihre Invarianz legitimieren könnte.
Diese Überlegung scheint (Ka 91, S. 413) zu bestätigen. "Insoweit sich das Kosmologische Prinzip (Grundsatz, der die Gleichberechtigung aller Raumpunkte des kosmischen Substratums ausspricht) auf die Invarianz von Naturgesetzen bezieht, die Bewegungen von verschiedenen Bezugssystemen aus beschreiben, ist es sicher als Metasatz zu bezeichnen." (Zu den komplizierten Varianten der Formulierung des Kosmologischen Prinzips, je nach dem ob es bezogen wird auf die "Äquivalenz aller Orte im Universum", auf die "Naturgesetze und auf die Ereignisse, die durch sie regiert werden" oder auf das "Erscheinungsbild der Welt" siehe (Ka 91, S. 412f.).
Kanitschneider erwähnt auch die komobilen Koordinatensysteme der Friedmann-Robertson-Walker –Welten, welche erlauben, "die vielen lokalen Zeiten in eine universale Zeit einzupassen, die man in ein Nachfolgeverhältnis zur klassischen, absoluten Zeit stellen kann." (Ka 91, S. 295).
Kurz nach Aufzeichnung dieser Gedanken fand der Autor in der "Kurzen Geschichte der Zeit" von Hawking folgenden tiefsinnigen Satz, der die obigen Überlegungen unterstützt. "Wenn man der Meinung ist, das Universum werde nicht vom Zufall, sondern von bestimmten Gesetzen regiert, muss man die Teiltheorien (gemeint sind allgemeine Relativitätstheorie und Quantenmechanik) zu einer vollständigen vereinheitlichten Theorie zusammenfassen, die alles im Universum beschreibt. es gibt jedoch ein grundlegendes Paradoxon bei der Suche nach einer vollständigen vereinheitlichten Theorie. Die Vorstellungen über wissenschaftliche Theorien, wie sie oben dargelegt wurden, setzen voraus, dass wir vernunftbegabte Wesen sind, die das Universum beobachten und aus dem was sie sehen, logische Schlüsse ziehen können. Diese Vorstellung erlaubt es uns, davon auszugehen, dass wir die Gesetze, die unser Universum regieren, immer umfassender verstehen. Doch wenn es tatsächlich eine vollständige vereinheitlichte Theorie gibt, würde sie wahrscheinlich auch unser Handeln bestimmen. Deshalb würde die Theorie selbst die Suche nach ihr determinieren! Und warum sollte sie bestimmen, dass wir aus den Beobachtungsdaten die richtigen Folgerungen ableiten? Könnte sie nicht ebenso gut festlegen, dass wir die falschen oder überhaupt keine Schlüsse ziehen." Hawking führt dann seine Wahrheitstheorie an, die von Darwinschen Evolutionsthesen ausgehend annimmt, dass wir Chancen hinsichtlich der letztendlichen Findung der Einheitstheorie besitzen.
Im Sinne unseres hiesigen Aufsatzes ist es tatsächlich so: Die unendliche vollständige, vereinheitlichte Theorie (die Grundwissenschaft) bestimmt das Denken und Handeln Gottes, als des unendlichen und unbedingten Wesens, als dessen innerer Teil sie sich darstellt, sie bestimmt aber dann im weiteren auch das Denken und Handeln des Menschen, der sie als endliches Wesen auf endliche Weise erkennen kann, während Gott sie auf unendliche Weise erkennt.
Der Leser sieht, dass es keineswegs so verstiegen ist, zu fragen, wie eine Theorie eines TP auf ihn selbst zurückschlägt, weil er selbst ein Teil der Theorie ist und dass Theorieannahmen durch bestimmte Zustände, welche die Theorie angibt, selbst in ihrem Inhalt verändert werden können oder müssen.
Interessante Überlegungen über diese Wechselwirkung zwischen bestimmten Aggregatzuständen der Materie und unseren kognitiven Strukturen stellt auch (Ka 79, S. 5f.) an. Russel betonte etwa gegenüber Einstein den starken naturalen Bezug unseres gedanklichen Instrumentariums. Die Einbettung der Produkte des Erkenntnisvermögens in die physische Welt wurde auch von Quine untersucht: "I hold that knowledge, mind and meaning are part of the same world that they have to do with, and that they are to be studied in the same empirical spirit, that animates natural science." Wir begegnen der Frage, ob sich Denkinhalte als Funktionen von Denkprozessen (neuronale Basis) auffassen lassen (Probleme der Erweiterung der Ontologie, indem man zwar ein autonom existierendes Reich der geistigen Inhalte postuliert ("Welt 3"), aber dieses nicht in seiner Existenzweise von der psychischen Welt ("Welt 2") trennt, sondern als von ihr aus dem fundamental materiellen Gebiet ("Welt 1") geschaffen annimmt.
Wir haben im Vorigen gesehen, dass Sinnes"stempel" der Sinnesorgane mit der Phantasie verbunden werden und die Phantasie – natürlich unter Benützung von Begriffen, Schlüssen usw. – Bilder der äußeren Welt erzeugt. Wir wollen diese Phantasietätigkeit etwas schlampig als äußere Phantasie D(1) bezeichnen. D(1) erzeugt eine mit der äußeren Sinnenwelt E integrativ gebildete Phantasiewelt. Damit ist aber im Bewusstsein der Bereich der Phantasietätigkeit bei weitem nicht erschöpft.
Wir stellen fest, dass es ohne weiteres möglich ist, Bilder in D(1) in der Phantasie weiterzubilden. Wir können in der Phantasie Bäume bilden, auf denen Silberpferde hängen, Menschen mit Vogelköpfen, Phantasiewesen, wie die Turtles, Donald Duck, Asterix, Pokemon, die Bilderwelt eines Malers wie DALI oder MAX ERNST. Wir können uns in der Phantasie das Haas-Haus auf dem Mund einer Frau, kombiniert mit dem Geruch von Schokoladekeksen und den Klängen einer Arie der Oper "Tosca" vorstellen. Phantasiebilder sind natürlich nicht auf den Gesichtssinn beschränkt. Die Traumfabrik Hollywood erzeugt unentwegt Bildwelten, die mittels Phantasie aus der Natur und den Gesellschaften nachgebildet und weitergebildet sind und die in zunehmendem Maße über die Kinos der ganzen Welt in die Phantasiewelten der Konsumenten übergehen. In unserer Phantasie kann es aber auch Formen geben, die in keiner Weise aus der Natur weitergebildet sind. In dem Buch "Die Vollendete Kunst" habe ich gründlich aufgezeigt, dass in der modernen Malerei der entscheidende Schritt vollzogen wurde, Formen unabhängig von der Natur zu finden und darzustellen. MAX BILL sagt:" Konkrete Kunst nennen wir jene Kunstwerke, die aufgrund ihrer ureigenen Mittel und Gesetzmäßigkeiten – ohne äußerliche Anlehnung an Naturerscheinungen oder deren Transformierung, also nicht durch Abstraktion, – entstanden sind. "Es gibt also unendlich viele Möglichkeiten der Erzeugung von Formen in der menschlichen Phantasie, die nicht aus den Phantasiegebilden D(1) abgeleitet sind, die wir aus der sinnlichen Erkenntnis gewinnen. Die Entwicklung der Kunst seit 1910 bietet reiche Beispiele. Es ist auch zu beachten, dass wir zur Erstellung bestimmter Phantasiegebilde überhaupt keiner sinnlichen Eindrücke E bedürfen; die Sinnlichkeit ist also nicht Voraussetzung unserer Phantasiefähigkeit. Ist die Phantasie in D(1) schon bei der Erzeugung sinnlicher Erkenntnis aktiv und innovativ, so ist sie in der Erzeugung von Phantasiegebilden in D(2) noch wesentlich freier. Selbstverständlich werden auch bei der Erzeugung von Phantasiegebilden in D(2) Begriffe usw. eingesetzt, wenn etwa der Maler, der Architekt oder Erfinder neue Formen sucht. Wir beobachten aber auch, dass wir ständig die beiden Bildwelten D(1) und D(2) miteinander verbinden und dass vor allem in allen gesellschaftlichen Bereichen, von der Finanzverwaltung bis zum elektronischen Spielautomaten, ständig durch Neubildungen in D(1) und D(2) und deren Verbindungen Veränderungen in die "Außenwelt" gebracht werden.
Im Rahmen von Theorien, deren Begriffe bekanntlich selbst vom TP in seiner Phantasie erfunden werden, konstruiert die theoretische Physik Modelle, die symbolisch und in Näherung einige ausgewählte Züge eines realen Systems wiedergeben. Dass das "reale System" selbst eine Konstruktion ist, die wiederum nur durch Sinnlichkeit, Phantasie und Begriffe ermöglicht wird, zeigen wir in dieser Untersuchung mehrmals. Wir haben daher zu beachten, dass die kreative Phantasie der TP ständig am Werk ist, und sich in D(2) neue theoretische Begriffe und Modelle erfindet. Ka 79, S. 411) schreibt etwa: "dies bedeutet meines Erachtens, dass die Kosmologie nie durch Verallgemeinerungen von empirischen Daten, sondern stets nur durch das Erfinden epistemologisch, wenngleich nicht semantisch abstrakter Beziehungen zwischen theoretischen Begriffen und durch die Deduktion erfahrungsnaher Sätze voranschreiten kann." (Siehe auch weiter unten die Erkenntnisschule (2)).
Ein Beispiel spekulativ-phantastischer Begriffsbildung: "Raum und Zeit sollten sekundäre Ideen sein, die aus einer tieferen Ebene hervorgehen. Einige Forscher zum Beispiel arbeiten mit etwas, das sie Quantenschaum nennen. Er enthält nur eine Ahnung von der uns vertrauten Raumzeit. Er ist so turbulent, dass man allenfalls Splitter und Scherben von Raum und Zeit in diesem Schaum sieht. Mit größerem Abstand jedoch erscheinen diese Splitter und Scherben wie eine schöne glatte Raumzeit." Brian Greene im Spiegel 39/2004. Die Begriffe "Splitter" und "Scherben" sind selbst endliche Raumgebilde, die ohne einen Raumbegriff nicht auskommen, vor dessen Entstehung sie eigentlich betrachtet werden. Sofern sich diese Splitter und Scherben als Schaum auch bewegen, setzen sie die Zeit schon voraus, die es damals noch gar nicht gegeben haben soll. Die Wendung "mit größerem Abstand" setzt schon wieder Raumkategorien voraus, die noch gar nicht entstanden sind. Wer betrachtet mit welchen Begriffen den Quantenschaum?
In vielen Erkenntnistheorien werden die unter 1.2.2 dargestellten komplexen Operationen der Phantasie, die laufend ganze Bildwelten erzeugt, ständig im Gedächtnis vorhandene raumzeitliche, plastische Bildkompositionen umstellt, verändert und neu organisiert, überhaupt nicht in der gesamten Tragweite erkannt und berücksichtigt. (Die Phantasie ist natürlich nicht nur im Wachen, sondern auch im Traum tätig, was wir hier nicht weiter untersuchen.) Die sinnliche Erkenntnis wird u.U. als ein einfaches Reiz-Reaktionsverhältnis, als Input-Outputsystem verstanden. Noch viel schwieriger ist die Erschließung des für die sinnliche Erkenntnis im weiteren unerlässlichen Anteils "kognitiver" Operationen begrifflicher Art. Hier finden sich wieder eine Vielzahl von Ansichten in der Erkenntnistheorie. Einige Schulen meinen, Begriffe stammten ausschließlich aus der sinnlichen Erfahrung, man lernte eben Sprachen und ihre Bedeutungen. Andere Schulen meinen, Begriffe müssten wir schon von vornherein (a priori) im Bewusstsein (nach anderer Formulierung im Geist) haben, damit wir überhaupt als Kleinkinder sinnliche Erkenntnis zustandebringen können und überhaupt die Laute der Eltern als Sprache "verstehen" und dann die gesellschaftlich gegebene (z. B. deutsche) Sprache zu erlernen vermögen. Wir hatten also schon Gedanken, Begriffe, bevor wir die Wörter einer Sprache lernen. (Wir haben auf jeden Fall zwischen dem Gedanken und seiner Darstellung als Zeichen in einer Sprache zu unterscheiden!) Die nächste Schule meint gar, dass bestimmte, z. B. logische Gedanken, wie FREGE sagt, nicht Erzeugnis unserer seelischen Tätigkeit sind, sondern im Denken nur "gefunden" werden. "Denn der Gedanke, den wir im Pythagoräischen Theorem haben, ist für alle derselbe, und seine Wahrheit ist ganz unabhängig davon, ob er von diesem oder jenem Menschen gedacht wird oder nicht. Das Denken ist nicht als Hervorbringung des Gedankens, sondern als dessen Erfassung anzusehen."
Wir versuchen jetzt in möglichst einfachen Formulierungen ganz entscheidende Probleme darzustellen. Es ist schon ein großer Fortschritt zu erkennen, dass wir eine Vielzahl von Begriffen (C) benützen und einsetzen müssen, um überhaupt eine sinnliche Erkenntnis zustande zu bringen. Ein noch schwierigeres Unterfangen aber ist es, eine Analyse dieser Begriffe durchzuführen und sie als ein System darzustellen. Das System von Begriffen wäre dann auch gleichzeitig das Schema, nach dem wir alles zu erkennen und zu denken hätten. Dieser Versuch macht einen breiten Teil der Geschichte der Erkenntnistheorie aus, und es gab immer wieder neue Bemühungen, diese Grundgedanken – früher Kategorien genannt – zu systematisieren. Wir erwähnen hier nur ARISTOTELES, KANT und WITTGENSTEIN im Traktat. Die Begriffssysteme der drei Denker sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Auf die Differenzen gehen wir hier aus Platzgründen nicht ein. Wir möchten aber in diesem Zusammenhang auf eine philosophische Frage zumindest hinweisen, die nun gestellt werden muss und auch in der Geschichte immer wieder gestellt wurde: Wenn wir Erkenntnis der Außenwelt durch eine Synthese aus Sinneseindrücken (E), Bildkonstruktionen in äußerer und innerer Phantasie D(1) und D(2) und Begriffen (C) zustandebringen, von denen ein Teil Grundbegriffe bilden, die in einem System erfassbar sind und bei allen Erkenntnissen benützt werden sollen, dann erhebt sich die weitere Frage, woher wir denn wissen sollten, ob die Anwendung dieser Grundbegriffe auf alles, was wir denken und erkennen, zulässig sei. Können wir uns da nicht auch täuschen? Woher sollen wir denn wissen, ob es zulässig ist, diese Begriffe auf alles anzuwenden, was wir denken, vor allem auf die Welt außerhalb unser. Ist die Welt denn auch wirklich so gebaut, wie wir sie uns denken? Hat die Welt denn die gleiche Struktur wie das System der Grundgedanken, das uns da von den Philosophen vorgeschlagen wird? Diese Frage zu stellen, bedeutet einen besonderen Schritt in der Erkenntnistheorie. Sie nicht zu stellen, bedeutet umgekehrt, dem menschlichen Erkenntnisvermögen eine Grenze zu setzen, die eigentlich unzulässig ist. Da wir eingangs ankündigten, die Frage der Grenzen der menschlichen Erkenntnis zu untersuchen, gelangen wir hier an eine entscheidende Stelle. Wird die Zulässigkeit dieser Frage geleugnet, erfolgt bereits eine für die gesamte Entwicklung der Erkenntnistheorie und im weiteren für das Verständnis der Erkenntnisgrenzen der menschlichen Erkenntnis relevante BEGRENZUNG UND EINZÄUNUNG mit schwerwiegenden Folgen. Diese Grenzziehung erfolgt etwa damit, dass man sagt: "Menschliche Erkenntnis ist auf den Aufbau von Theorien zu beschränken, die auf Begriffe der Theorie C(T), Logik und Mathematik sowie auf Beobachtungen zu beschränken sind. Darüber hinausgehende Erkenntnisse sind sinnvoll nicht zu gewinnen. Die formale Logik ist die nicht überschreitbare Grundlage des Aufbaus von Erkenntnis, sozusagen die innerste Grundlage der menschlichen Erkenntnis." Mit dieser Begrenzung hat sich das menschliche Erkenntnisstreben nie zufrieden gegeben. Die Überschreitung dieser Grenze wirft also die Frage auf, ob jenseits des Menschen und der "Welt" ein absolutes und unendliches Grundwesen existiert, in/unter dem sowohl der Mensch als auch die Welt enthalten sind. Gibt es ein solches Grundwesen, ergibt sich die weitere Frage, inwieweit es dem Menschen erkennbar ist. Denn wenn eine solche menschliche Erkenntnis des Grundwesens möglich ist, dann müsste vom Menschen auch erkannt werden können, wie alles an oder in/unter dem unendlichen und unbedingten Grundwesen enthalten ist. Unter der Voraussetzung, dass dies möglich ist, ergeben sich entscheidende Folgerungen:(1) Wahr erkennen wir nur dann, wenn der Bau unseres Denkens so gebaut ist, wie alles in/unter dem Grundwesen enthalten und gebaut ist. Also der Bau des Denkens (Logik) muss so sein wie der Bau der Welt, des Universums, des Weltalls in/unter dem unendlichen Grundwesen.(2) Ist eine solche neue Logik (synthetische Logik, SL) auffindbar, dann ist zu prüfen, inwieweit alle bisherigen Logiken in der Geschichte der Erkenntnistheorie Mängel besitzen, "zu eng" sind oder gar bestimmte Teile derselben überhaupt nicht besitzen.(3) Mit dem Vorhandensein einer solchen Logik würde sich aber auch der Aufbau der Wissenschaft, vor allem auch der Naturwissenschaft, entscheidend verändern.Hier sei zur Klarstellung für den Leser auf einen sehr wichtigen Unterschied in der Art der logischen Systeme hingewiesen. Die einen Denker sagen: Der Bau eines logischen Systems muss sich nach dem Inhalt dessen richten, was wir denken – Inhaltslogik, etwa bei HEGEL –, die anderen meinen, die Logik sei aus bestimmten, ihr eigentümlichen Gesetzen so aufbaubar, dass das System – unabhängig vom Inhalt, auf den die logischen Gesetze und Regeln später angewendet werden – rein der Form nach aufgebaut werden könnte. (Systeme der formalen Logik) Die hier gemeinte Logik, die sich aus der GRUNDWISSENSCHAFT ergibt, ist INHALTSLOGIK und FORMALE LOGIK in völliger Übereinstimmung und Deckung. Ist es nun möglich, den Weg zu beschreiten, den wir hier als Essentialistische Wende bezeichnen wollen? Eine Reihe von Philosophen hat es behauptet. Auch dieser Typ von Systemen hat eine Entwicklung durchgemacht. Die Inhaltslogik HEGELs hat weitreichende geschichtliche Bedeutung erlangt. Ein anderes System erweist sich – zumindest nach unserer Ansicht – als bahnbrechend für die weitere Entwicklung der Wissenschaft dieser Menschheit: die Grundwissenschaft des bisher eher unbeachtet gebliebenen Philosophen KRAUSE. Diese Grundwissenschaft ist in den vom Autor 1981 neu herausgegebenen "Vorlesungen über das System der Philosophie" enthalten, die sich daraus ergebende Logik im Werk "Vorlesungen über Synthetische Logik". Die Grundlagen der Mathematik sind ebenfalls in der GRUNDWISSENSCHAFT abzuleiten und werden weiter unten entwickelt. Im hier begrenzten Rahmen wäre es unmöglich, diese Lehren darzustellen. Wir werden auch unter Berücksichtigung dieser neuen Grundwissenschaft, den Versuch unternehmen, an einem BEISPIEL, das jedem Leser leicht einsichtig sein wird, zu zeigen, worin die bahnbrechenden Neuerungen dieser Lehren für Logik und Mathematik bestehen. Bereits an diesem, relativ eingeschränkten Beispiel lassen sich nämlich die Grundzüge der neuen Logik (SL) und jene Axiome zeigen, welche in der Lage sind, die Grundlagenkrise der modernen Mathematik und damit auch der mathematischen Logik zu beheben. Festgehalten sei aber, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der Grundwissenschaft nicht umhinkäme, diese selbst und die SL gründlich durchzudenken.
Überblicken wir die bisherigen Erkenntnistheorien, können wir, ausgehend von der engsten, folgende, das menschliche Erkenntnisvermögen jeweils weiter fassende Schulentypen feststellen:
Erkenntnisschulen (1) Naiver Empirismus
Die Außenwelt ist uns unmittelbar als subjektunabhängiger Bereich zugänglich. Wir können daher unsere Erkenntnisse und Beobachtungen der Außenwelt mit der "tatsächlichen", wirklichen Außenwelt vergleichen, und dadurch die "Wahrheit" unserer Erkenntnisse überprüfen.
Erkenntnisschulen (2) Kritischer Realismus
Dieser wurde etwa vom späten CARNAP vertreten. Während der Empirismus ursprünglich meinte, für den Aufbau wissenschaftlicher Theorien könne man sich auf Logik und Mathematik sowie auf solche Ausdrücke beschränken, die empirische Begriffe zum Inhalt haben, worunter man solche versteht, deren Anwendbarkeit mit Hilfe von Beobachtungen allein entscheidbar ist, hat sich diese Annahme als zu eng erwiesen. Der prominente Kenner der Schule, STEGMÜLLER, schreibt: "Die Untersuchung über theoretische Begriffe hat gezeigt, dass frühere empirische Vorstellungen vom Aufbau wissenschaftlicher Theorien grundlegend modifiziert werden müssen. Während nach den Vorstellungen des älteren Empirismus in allen Erfahrungswissenschaften der Theoretiker nur solche Begriffe einführen dürfte, die mit dem Begriffsapparat definierbar sind, welcher dem Beobachter zur Verfügung steht, und ferner der Theoretiker nichts anderes zu tun hätte, als Beobachtungsergebnisse zusammenzufassen und zu generalen Gesetzesaussagen zu verallgemeinern, ergibt sich jetzt das folgende Bild von den Aufgaben des Theoretikers. Er hat weit mehr zu tun, als beobachtete Regelmäßigkeiten zu verallgemeinern. Vielmehr muss er EIN NEUES SYSTEM VON BEGRIFFEN KONSTRUIEREN, DIE ZU EINEM TEIL ÜBERHAUPT NICHT UND ZU EINEM ANDEREN TEIL NUR PARTIELL AUF BEOBACHTBARES ZURÜCKFÜHRBAR SIND, ER MUSS SICH WEITER EIN SYSTEM VON GESETZEN AUSDENKEN, WELCHE DIESE NEUEN BEGRIFFE ENTHALTEN, UND ER MUSS SCHLIESSLICH EINE INTERPRETATION SEINES SYSTEMS GEBEN, die eine bloß teilweise empirische Deutung zu liefern hat, die aber dennoch genügen muss, um das theoretische System für die Voraussetzungen beobachtbarer Vorgänge benutzen zu können. Die Begriffe, mit denen er operiert, können GANZ ABSTRAKTE, THEORETISCHE BEGRIFFE SEIN. Dennoch ist er gegen die Gefahr eines Abgleitens in die spekulative Metaphysik so lange gefeit, als er ZEIGEN KANN, DASS ALLE DIESE BEGRIFFE EINE VORAUSSAGERELEVANZ BESITZEN" (Hervorhebungen von S. P.).
Aus diesem Zitat entnehmen wir gleich zweierlei: Zum einen die enorme Bedeutung der überhaupt nicht aus der Erfahrung stammenden abstrakten Begriffe C, beim Aufbau einer jeden wissenschaftlichen Theorie. Es zeigt sich also, dass jede empirische Beobachtung (was man also als Fakten bezeichnet) bereits durch das System der theoretischen Begriffe des Forscher vorgeformt wird, dass also diese Begriffe eine Brille mit bestimmter Färbung und bestimmtem Schliff sind, mit der wir überhaupt erst Beobachtungen machen. Setzen wir uns andere Brillen, mit anderer Färbung und anderen Schliffen auf, erhalten wir ANDERE BEOBACHTUNGEN!!. Die theoretischen Begriffe sind bereits BEOBACHTUNGSKONSTITUTIV, sie sind an der Erzeugung der Beobachtung grundlegend beteiligt. Folgerung: Wir erhalten ANDERE BEOBACHTUNGEN (Fakten), wenn wir andere theoretische Begriffe benützen. Die Außenwelt wird eine Funktion unserer theoretischen Begriffe.
(Der geniale Wissenschaftstheoretiker KUHN folgert hieraus aber in einer gewissen Verlegenheit folgendes: "Sind Theorien einfach menschliche Interpretationen gegebener Daten? Der erkenntnistheoretische Standpunkt, der die westliche Philosophie während dreier Jahrhunderte so oft geleitet hat, verlangt ein sofortiges und eindeutiges Ja! In Ermangelung einer ausgereiften Alternative halte ich es für unmöglich, diesen Standpunkt völlig aufzugeben. Und doch, er fungiert nicht mehr wirksam, und die Versuche, ihn durch Einführung einer neutralen Beobachtungssprache wieder dazu zu bringen, erscheinen mir hoffnungslos.
Aus dem Herzen moderner Kosmologiediskusssion wiederholen wir folgendes Zitat zum Thema mit unseren Einwänden:
"Der Auffassung, dass es eine Basismenge von Fakten gibt, die unabhängig von theoretischen Annahmen existieren und die darauf warten, in einer begrifflich kohärenten Form systematisiert zu werden, steht der Einwand gegenüber, dass eine hypothesenfreie Tatsachensammlung nicht möglich ist, dass schon die Bedeutung der charakterisierenden Ausdrücke kontextabhängig und damit nicht frei von theoretischen Annahmen ist. Oder wie es Paul Feyerabend ausgedrückt hat: 'According to the point of view I am advocating the meaning of observation sentences is determined by the theories with which thy are connected. Theories are meaningful independent from observations; observational statements are not meaningful unless they have been connected with theories. It is therefore the observation sentence that is in need of interpretation and not the theory'. Gerade in der Astrophysik hat eine solche Auffassung ja einiges für sich. Die Interpretation von Beobachtungen, der Weg von einem Fleck auf der photografischen Platte zur Existenzbehauptung einer bestimmten Galaxie oder eines Quasars schließen danach große Teile von hypthetischem Wissen ein."
Zwischenbemerkung: Diese Überlegungen sind eigentlich noch nicht präzise genug, denn die Beobachtungen (hier der Fleck auf der photografischen Platte) ist selbst ohne begriffliche Konstrukte überhaupt nicht als beobachtbare Tatsache erzeugbar.) Kanitschneider fährt fort:
"Folgt daraus nun, dass jeweils nur eine fest gewählte Theorie ihren Objektbereich spezialisieren kann, dass mit der Wahl eines neuen Blickpunktes auch andere Teile der Realität in das Gesichtsfeld treten derart, dass ein Vergleich zwischen mehreren Theorien gar nicht möglich ist, da sie über Verschiedenes reden? Ist mit der hypothesenabhängigen Statuierung der Faktenmenge auch der Verzicht auf eine objektive Widergabe der Strukturen des Realitätsbereiches angesprochen? Wenn das der Fall ist, wäre es überhaupt unmöglich von äquivalenten oder von konkurrierenden kosmologischen Theorien zu sprechen, d.h. solchen, die über einen Bereich isomorphe Strukturbehauptungen aufstellen und damit auch dieselbe prognostische Relevanz besitzen, bzw. solchen, die unvereinbare Aussagen machen, wie etwa die RT und die SST über die Verteilung von Galaxien und Quasaren. Anstatt eines Universums, das mit verschiedenen Theorieansätzen angegangen wird, hätte man einen theorieabhängigen epistemischen Zerfall der Welt in so viele unvergleichbare Objekte vor sich, wie es kosmologische Theorien gibt (Ka 91, S. 404 f.)."
Zwischenbemerkung: Gerade dies ist unsere Behauptung. Die über die jeweiligen Theorien erzeugten beobachteten Fakten in Verbindung mit dem konstitutiven Begriffsvolumen der Theorie schaffen eine Welt, die zu den Welten der anderen Theorien in gewisser Hinsicht inkompatibel sind. Hinzu kommt nach unserem Dafürhalten, dass die verschiedenen Welten die hierdurch entstehen sich auch noch durch die Art der Erkenntnissschulen (M1 bis M5) unterscheiden, in welche die Theorien einzuordnen sind. es entstehen daher qualitativ unterschiedliche Welten, bezogen auf die erkenntnistheoretischen grenzen Begrenzungen, welche die jeweilige Theorie besitzt. Bekanntlich versucht die postmoderne Philosophie (vgl. http://or-om.org/Postmoderne.htm ) diese Vielfalt von Weltbildern - wenn auch nicht sehr überzeugend - zu verwalten. Aber auch die obigen Sätze Kanitschneiders sind selbst bereits, ohne dass er es explizit beachtet jenseits und über allen geschilderten Welten angesiedelt, welche die Physik erzeugt. Sie befinden sich auf einer reflexiven Metaebene, die offensichtlich gegenüber den einzelnen kosmologischen Theorien als invariant, von Raum und Zeit unabhängig und wohl auch universell gelten sollen. Wie ist diese Ebene legitimierbar? Offensichtlich sind wir in der Lage über alle Weltbilder hinaus und sie alle gleichzeitig zu denken, mit Begriffen, die nicht einer der Theorien angehören. Kanitschneider fährt fort:
"Die tatsächliche Verfahrensweise der Kosmologie legt nicht diesen Relativismus nahe, sondern ist in Einklang damit, dass alle Modelle, die aufgrund verschiedener Theorien entworfen werden, trotz ihrer unterschiedlichen Behauptungen einen gemeinsamen Referenten intendieren. Das ergeben auch allgemeine semantische Untersuchungen. Dudley Shapere konnte durch eine Analyse der Verwendung von Existenzaussagen in der Physik zeigen, dass man durchaus von einer transtheoretischen Referenz der Terme sprechen kann, wonach also der semantische Bezug theoretischer Begriffe auch im Rahmen von verschiedenen Theorien aufrechterhalten werden kann. Die radikale Bedeutungsverschiebungshypothese ist danach weit überzogen. Nicht die Bedeutung der Ausdrücke sondern das Wissen über die Referenten verändert sich. Beobachtungen besitzen eine relative Autonomie gegenüber den Theorien, für die sie bestätigende Instanzen darstellen und wahren ihre Relevanz, ihre Kooperationsfähigkeit für verschiedene Theorien, auch wenn ihr Entstehen wiederum durch Hintergrundannahmen geleitet ist. Eine solche Position impliziert keinen naiven Realismus in der Kosmologie, wonach es eine unmittelbare Erfassung von Eigenschaften auf einer 'Ding an sich'-Ebene gäbe, sondern sie behauptet, dass die Kosmologie in Einklan mit einem kritischen Realismus steht, der mit Rücksicht auf die komplizierte Verflechtung von der semantischen Darstellungsfunktion und der methodologischen Rolle der Prüfung an der objektiven - vom Subjekt des Forschers und seiner sprachlichen Hilfsmittel unabhängigen - Existenz des Untersuchungsgegenstandes festhält."
Bemerkung: Eine transtheoretische Referenz der Terme wird zwar stillschweigend vorausgesetzt, wie wir für die Sätze K. selbst oben bemerkten. Diese transtheoretische Referenz impliziert eine Unabhängigkeit der Terme von den Einzeltheorien selbst, damit aber von der Summe aller Kosmologien die es jemals geben wird. Ihre Universalität und Unabhängigkeit von Raum und Zeit wird zwar auch hier wieder postuliert, ist aber nirgends legitimiert. Wir gelangen zumindest in den Bereich des Apriori der unbegrenzten Kommunikationsgemeinschaft bei APEL und HABERMAS, deren Mängel unter http://or-om.org/Postmoderne.htm behandelt werden. Wie können transtheoretische Terme jenseits aller physikalischer Universen postuliert und legitimiert werden. Gehören Teile unseres Bewusstseins nicht den unendlich vielen konzipierbaren Universen an? Wo sind diese Terme und die Gedanken, mit denen sie entworfen werden?
Die unmittelbare Erfassung von Eigenschaften auf einer 'Ding an sich' -Ebene wird zwar von K. angeblich ausgeschlossen, die Annahme eines 'objektiven - vom Subjekt des Forschers und seiner sprachlichen Hilfsmittel unabhängigen - Existenz des Untersuchungsgegenstandes' führt aber wiederum zur Hypothese des 'Dinges an sich' zurück, denn die Annahme der objektiven Existenz des Untersuchungsgegenstandes erschließt uns keinerlei Möglichkeiten uns diesem zu nähern. Wir haben es immer mit von diesem mitbegründeten Sinneseindrücken E unseres Körpers zu tun, den wir mit Phantasie D1 und D2 und eben mit unterschiedlichsten Begriffsapparaten ausschließlich als innersubjektive Bewusstseinskonstrukte ERZEUGEN. Die obigen Annahmen besitzen daher eine bestimmte Naivität. Der "illusive" Charakter der von uns erzeugten Weltbilder bleibt auf den erkenntnistheoretischen Ebenen der Theorien der modernen Physik erhalten.
Zurück zum Zitat Stegmüllers! Nach unserer Ansicht kann eine "neutrale" Beobachtungssprache nur gefunden werden, wenn es wissenschaftlich möglich ist, den Bau der Welt jenseits des Gegensatzes Subjekt-Objekt in einen unendlichen Grund der beiden DEDUKTIV ABZULEITEN: (Siehe unten Erkenntnisschule(5).) Zum zweiten zeigt dieses Zitat bei Stegmüller die Problematik, Metaphysik, also eine über die Erfahrung hinausgehende Existenzdimension auszuklammern, metaphysische Schulen auszugrenzen. Sicherlich kann der Begriff "Voraussagesrelevanz" nur sehr schwer überhaupt definiert werden. Sehr interessant ist übrigens, was PENROSE meint. Er geht wie FREGE davon aus, dass die mathematischen Wahrheiten in einer geistigen Welt unabhängig vom Subjekt ewig existieren[7] und nur gefunden werden. Daneben stellen wir aber das physikalische Universum fest. In der modernen Physik – vor allem Quantenmechanik – erhält das physikalische Weltbild immer mehr mathematische Züge. So glaubt nun PENROSE: Diese beiden Welten könnten womöglich gleichgesetzt werden[8]. In dem hier dargelegten System wird auch diese Frage geklärt: Geistwelt (i) und Natur oder Leibwelt (e) sind in/unter dem unendlichen Grundwesen. Die Welt des Grundwesens, als Or-Wesen und Ur-Wesens enthalten in/unter sich die beiden ebenfalls noch unendlichen Welten i (Geistwesen) und Natur (e). Die mathematischen Wahrheiten, die wir in (LO) teilweise ableiteten, gelten für o, u, Geist und Natur gleichermaßen!
Erkenntnisschulen (3) Transzendentaler Idealismus
Die "Außenwelt" ist ein subjektives Erzeugnis des menschlichen Bewusstseins, wobei nur die Sinneseindrücke auf eine Außenwelt hindeuten. Das Subjekt erzeugt mittels Sinnlichkeit (E) und Begriffen dasjenige, was man Außenwelt nennt. Prominente Vertreter sind KANT und WITTGENSTEIN in der Philosophie des Traktates. Eine über oder außer dem Subjekt gegebene Instanz zur Sicherung der Wahrheit oder Sachgültigkeit der vom Subjekt erzeugten Bewusstseinkonstrukte gibt es nicht. Die Ideen KANTs sind lediglich regulative Instanzen.
Subjekt-Objekt Beziehung vor Kant
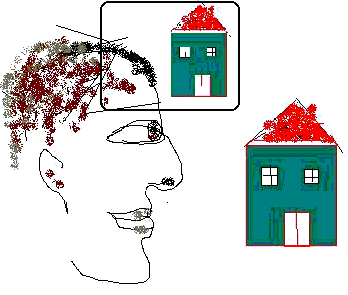
In der Philosophie vor Kant nahm man z.B. an, dass wir bei der Erkenntnis des Außenwelt davon ausgehen, dass wir Gegenstände vor uns haben, die real sind. Also: wir besitzen in uns eine Vorstellung "Haus" 1 von einem wirklichen Haus 2. Es entsteht dann im weiteren die Frage nach der
(Problem der Wahrheit der Erkenntnis)
Hierbei entwickelten sich im Laufe der Zeit zwei Grundschulen:
|
Empirismus |
Rationalistische Antwort (idealistisch) |
|
Weil die Dinge sich in uns (wahr?) abbilden. Aber wie bildet 2 sich in 1richtig ab? Diese These endet in Skeptizismus
|
Prästabilisierte Harmonie, durch Gott ist es so eingerichtet, dass das Denken in 1 im Inhalt mit 2 übereinstimmt. |
Kant
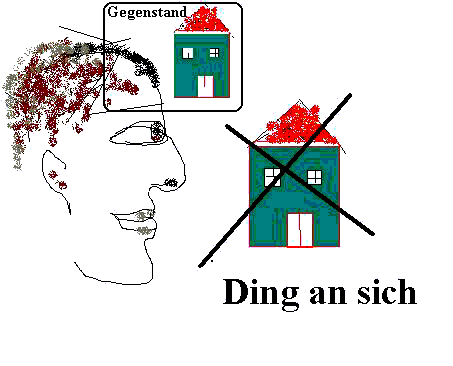
|
2 Quellen Einheit, Vereinigung | |
|
Verstand Denken b Kategorien aller Denkbarkeit. Verstand baut durch die Kategorien die Erfahrungswelt erst auf. Gegenstand 2 ist nicht, ohne in 1 gedacht zu sein. Die Anschauung a wird erst durch b zum Gegenstand. Die Kategorien sind abgeleitet aus den Urteilen.
|
Sinnlichkeit, sinnliche Anschauung a Durch die notwendige Anschauungsform RAUM (dreidimensionaler euklidischer Raum) bilden wir die äußere Wirklichkeit → Erscheinung. Raum ist nicht Eigenschaft der Dinge sondern die Dinge sind nur sofern sie für 1 da sind, sofern sie Erscheinung sind. Erscheinung ist 2 als Erzeugnis in 1. Gleiches gilt für die ZEIT.
|
|
Gegenstand wird gedacht Spontaneität a priori Funktion Ergreifender Denkakt b braucht a Begriffe ohne Anschauung sind leer |
Gegenstand wird gegeben Rezeptivität a posteriori Affektion Anschauliche Sinnlichkeit a ohne b ist blind Anschauungen ohne Begriffe sind blind |
|
Übereinstimmung von 1 (Subjekt) und 2 (Objekt) bei Kant: Wir erkennen nicht 2 sondern erzeugen in uns durch a und b den "Gegenstand". Die Frage der Übereinstimmung gibt es nicht mehr. Weder die empirische noch die rationalistische Antwort sind richtig. Keine hat recht. Was ist das Subjekt 1? Nicht das psychologische Subjekt, sondern ein "Ich denke" als "reines Bewusstsein" mit den Funktionen des Verstandes b. In dem "Ich denke" stimmen wir als denkende Subjekte alle überein. Bewusstsein des Allgemeingültigen. Der größte Mangel der Erkenntnistheorie Kants liegt zweifelsohne in seiner Theorie des "Dinges an sich". Wir erkennen, wie oben gezeigt, nur "Gegenstände" als Konstrukte von a und b. Trotzdem trifft Kant Aussagen über das außer uns befindliche "Ding an sich" als Grenzbegriff. Er stellt Erörterungen über dasselbe an. Es entsteht der Widerspruch, dass man hinsichtlich etwas begrifflich nicht Fassbarem zum Nachweis seiner Unfassbarkeit wieder eine begriffliche Fassbarkeit versucht. Durch das "Ding an sich" entsteht eine Weltverdopplung, die neue Probleme aufwirft. | |
"Logische Tafel der Urteile:
I. Der Quantität nach : Allgemeine, Besondere, Einzelne.
II. Der Qualität nach : Bejahende, Verneinende, Unendliche.
III. Der Relation nach : Kategorische, Hypothetische, Disjunktive.
IV.
Der Modalität nach: Problematische, Assertorische,
Apodiktische.
Transzendentale Tafel der Verstandesbegriffe:
(das Ganze).
II. Der Qualität : Realität, Negation, Einschränkung.
III. Der Relation : Substanz, Ursache, Gemeinschaft.
IV. Der Modalität : Möglichkeit, Dasein, Notwendigkeit."
Es findet sich aber auch die Anmerkung zu dieser Tafel: "Über eine vorgelegte Tafel der Kategorien lassen sich allerlei artige Anmerkungen machen, als: 1) daß die dritte aus der ersten und zweiten in einen Begriff verbunden entspringe ..." Auch in der "Kritik der reinen Vernunft" findet sich ein ähnlicher Gedanke: "2te Anmerkung: Dass allerwärts eine gleiche Zahl der Kategorien jeder Klasse, nämlich drei sind, welche eben sowohl zum Nachdenken auffordert, da sonst alle Einteilung a priori durch Begriffe Dichotomie sein muss. Dazu kommt aber noch, daß die dritte Kategorie allenthalben aus der Verbindung der zweiten mit der ersten ihrer Klasse entspringt."
Die Ideen
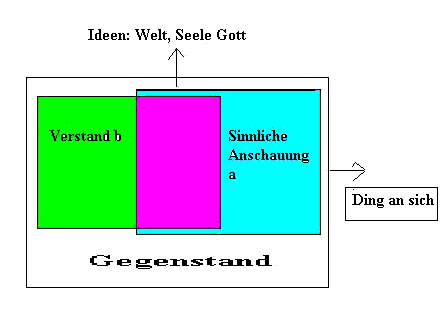
Wird der Verstand b mit seinen Kategorien auf Ideen wie Gott, Welt, Seele usw. angewendet, dann ist dies deshalb unzulässig, weil diesen Ideen nichts entspricht, wie bei der sinnlichen Erfahrung, wo durch ein "Ding an sich" durch sinnliche Anschauung und Verstand ein Gegenstand gebildet wird. Wenn ich daher die Idee der Welt als "All des Seins" denke, übertrage ich die Kategorien des Verstandes b, die nur für die Erfahrung also in Verbindung mit a gelten, auf Unendlichkeiten , die weil unerfüllbar, sich der Erfahrung entziehen. Das Sein im Ganzen (Gott) ist kein Gegenstand. Ideen zeigen sich, wo ich im Fortgang der Verstandeserkenntnis den Abschluss zu einem Ganzen suche. Sie täuschen, wenn der Abschluss in einem erkannten Gegenstand erreicht gedacht werden. Dieser Weg ist eine notwendige Illusion unserer Vernunft. Die Ideen sind notwendige Illusionen unserer Vernunft. Den Ideen kann in der Erfahrung nie ein adäquater Gegenstand gegeben werden.
Aber: Wir gewinnen durch die Ideen Regeln unseres Fortschreitens in der Erkenntnis, aber nicht den Gegenstand der Idee. Die Ideen sind daher regulative Prinzipien des Fortganges der Forschung, nicht konstitutive Prinzipien für den Aufbau eines Gegenstandes. Vernunft als regulative Prinzipien jeden Verstandesgebrauches zum Bedarf einer möglichen Erfahrung.
Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese regulativen Funktionen der Ideen, also metaphysischer Bereiche jenseits des Verstandes bei Kant eine essentielle Rolle spielen, die in der späteren Analyse und Beurteilung Kants oft einfach ausgeklammert werden. Man beschränkte sich darauf, seine Grenzziehungsverfahren hinsichtlich des Verstandes als Legitimation für eigene, zumeist noch engere Grenzziehungen einzusetzen.
In der Nachfolge Kants werden diese Ansichten
ähnlich bei Husserl und derzeit in den Varianten des Konstruktivismus und
De-Konstruktivismus vertreten, wobei aber der Bezug auf die Ideen entfällt. Wird
diese Theorie in der Physik konsequent eingesetzt, dann gibt es natürlich keine
Möglichkeit, Annahmen, die unter Einsatz bestimmter Theorien (RT, QT, STT, VT)
gewonnen werden, mit Beobachtungen der "realen Dinge" zur Wahrheitsfindung zu
vergleichen. Von den "realen Dingen" besitzen wir über die Beobachtung nur
Daten-Konstrukte, die noch dazu durch die Begriffe der eingesetzten Theorien
(RT, QT, STT, VT) präformiert und daher auch diesbezüglich zu relativieren sind.
Wie wir in einem folgenden Kapitel zeigen werden, kehrt die Philosophie der
Physik immer wieder zur Position Kants zurück und sucht
nach einer a priorischen Begründungsmöglichkeit der Physik. Hier sei besonders
auf die Arbeiten Lyres verwiesen (http://www.lyre.de/physapri.pdf und
http://www.lyre.de/dkp18.pdf ). Hier
ist auch der Ort, auf die ausführliche Kant-Kritik Krauses in (Zur Geschichte
der neueren philosophischen Systeme, 1889, S. 9f.) hinzuweisen. Entscheidend
ist, dass Krause den Versuch Kants der Begründung der a priori Kategorien als
mangelhaft ausweist, und selbst an der unendlichen und unbedingten Wesenheit
Gottes die für die Göttliche und die menschliche Rationalität , damit der Logik,
Mathematik und Ontologie konstitutiven a priori Kategorien undogmatisch
ableitet.
Die Erkenntnisschulen (1) bis (3) spielen in der modernen Physik eine zentrale Rolle und sind selbst wiederum postmodern differenziert. (Ka 79, S. 33 f.) erstellt eine differenziertere Systematik der Schultypen. Die idealistischen Standpunkte umfassen: Instrumentalismus, Operationalismus, Phänomenalismus und Konventionalismus; die realistischen Standpunkte umfassen naiven, kritischen, hypothetischen, strukturalen und repräsentativen Realismus. Hier können die Unterschiede nicht ausgeführt und noch weniger kritisch analysiert werden. Es zeigt sich jedoch auch hier eine typisch "postmoderne" Situation der inkompatiblen Ausdifferenzierung von Standpunkten. Zu beachten ist auch, dass innerhalb einer Theorie (Quantenphysik, Stringtheorie, ART usw.) einzelne Vertreter unterschiedliche erkenntnistheoretische Standpunkte einnehmen, was die Interpretationsfächerung erhöht. Kanitschneider selbst anerkennt das Erkenntnisziel synthetischer Philosophie (Aufbau eines integrierten Weltbildes) unter Abgrenzung zur Metaphysik, während andere Physiker dies strikte ablehnen.
Erkenntnisschulen (4) Transsubjektive, transpersonale Systeme
Hier wird angenommen, dass jenseits des Subjektes ein letzter Urgrund, ein Grundwesen, Gott ist, mit dem der Mensch in Verbindung steht und durch welches Wesen Subjekt und Außenwelt verbunden sind. In diesen Bereich fallen alle intuitiven Einsichten, denen aber noch deduktive wissenschaftliche Präzision fehlt, wie dies in mythischen, pantheistischen und ähnlichen Konzeptionen in der Darstellung des Verhältnisses zwischen Gott und der Welt geschieht (z. B. PLATO, HEGEL, SCHELLING, JASPERS, theosophische, pansophische und mystische Systeme).
Erkenntnisschule (5) Grundwissenschaft der Wesenlehre
Wie schon vorne angedeutet, sehen wir in der von KRAUSE entwickelten Grundwissenschaft eine wissenschaftlich präzise, UNDOGMATISCHE, deduktive Metaphysik begründet. Wir werden im folgenden sowohl den Erkenntnisweg bis zur Schau Gottes andeuten, als auch die Grundwissenschaft deduktiv entwickeln.
Wir sehen also nunmehr unsere Schwierigkeiten genauer: Die menschliche Erkenntnisfähigkeit wird über erkenntnistheoretische Thesen formuliert, die oft mit Vehemenz Grenzen ziehen. Sie wird eine Funktion dieser Grenze.
Inzwischen hat die zunehmende Differenzierung der modernen Gesellschaften des Westens so weit zugenommen, dass die Philosophie sich in der Aufgabe zu verlieren droht, die vielfältigen Denkarten, Erkenntnisschulen und Wissenschaftssysteme in ihrer Pluralität zu verwalten, ohne sich hierbei eines einheitlichen essentialistischen Grundkonzeptes bedienen zu wollen (Pluralitätssicherung unter Dissensbedingungen). Vernünftige Verwaltung von Vielheit ohne Einheit ist aber selbst ein einheitsstiftendes und damit totalisierendes Vernunftkonzept. Die obigen Erkenntnisschulen (4) und (5) werden bekanntlich in der Postmoderne strikte abgelehnt. Wir werden aber zeigen, dass dies nur mangelhaft gelingt. In der Theorie der Physik scheint diese Entwicklung der westlichen Philosophie hin zur Postermoderne noch kaum Berücksichtigung gefunden zu haben.
Unter diesem Titel fassen Apel und Kettner in (Apel 1996) eine Reihe von Ansätzen moderner Vernunftkonzepte zusammen.
Eine Systematisierung der Vernunftbegriffe in der Moderne (Apel 1996: Fulda/Horstmann) bringt es auf 33 verschiedene Ansätze.
Wurde der Begriff der Vernunft einst von der Aufklärung mit den Annahmen menschenwürdiger Verhältnisse und Befreiung aus Unmündigkeit verbunden, wird heute, offensichtlich nach den schweren gesellschaftlichen Erschütterungen durch die Weltkriege, mit Vernunft eher Bevormundung, Gefühllosigkeit, Einförmigkeit, totalisierende Unterdrückung assoziiert. Mit der Kritik der Irrationalität einer verselbständigten "instrumentellen" Vernunft (Apel 1996: Horkheimer/Adorno) wurde die Vernunfttradition im Zeichen einer "radikalen Vernunftkritik" als Ganzes für einen Irrweg erklärt.
Betrachtet man die Tendenzen der aufgeführten Vernunftkonzepte im Überblick, so bemerkt man die durch die historischen Erfahrungen gezähmten und modesten Vorgaben, Anspruchsniveaus und Funktionen, die man einem revidierten Vernunftbegriff zumuten will. Kettner meint daher, dass heute nur ein "bornierter Vernunftabsolutismus relativiert würde, den loszuwerden kein Übel sei".
Die Mängel der vorgelegten Modelle erblicken wir:
a) einerseits in der mangelhaften Fundier- und Legitimierbarkeit (Autorisierung) derselben jeweils durch sich selbst. Sie sind ja die "höchste Grundlage" ihrer selbst und müssen sich daher der von Welsch geforderten selbstreferentiellen Konsistenz stellen und
b) in der hochgradigen Mangelhaftigkeit dieser Ansätze bei der Lösung der empirisch-pragmatischen gesellschaftlichen Probleme in den einzelnen Staaten (Sozial- mit Untersystemen) sowie in den zunehmenden Spannungen im Weltsystem. In diesem Bereich mangelt es auch nicht an Versuchen, sich den "pragmatischen Prozessen" (Apel 1996: Will) mit praxisbezogenen Ansätzen zu nähern, um die "Verfehlung des Konkreten" (Apel 1996: Gert) in der traditionellen Vernunftkritik auszugleichen.
Man könnte daher sagen, die "einheitsstiftenden" abstrakteren Versuche bleiben vorsichtig, sich oft nur auf formale Strukturen der Vernunft beschränkend, die "Blutleere" dieser Ansätze provoziert ausgleichende pragmatische Modelle. Eine Vereinheitlichung der beiden Strömungen ist nicht absehbar.
Welsch hat neuerdings in seinem Werk über die transversale Vernunft (Welsch 95), in dem die zeitgenössische Vernunftkritik äußerst sorgfältig bearbeitet wird, überzeugend und in begrüßenswerter Weise auf die Probleme der Selbstwidersprüchlichkeit des Pluralitätskonzeptes hingewiesen.
Er betont, dass man sich der Selbstreferentialität konsequent stellen müsse, was viele Denker nicht unbedingt beachteten.
Für seine Konzeption behauptet er, dass sie keine andere eliminiere, sie erhebe keine Ausschließlichkeitsansprüche und sie sei für den Dialog mit anderen Konzeptionen offen.
Dem scheint aber bereits folgende Passage zu widersprechen:
"Transversale Vernunft bezeichnet die Grundform von Vernunft überhaupt. Das Konzept der transversalen Vernunft ist nicht bloß ein spezifisches Konzept, sondern rekurriert auf die Grundform von Vernunft überhaupt, bringt diese zur Geltung. Es mag sein, daß transversale Vernunft nicht die ganze Vernunft ist, aber sie scheint allenthalben deren grundlegender Modus zu sein."
In einem neueren Aufsatz : "Vernunft und Übergang" (1996) arbeitet Welsch noch präziser heraus, dass sein Vernunftkonzept keine Metaordnung erlasse.
"Um diese traditionelle Erwartung zu erfüllen, müsste Vernunft nicht nur ein überlegenes Vermögen sein, sondern zudem über Prinzipien verfügen, welche die Dekretierung einer Metaordnung erlaubten. Das ist jedoch nicht der Fall. Vernunft besitzt solche Prinzipien nicht. (...) Vernunft ist vielmehr strikt als reine Vernunft zu verstehen, und das bedeutet: sie besitzt keine inhaltlichen, sondern ausschließlich formale Prinzipien (die logischen Prinzipien)."[10]
Mit dieser scharfen Trennung von formalen und inhaltlichen Elementen im Vernunftdiskurs tauchen natürlich die gesamten Probleme der Vernunftkritik Kants und des frühen Wittgenstein wieder auf. Wie sind die für die Verwaltung aller Rationalitätsformen im Rahmen der transversalen Vernunft konstitutiven formalen Prinzipien selbst fundiert? Woher könnten gerade sie die Legitimation erhalten, gerade so, wie sie bei Welsch definiert sind, auch als formale Prinzipien die All-Verwaltung aller Rationalitätsformen zu übernehmen, die universale Richterin zu sein? Daneben entsteht natürlich das schwierige Zusatzproblem, dass auch formale Prinzipien selbst einen Inhalt haben, dessen Fundierung überhaupt nicht erfolgt.
Die Vernunft kann alle Vernunftkonzepte transzendieren und in einer Metasicht auf alle blicken, was den infiniten Regress in die Betrachtung bringt. Das Pluralitätskonzept ist, wie wir sahen, von Welsch nicht als ein Ansatz konzipiert, der sich durch den Kontakt mit anderen grundsätzlich in Frage stellen könnte oder wollte, wenn Welsch auch andeutet, dass das Ergebnis der Diskussion mit entgegengesetzten Konzeptionen nicht vorweggenommen werden könnte. Welsch meint aber, dass die Diskussion einzig mittels transversaler Vernunft und in ihr als Medium erfolgen könne. Transversale Vernunft wird also strukturell das Medium sein müssen, in dem das Pluralitätskonzept zusammen mit den anderen Konzeptionen auf dem Prüfstand steht. Sein Konzept genieße daher eine Auszeichnung, zwar nicht das Pluralitätskonzept als solches, wohl aber hinsichtlich des mit ihm verbundenen Konzeptes der transversalen Vernunft.
"Der Ausgang des Streites ist offen, das Vollzugsmedium nicht."
Spätestens hier ist die Paradoxie wieder vollzogen. Die fundamentalistische Annahme, dass das Vollzugsmedium nur die transversale Vernunft sein könne, diese Auszeichnung und Hervorhebung widerspricht eben der Behauptung, die selbstreferentielle Konsistenz sei gegeben. Wenn der Streit nur im Medium der transversalen Vernunft erfolgen darf, die dann eine funktionell formale, universelle Struktur wäre, ist eben wieder ein fundamentalistischer Bereich postuliert, welcher eben der These der Transversalität der Vernunft widerspricht. Tritt die transversale Vernunft nicht selbst wieder als Instrument von Herrschaft auf, wenn sie die von ihr selbst für alle gezogenen Grenzen und Fähigkeiten nicht ausreichend legitimieren kann? Was wäre, wenn die formalen Prinzipien der transversalen Vernunft selbst sich als inhaltlich problematisch erwiesen?
Waldenfels sieht in (Waldenfels 1990) zwei gegenläufige Tendenzen. "So antwortet auf die Zentrierung der Ordnung in einem einheitlichen Logos die Auflösung des Logos in eine Vielzahl von Logos, von Sinn- und Kräftefeldern." Gibt es aus diesem Gegeneinander einen Ausweg?
Waldenfels meint:
"Herausführen könnte ein Denken und Handeln, das mit dem Potential begrenzter Ordnungen ernst macht, ohne einfach Ordnung und Unordnung gegeneinander auszuspielen. (...) Die Heterogenität von Ordnungsberei-chen, die sich nicht einer einzigen Herkunft und einer einheitlichen Bezugsskala zuordnen lassen, schließt nicht aus, dass die Ordnungs-bereiche sich mehr oder weniger überschneiden. (...) Diese wenigen Bemerkungen mögen zeigen, dass die begrenzten Ordnungen, die aus dem Stufenbau einer Gesamtordnung oder den Steuerungen einer Grund-ordnung entlassen sind, sich keineswegs in pure Vielfalt und Beliebigkeit auflösen. Es gibt laterale Verbindungen, die reicher sind, als alle 'pyramidalen' Ordnungen."
"Das Übergreifen von einer Ordnung auf die andere, die Verflechtung von Eigenem und Fremden, von Neuem und Altem, setzt weiterhin voraus, dass jemand, der sich redend und handelnd in den Grenzen einer bestimmten Ordnung bewegt, diese Grenzen zugleich überschreitet, ohne sie zu überwinden. (...) Was sich hier andeutet, ist eine 'responsive Rationalität', die aus einem antwortenden Reden und Tun erwächst und jede bestehende Ordnung sprengt, ohne sie durch eine umfassendere Ordnung zu ersetzen. Möglicher Prüfstein dieser Rationalität wäre der nun schon öfters erwähnte Umgang mit dem Fremden, mit dem alltäglich Fremden, aber auch mit dem historisch Zurückliegenden und dem geografisch Fernliegenden, schließlich auch mit der menschenleeren Natur. Der Kreislauf rückwirkender Aneignung wäre damit ebenso durchbrochen, wie die Bewegung eines unendlichen Fortschreitens. Wenn es hier eine Wende gibt, so fände sie ihren Platz nicht mehr innerhalb der Moderne, aber auch nicht davor oder danach. Anders denken, heißt auch in anderen Dimensionen denken."
Auch an einer anderen Stelle wehrt sich Waldenfels gegen eine Sicht des Drinnen und Draußen durch den Blickwinkel eines Dritten, der über den Dingen steht. Welche Mängel sieht Waldenfels in dieser Sichtweise?
Da er eine Asymmetrie von Drinnen und Draußen moniert, meint er:
"Diese Verschiebung des Blickpunktes räumt auf mit der Einseitigkeit, die der Relation von Drinnen und Draußen anhaftet. Die Beziehung zwischen Selbem und Anderem gerät in den Blickwinkel eines Dritten, der über den Dingen steht und sozusagen den Blick auf beide Seiten der Grenze richtet und beiden Seiten ihre Einseitigkeit vorhält. Was diesem Blick, der notgedrungen irgendwo beginnt, noch an eigener Parteilichkeit anhaftet, wird getilgt durch einen Austausch der Perspektiven, eine zu erlernende Reversibilität der Standpunkte. (...) Der Mensch hat den zusätzlichen Vorteil, daß er dies weiß und somit das eigene Element des Lebens zum allgemeinen Element des Denkens erweitern kann. Einem Lebewesen, das den Logos hat, ist im Grunde nichts mehr fremd. Diese altbekannte Operation hat nur den Nachteil, daß sie, indem sie grenzenlos wird, auch bodenlos wird. Der Übergang von einer raumverhafteten Ein- und Ausgrenzung zur raumenthobenen Abgrenzung verwandelt voluminöse Tiefenwesen, die einander ausgrenzen, in geometrische Flächenwesen, die nur noch aneinander grenzen für einen Blick, der das Gesehene überfliegt und nicht mehr darin verwickelt ist. Abgründe und Klüfte, die eines vom anderen trennen, werden auf Begriffsbrücken überquert. Wo Synopsis und Synthesis ihr Werk tun, bis hin zur Lust am Panorama, bleibt im Grunde oder auf die Dauer nichts draußen, außer demjenigen, was sich selbst als nichtig, widersinnig oder widersprüchlich ausschließt. (...) Die Differenz von Drinnen und Draußen geht unter in einer grandiosen Tautologie, die am Ende nur noch Binnengrenzen kennt, innerhalb einer Identität von Identität und Nichtidentität."
Ist aber das Grenztheorem selbst eine Ordnung für alle Ordnungen, eine Meta-ordnung, der Blickwinkel eines Dritten, der über den Grenzen aller Grenzen steht, dann verfällt es all jenen kritischen Argumenten, die Waldenfels den anderen Ordnungsversuchen der Vernunft als Grenzgeschichte vorwirft:
Das Grenztheorem wird zu transzendentaler Gewalt, einer alles umfassenden Ordnung, die selbst den Bedrohungen jeglicher Allgemeinheit durch eine eigene Allgemeinheit zu entgehen versucht. Das Grenztheorem wäre selbst Totalisierung und natürlich auch eine Ordnungsmacht mit universellen Geltungsansprüchen, wäre zweifelsohne eine formelle Grundordnung, welche den Umgang mit Partikularität regelt, wäre eine Allheitsvision neuer Art, wäre selbst eine Art Synopsis und Synthesis, welche, was jemals gesehen wurde und jemals gesehen werden kann, überflogen hat oder zumindest eine Anleitung gibt, welchen Blick man haben soll, wenn man es überfliegt.
Die Philosophie der Physik hat die Postmoderne der übrigen Philosophie bisher wenig beachtet. Ja man könnte sagen, sie hat eine eigene Postmoderne erreicht, die aber keineswegs die totalisierende Einheit ablehnt, sondern sie in ihrer Differenziertheit geradezu vehement sucht. Eine Oszillation zwischen den Erkenntnissschulen (1) bis (3) ist offensichtlich.
Die folgende Episode, die man auch als Einsteins Pendelschlag in die Empirie bezeichnen könnte, sei vorangeschickt. (Mi 89) führt etwa aus: "Einstein hat in diesem Zusammenhang immer wieder betont, dass die Kategorien nicht a priori gegeben sind, und dass die Wahl der Verstandesbegriffe so zu erfolgen habe, dass diese Begriffe auf die Wirklichkeit anwendbar sind". 'Es ist nach meiner Überzeugung eine der verderblichsten Taten der Philosophen, dass sie gewisse begriffliche Grundlagen der Naturwissenschaft aus dem der Kontrolle zugänglichen Gebiete des Empirisch-Zweckmäßigen in die unangreifbare Höhe des Denknotwendigen (Apriorischen) versetzt haben.'" Mittelstaedt – Einstein folgend – kommt dann auch zu folgendem Ergebnis: "Das Konzept der Physik ist insoweit geändert worden, als Physik jetzt eine Theorie der Natur ist, wie sie sich zeigt, wenn sie mit realen Maßstäben und Uhren untersucht wird. Dieser neue Begriff der Physik ist für die ganze weitere Entwicklung maßgebend geworden."
Kritik: Wie unten gezeigt wird, ist auch im internen Kreis der theoretischen Physiker diese Haltung nicht anerkannt worden, da sie eine Reihe von Problemen aufwirft. Aus unserer Sicht ist festzuhalten, das wir natürlich nicht die klassische Physik verteidigen, aber schwerwiegende Einwände vorzubringen haben. Niemand kann mit "realen" Maßstäben und Uhren umgehen. Neben den unten angeführten Problemen (der Konventionalitätsthese der Gleichzeitigkeit in der SRT und den konventionellen Elementen der empirischen Geometrie in der ART) sind auch alle "erkannten" Maßstäbe und Uhren nur Konstrukte des Bewusstseins, für welche wiederum die "Formen der Anschauung" des Raumes und der Zeit (sei es der klassischen oder einer anderen, oder gar erst der von Einstein postulierten) benützt werden müssen. Das Postulat Einsteins, die Wahl der Verstandesbegriffe so zu gestalten, dass die Begriffe auf die Wirklichkeit anwendbar sind, ist deshalb naiv, weil es keine von Begriffsbildungen unabhängige "Wirklichkeit" gibt, sondern jede Wirklichkeit eine unhintergehbare Funktion der eingesetzten Begriffe des Subjektes ist. Wie wir zeigten, erzeugen wir bei Einsatz des Begriffsapparates1 eine Wirklichkeit1, mit Begriffsapparates2 eine Wirklichkeit2 und der Umgang mit Wirklichkeit2 unter Einsatz des Begriffsapparates1 führt bereits, wie die moderne Physik zeigt, zum Inkompatibilitäten. Woher stammen darüber hinaus die auch von Einstein eingesetzten Begriffe der Mathematik und Logik, die als fixe, allgemeine Basis aller Operationen mit den über seine empirischen Begriffe gewonnenen empirischen Daten (Wirklichkeiten) eingesetzt werden? Diese Begriffe der Mathematik und Logik hat Einstein nicht in den empirischen Strudel hineingezogen. Wie war er dazu berechtigt?
Einen "Einblick in die Philosophie der Physik" bietet etwa Lyre (2003) in http://www.pro-physik.de/Phy/External/PhyH/1,,2-9206-01-phy_news-00,00.html . Bei den Erkenntnisschulen wird zwischen Empirismus, Rationalismus und Apriorismus unterschieden[11]. "Der strenge Empirist gesteht lediglich die Möglichkeit von Wissen oder Erkenntnis auf der Basis von (Sinnes-) Erfahrung zu, während ein strenger Rationalist nur durch das Denken oder im Geist gebildete Kenntnisse – von dieser Art könnte etwa mathematisches Wissen sein – anerkennt. Klarerweise werden Naturwissenschaftler in weitem Umfange empiristischen Überzeugungen zuneigen, die entscheidende Frage ist dann aber, ob physikalisches Wissen – insbesondere die Kenntnis naturgesetzlicher Zusammenhänge – hierdurch erschöpfend erklärbar wird. Der Apriorismus, eine Position die traditionell vor allem mit dem Namen Kants verbunden ist, behauptet neben dem (aposteriorischen) empirischen Wissen noch zusätzliche Anteile aproirischer Erkenntnis. Das entscheidende Argument dabei ist, dass die zugestandene Möglichkeit von Erfahrung gewisse Vorbedingungen zur Voraussetzung hat, die sich dann in der Erfahrung mit Notwendigkeit und Allgemeinheit als wahr erweisen." Lyre untersucht in seinen zitierten Arbeiten im weiteren die bisherigen Versuche, den Apriorismus zu entkräften ( Mangelhaftigkeit unmittelbare Evidenz, inakzeptabler subjektiver Zug, Relativierung der Apriori-Annahmen Kants z.B. des Raumes usw.). Andererseits erwiesen sich die Thesen des strengen Empirismus, der "teilweise nahe einem metaphysischen Realismus steht, der die Existenz der Außenwelt, ihre Unabhängigkeit vom Erkenntnissubjekt und eindeutige Wissbarkeit fordert", als nicht haltbar und wurden durch einen "geläuterten Empirismus" ersetzt, den wir vorne kurz skizzierten. Eine weitere Untersuchung Lyres über die "Möglichkeit und die Grenzen des wissenschaftlichen Realismus" findet sich unter http://www.lyre.de/realgrenz.pdf . In (Ly 00) erwähnt er auch noch den "internen Realismus" Hilary Putmans, der Anleihen bei Kant macht, ohne in dogmatischen Kantianismus zu verfallen.
Im Rahmen dieser Wissenschaftstheorie kommt Lyre auf methodologische Fragen zu sprechen (Frage nach den Unterschieden zwischen hypothetisch-deduktiver Methode und Induktion, oder dem Verhältnis von Theorie und Empirie usw.). Der Poppersche Falsifikationismus geht von der auf Hume zurückgehenden These aus, dass auf induktivem Wege – also auf Grund einer endlichen Zahl von Beobachtungen – nie in Strenge auf die Allgemeingültigkeit von Naturgesetzen geschlossen werden kann. Daraus ist zu folgern, dass gesetzesartige Zusammenhänge niemals bestätigt (verifiziert) werden und daher immer nur hypothetischen Charakter haben können. " Man spricht von hypothetischem Realismus. Gleichwohl dient Falsifizierbarkeit als Abgrenzungskriterium von Theorien, deren Grad an Wissenschaftlichkeit sich an ihren Falsifikationsmöglichkeiten bemisst.
Notiz: Im Sinne unserer Untersuchungen wird hier folgendes deutlich. Zum einen zeigt sich, dass "echte" Allgemeinbegriffe und deren Verknüpfungen aus rein empirischen Verfahren im obigen Sinne überhaupt nicht gewonnen werden können. Andererseits stehen wir weiterhin vor der Frage, wie man in einem deduktiven Verfahren, welches von "verlässlichen" Allgemeingriffen ausgeht, aus den ständigen Zirkularitäten der Hypothesenschleife heraus kommen könnte.
Bleibt man aber rein auf dem Boden des Falsifikationismus, ergeben sich auch dort genügend offene Fragen: Gibt es eine Allgemeingültigkeit von Logik und Mathematik, welche bekanntlich für den Aufbau aller empiristischen Konzepte konstitutiv sind? Wurden nicht auch diese Disziplinen längst in den postmodernen Sog unterschiedlichster Interpretationsthesen gezogen? Woher kann die Allgemeingültigkeit derselben stammen, wenn die empirische Erkenntnis dafür nicht in Frage kommt? Die härteste Frage, mit welcher der hypothetische Realismus (mit Falsifikationismus) seinerseits konfrontiert werden muss, ist aber jene, ob die Begründungsätze desselben selbst hypothetisch seien? (Selbstreferentielle Konsistenz). Wenn die These des hypothetischen Realismus (mit Falsifikationismus) nämlich hypothetisch ist, kann sie selbst falsifiziert werden, wenn sie nicht hypothetisch ist, wie kann ihre allgemeine Gültigkeit jenseits der Hypothetik begründet werden?
Lyre behandelt im weiteren auch die auf Quine zurückgehende These der Theorieunterbestimmtheit, wonach sich zu jeder gegebenen Menge von Beobachtungsdaten nicht nur eine, sondern immer mehrere, gegebenenfalls sogar unendlich viele Theorien finden lassen, die wenngleich empirisch äquivalent, so doch – selbst wiederum umstritten – ontologisch different sind.
Hier ist nach unserer Auffassung wiederum zu beachten, dass es überhaupt keine fixen Beobachtungsdaten gibt, sondern dass diese Daten durch die eingesetzten Theoriebegriffe konstitutiv präformiert und mitgeprägt sind. Wir erwähnten auch oben die Überlegungen Kanitschneiders zur Frage der Inkompatibilität verschiedener Beobachtungsdaten und mit ihnen verbundener Theorien.
Für unsere Untersuchung von besonderer Bedeutung sind etwa Lyres Überlegungen zu einer Apriori-Begründung der modernen Physik ( http://www.lyre.de/physapri.pdf ). Sie zeigen, dass die Frage weiterhin hochaktuell ist. Bei der Suche nach der Grundlegung der Notwendigkeit und Allgemeinheit unserer fundamentalen Naturgesetze ist offensichtlich, dass der hypothetische Realismus dies nicht leisten könnte. Nachdem Lyre u.E. erfreulich überzeugend die Mängel einer gegenüber dem kantischen Apriori "weicheren" Varianten in der Evolutionären Erkenntnistheorie und in der konstruktivistischen Wissenschaftstheorie bei Dingler und Lorenzen aufzeigt und die Relativierung des Kantschen Apriori des Raumes in der modernen Physik erwähnt, kommt er etwa zu folgenden Überlegungen:
"Es ist der Geltungsanspruch der Notwendigkeit und Allgemeinheit, der nicht abgewiesen werden kann, da er ja die Stärke des Apriorismus ausmacht: die wahren Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung können sich niemals empirisch als falsch erweisen – das wäre ein Widerspruch. Wir, die wir Erkenntnistheorie betreiben, unterliegen aber, wie alle menschliche Wissenschaft, sehr wohl möglichen Irrtümern. Man könnte dies als die inhärente Grenze des Apriorismus bezeichnen. Sie führt uns dazu, die dogmatische Inanspruchnahme der unbezweifelbaren Evidenz eines Apriori aufzugeben. Dennoch kann die Einheit der Physik möglich sein. Sie wird sich, einmal gefunden, als möglich erweisen auf der Basis von Naturgesetzen, die als wahre Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung notwendige und allgemeine Geltung beanspruchen dürfen. Beurteilen lässt sich dieses freilich immer erst im nachhinein auf der Basis des jeweils Erreichten – und dann auch niemals zweifelsfrei. Die bereits erreichte Einheit der Physik unterliegt der Möglichkeit historischer Irrtümer. Das heißt aber nicht, dass unsere wahren Naturgesetze bloße Hypothesen sind; sie sind immer wahre Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung. Wir können sie nur nicht mit Gewissheit kennen. Dies wäre ein Apriorismus in seinen inhärenten Grenzen, ein Apriorismus ohne Dogmatismus."[12]
Kritik: Auf diesem Wege die wahren Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung zu finden, erscheint deshalb problematisch, weil die Annahme, dass die jeweils letzten die "wahren" Bedingungen seien, eben die intendierte Verlässlichkeit nicht besitzt und daher hypothetischen Konstrukten sehr nahe kommt.
Lyre versucht
dann selbst den Begriff der Unterscheidbarkeit und den der
Zeitlichkeit als allgemeine apriorische Vorannahme begrifflicher
Erkenntnis einzuführen. (Wie sich zeigt sind mit dem Begriff der
Unterscheidbarkeit auch Begriffe wie "Ganzes", "unterscheidbare Teile" "Einzelbegriffe" die unter
einen "[(Ober-)
Begriff]" fallen und mit dem Begriff der Zeitlichkeit jene von
"Vergangenheit" und "Zukunft" verbunden). Er schließt den
Aufsatz mit dem als Motto über unserer Untersuchung stehenden Satz:
"Die wahren Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung werden eines Tages am Anfang einer abstrakten Begründungskette unserer fundamentalen Naturgesetze stehen. Zwar werden wir sie niemals zweifelsfrei kennen, doch sie werden durch keine Erfahrung mehr hintergehbar sein. Und wir sollten darauf gefasst sein, letzten Endes auf sehr abstrakt allgemeine Konzepte zu stoßen."
Kritik: Wenn auf Kant zurückgegriffen
wird, dann sollten alle seine von uns oben dargelegten Kategorien, die er
aus den Formen der Urteile herauspräparierte, untersucht werden, nicht nur Raum
und Zeit. Zum anderen wird auch hier wiederum Kants Verhältnis zu den Ideen
nicht untersucht. Die von Lyre vorgeschlagenen Apriori-_Begriffe
dürften übrigens unschwer auch aus
den Kategorien Kants präparierbar sein.
Wie die Kantkritik Krauses zeigte, ist die Apriorisierung Kants sowohl hinsichtlich der Kategorien, als auch hinsichtlich der Vorstellungen von Raum und Zeit selbst mangelhaft. Die Apriori-Begriffe, das "abstrakt-allgemeine Konzept" sind nur dann letzt-fundierbar, wenn sie als Ideen an oder in-unter der Göttlichen Wesenheit ableitbar sind. Für Kant war diese Begründbarkeit durch seine mangelhaften Ansichten über das Verhältnis von Verstandeskategorien zu den Ideen der Vernunft ausgeschlossen. Wir werden unten versuchen anzudeuten, welche wahre a priori Begründbarkeit von Logik, Mathematik, Sprache, Raum und Zeit sowie der Naturwissenschaft durch Göttliche Ideen möglich ist. Intuition im Rahmen bisheriger wissenschaftlicher Theoriebildung, Deduktion an und in unter der Göttlichen Wesenheit und Verbindung der beiden in Progression bilden die drei Erkenntnisschritte, mit denen auch die Naturwissenschaft sich zu immer tieferen Erkenntnissen vorarbeiten kann (Kapitel 4).
Lyre gelangt in einer anderen Untersuchung in der Frage der Oszillation zwischen Objekt und Subjekt zu interessanten Gedanken (http://www.lyre.de/nlq.pdf ). "Der Naturbegriff im Lichte der Quantentheorie". Lyre nimmt –anders als andere Physiker – an, dass die Quantentheorie universell gelte! Damit sollte, und könnte nicht nur das bisherige Objekt, sondern auch das Subjekt der Theorie unterworfen und damit verobjektiviert werden. Daher könnte man auch das Subjekt zum Objekt hinzuziehen. Mit dieser Verschiebung der Trennlinie sei jedoch nur dann eine sinnvolle Operation verbunden, falls es sich bei dem so entstandenen Gesamtobjekt um ein neues Objekt für ein neues Subjekt handelt. "Der ganzheitlichen Strenge kann aber nicht bis ins letzte Genüge getan werden, da dann kein Subjekt mehr übrigbleibt, für das die vom Objekt dargestellte Information noch Information wäre. In diesem Sinn ist das Subjekt irreduzibel".
Bemerkung: Im Sinne der Wesenlehre ist das Problem nur dann lösbar, wenn die Struktur aller Informationen transsubjektiv und transobjektiv an und in unter eine unendlichen und unbedingten ontischen göttlichen Essentialität als Ideen erkannt werden kann, wobei das endliche Subjekt auf endliche Weise diese unendlichen und unbedingten Ideen zu erkennen vermag und damit seine Subjektivität und die Objekte strukturell auf eine neue Weise erkennt, wobei infolge der Unendlichkeit aller Glieder natürlich die Naturwissenschaft auch dann eine unbeendbar weiter ausbaubare und vertiefbare Wissenschaft bleibt (Intuition, Deduktion und Verbindung der beiden in Konstruktion [Kapitel 4]). Dass aber auch ein Objekt unserer Erkenntnis – etwa die Natur – selbst wieder erkennendes Subjekt sein könnte, wird ebenfalls erst in diesen Zusammenhängen klärbar sein.
Schließlich zeigt Lyre auch, wie Einsteins Pendelschlag in die Empirie Probleme erzeugt, welche das Pendel wieder in Richtung auf apriorische Grundlagen zurückschlagen lässt. Wenn man sich wie Einstein in Richtung auf eine empirische Geometrie stützen will, kommt man letztlich ohne apriorische Elemente nicht aus. "Die Rolle apriorischer oder, wie es nun auch heißt, konventioneller Elemente zur empirischen Geometrie führt auf wichtige Fragestellungen." Er erwähnt dann die Probleme in der Diskussion um die Konventionalität der Gleichzeitigkeit in der SRT sowie die konventionalistischen Fragestellungen in der ART. "Denn unstrittigerweise gehen in die Beschreibung der empirischen Geometrie konventionelle Elemente ein. Knapp gesagt benötigt man zur Erfassung der empirischen Geometrie jeweils eine Zuordnungsdefinition zwischen einer rein mathematischen Abstandsrelation und einem physikalisch realisierten Längenmaßstab. Bei Transport eines solchen Maßstabs durch den Raum fordert man die Invarianz seiner Länge. Dies ist aber im Grunde nicht überprüfbar, denn man könnte ebenso gut behaupten, dass der Maßstab entlang seines Weges schrumpft oder wächst (und zwar derart, dass seine Länge bei Rückführung an den Ausgangspunkt – also bei Paralleltransport entlang einer geschlossenen Kurve – wieder in den Ausgangszustand zurückkehrt). Geschieht dies universell, so existiert offenkundig keine Möglichkeit eines empirischen Tests, denn alle Eichmaßstäbe sind ebenso betroffen. Das hat zur Folge, dass es keinen Sinn macht, von der Länge das Maßstabes an sich zu sprechen, und die "wahre" Geometrie daher unerkennbar ist."
Wie steht es nun mit der selbstreferentiellen Konsistenz unserer eigenen Sätze bezogen auf das vorgelegte neue Vernunftkonzept?
Alle Sätze dieser Arbeit gehören dem System der All-Sprache der Grundwissenschaft an, dessen Semantik durch die Erkenntnisse der Grundwissenschaft, dessen Syntax durch die All-Gliederung der Wesenheiten und Wesen an und in dem unendlichen und unbedingten Grundwesen und dessen Pragmatik durch die endliche Erkenntnis der Entwicklung der Menschheit nach der Lebenslehre der Grundwissenschaft bestimmt wird.
Diese Sätze sind so weit systeminvariant gegenüber allen bisherigen Kultur- und Sozialsystemen, dass sie in der Lage sind, Grundlage einer wissenschaftlichen, universellen Rationalität darzustellen, die ihrerseits universelle Prinzipien für Wissenschaft, Kunst und Sozialität im planetaren Sinne bilden kann.
Es kann hier der Einwand vorgebracht werden, das hier als neu festgestellte Grundsystem sei ja nur in unserer üblichen Sprache beschreibbar, setze also eine grüne Systemsprache, unsere Umgangssprache, voraus (pragmatisch-linguistisches Argument), diese Sätze müssten verstanden werden und setzen bereits wieder ein sozial vorgeformtes Sprachverständnis voraus (hermeneutischer Aspekt), kurz, die konsensual-kommunikative Rationalität Apels oder eine andere an der formalen Logik festgemachte Rationalität sei unhintergehbare Bedingung dieser Sätze. Dazu ist zu sagen: Diese Zeilen in einer grünen Systemsprache, einer systemmitbedingten Sprache abgefasst, sind Anleitung und Hinweis, bestimmte bereits nicht mehr der Sprache der jeweiligen Gesellschaft angehörende Erkenntnisse, Gedanken, anzuregen. Diese Sätze sind aber für die Erkenntnisse der Grundwissenschaft nicht konstitutiv und sie bedürfen auch zu ihrer Begründung nicht eines kommunikativen oder gar interkulturellen Konsenses. Wohl aber ist zur Einführung dieser Erkenntnisse erforderlich, dass es gelingt, sie in der Kommunikationsgemeinschaft aller Menschen und darin der theoretischen Physiker über kommunikativ-konsensuale Prozesse bekannt zu machen und die Gesellschaften nach ihren universalen Prinzipien weiterzubilden.
Die Antwort auf die Frage, wann einer Erkenntnis Wahrheit zukommt, ergibt sich zweifelsohne jeweils unterschiedlich aus den Grenzen, die man in den Erkenntnisschulen (1) bis (5) dem menschlichen Erkenntnisvermögen zu- oder abspricht. Es ist ein weiteres interessantes Phänomen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit, dass es heute bereits eine Vielzahl solcher Wahrheitstheorien gibt, die wir hier dem Namen nach aufführen, um dem Leser eine Vorstellung davon zu geben, wie unterschiedlich allein diese Frage in der Theorie über die menschliche Erkenntnis behandelt wird. In der modernen Physik werden nicht alle derselben Bedeutung besitzen.
Korrespondenztheorien (Abbildtheorien), Realistische Semantik, Abbildtheorie Wittgensteins im Tractatus, Freges Semantik, Korrespondenztheorie bei Russel, Korrespondenztheorien des Logischen Empirismus, Carnap'sche Methode der Extensionen und Intensionen, Carnaps Begriff der Verifizierbarkeit, Poppers Begriff der Falsifizierbarkeit (Fallibilitätstheorie), Carnaps Begriffe der Bestätigungsfähigkeit und Prüfbarkeit, Austins Korrespondenztheorie, Tarskis semantischer Wahrheitsbegriff, Kohärenztheorie des Logischen Empirismus, Redundanztheorie, Widerspiegelungstheorie des Dialektischen Materialismus mit Praxiskriterium und Annäherungstheorie, Evidenztheorien bei Brentano und Husserl, pragmatische Wahrheitstheorien, pragmatisch-semantische Theorie der Sprachphilosophie Wittgensteins, pragmatisch-linguistische Relativitätstheorie bei Humboldt, Sapir und Whorf, transzendental-pragmatische, kommunikationistische Annäherungstheorie bei Pierce und Apel, pragmatische Annäherungstheorie bei James, Intersubjektivitäts- und Konsenstheorie bei Kamlah und Lorenzen, diskursive Konsenstheorie bei Habermas, hermeneutisch-zirkuläre Annäherungstheorien, transpersonale Wahrheitstheorien, Begriff der Wahrheit bei Jaspers, transpersonal-psychologische Richtungen wie bei Jung, Maslow, Assagioli, Bucke usw., theosophische, pansophische und andere mystische Systeme, Wahrheitsbegriff nach dem System der Erkenntnisschule (5).
Auch hinsichtlich der Arten der Begriffe C, die wir bei unserer Erkenntnis ständig benutzen, können wir hier nur einige Andeutungen machen:
Eine Begriffstheorie, die wie in Figur 1 untersucht, welche Begriffe wir beim Aufbau der "Außenwelt" mit unseren Sinnen benutzen, ist ein eigener Teil der Erkenntnistheorie, den wir wiederum nach dem Erkenntnisstandpunkt der Erkenntnisschule (5) zusammenfassend hier anführen.
Die empirischen oder nebensinnlichen Begriffe, die ihren Inhalt der äußerlich-sinnlichen Erkenntnis mittels E, D(1) und D(2) entnehmen und im Inhalt nicht die Erfahrung übersteigen, bezeichnen wir als we. Man kann sie auch Mehrgemeinbegriffe nennen, weil sie uns nur bei Erkenntnissen von "Beobachtungen" dienen, wo wir schließen, dass das Beobachtete wohl auch an mehreren anderen so sein würde.[13] In diesem Bereich kann aber niemals eine Erkenntnis gefasst werden, wo wir zu Recht sagen könnten, diese Beobachtung gilt für alle x oder alle y in gleicher Weise.
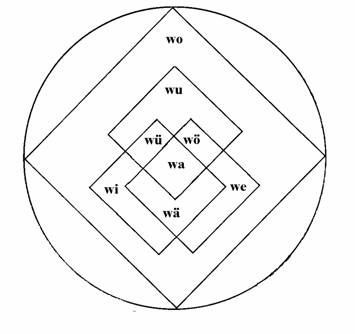
Der reine Allgemeinbegriff kann durch Schluss
aus der Erfahrung niemals
abgeleitet werden, weil die Erfahrung immer
endlich bleibt. Alle Hypothesen, Theorien und Modelle werden zumeist mit
Mehrgemeinbegriffen gebildet.[14] Die
LeserInnen erinnern sich an Lyres Überlegungen zu Poppers hypothetischem
Realismus.
Mehrgemeinbegriffe können aber selbst nur gebildet werden, indem erfahrungsunabhängige Begriffsgruppen wi (z. B. logische und mathematische Begriffe) benutzt werden. Die reinen Allgemeinbegriffe wi im Sinne der obigen Figur werden in der heutigen Wissenschaftstheorie noch nicht benutzt. Da sie aus der Erfahrung nicht gewonnen werden können, müssten sie deduktiv axiomatisch an oder in der göttlichen Wesenheit abgeleitet werden.
Der Urbegriff wu wäre als Überbegriff über wi und we zu erkennen, was stillschweigend in den meisten Erkenntnistheorien geschieht. Schließlich wäre wo der eine selbe, ganze Begriff, der wi und we in sich enthält und als wu mit ihnen verbunden ist.
Schließlich sei noch ein wichtiger Gedanke erwähnt. Nennen wir die "echten" Allgemeinbegriffe wi "C(1)", so müssen wir beachten, dass die empirischen Begriffe we nicht unmittelbar von jedem Menschen auf gleiche Weise gebildet werden, sondern dass durch die Erlernung einer Sprache S jeder Mensch ein System von sozial abhängigen Begriffen erwirbt, welches für den Engländer orange, den Österreicher grün und für den Türken blau ist. Je nach dem Einsatz dieser sozial abhängigen Begriffe erhält man eine unterschiedliche Erfahrung, eine andere Welt.
Schließlich möge hier noch daran erinnert werden, dass auch beim "wissenschaftlichen" Umgang mit Begriffen ständig die Phantasiekräfte in D(2) eingesetzt werden, um durch Umstellungen von Begriffssystemen neue Erkenntnisse mittels C, D und E zu gewinnen. Im Weiteren wird mit Begriffen über Begriffe gedacht (Reflexion auf die Begriffe unserer Erkenntnis).
Der Platz dieses Aufsatzes lässt es nicht zu, die erkenntnistheoretischen Details der Anleitung zur Gotteserkenntnis hier abzudrucken. Es können nur Skizzierungen erfolgen, die der Leser durch eigene Studien ergänzen müsste. Die in Anführungszeichen gesetzten Stellen sind Originalzitate aus Krauses Schriften, die hier in der alten Schreibweise wiedergegeben werden[15].
Im Sinne der skeptischen Haltung der modernen Naturwissenschaft zu einer wissenschaftlichen Gotteserkenntnis geht es also um die Frage der "Echtheit ontosemantischer Referenz der religiösen Aussagen, des Bezuges zu einer extramentalen Realität" (Ka 96, S. 130 f.). Kanitschneider meint, Rationalität sei auch in diesem Kontext unverzichtbar, um die Echtheit, d.h. den tatsächlichen semantischen Bezug dieser Aussagenklasse zu gewährleisten und sie deutlich von Halluzinationen bei Drogeneinnahme oder Wahnvorstellungen Geisteskranker zu trennen. Die Täuschungsmöglichkeit des menschlichen Erkenntnisvermögens sei deutlich. Kanitschneider fährt fort: Die uneinholbare Fehlbarkeit der Vernunft und die Unmöglichkeit, letzte, unbezweifelbare wahre Prinzipien zu finden, ergäben sich aus dem skeptischen Fallibilismus (logischer Empirismus, kritischer Rationalismus und chaotischer Anarchismus). Natürlich müssen diese Thesen um semantisch sinnvoll und vertretbar zu sein, selbst unbezweifelbare Grundsätze darstellen.
Es frägt sich u.E. aber auch, welche Rationalität als Richterin herangzogen werden darf. Wie wir sahen, gibt es eine Reihe von Rationalitätskonzepten (Postmoderne) und die Sematik der göttlichen Rationalität ist erst hier zu erschließen.
"Den rechten Anfang des Wissens kann nur machen ein schlechthin unmittelbar (absolut) gewisses Wissen, das selbst der Zweifler durch den Zweifel anerkennt; des wir gewiss sind, ohne an einen Grund davon zu denken; das keine andere Erkenntniss, oder schon fertige Wissenschaft, voraussetzt. – Nun behaupten Alle, sobald sie nach dem unbezweifelt Gewissen in ihrem Bewusstsein fragen, völlig gewiss zu wissen: von sich, von Andern ihres Gleichen, und von äusseren Objecten. Die Annahme aller dieser drei Erkenntnisse, als gewisser, ist allerdings Thatsache des Bewusstseins. Aber die Erkenntnisse bestimmter, individueller Geister als Menschen, und individueller Objecte, sind vermittelt durch die Sinne des Leibes; auch können selbige ebendeshalb bezweifelt werden, wie schon die Systeme der subjectiven Idealisten erweisen. Es bleibt also nur übrig zu untersuchen, ob die Selbsterkenntnis des Ich die als Anfang der Wissenschaft geforderte Erkenntniss seie. Daher entspringt die folgende Aufgabe" (38, S. 7 f.).
Hier gibt Krause einen Überblick über die Erkenntnisarten, die wir in Figur 1 und den Erläuterungen bereits ausführten.
"Aufgabe: Das Ich als erkennendes und denkendes Wesen analytisch zu erfassen.
Worterklärung: Erkennen wird hier ganz allgemein und allumfassend verstanden und von jeder Art der Gegenwart eines Wesentlichen im Bewusstsein; und ebenso Denken allgemein und allumfassend als die Thätigkeit, welche Erkenntniss jeder Art bildet.
Auflösung: 1) Begriff des Erkennens und Denkens. Erkennen ist eine Verhältniss-Wesenheit (ein wesentliches Verhältniss, eine relative Eigenschaft), und zwar einer bestimmten wesentlichen Vereinigung des Erkennenden und des Erkannten, wonach das erkannte Wesentliche als Selbständiges (Selbwesenliches) seiner Wesenheit nach vereint ist mit dem erkennenden Wesen, gleichfalls als selbständigem, und als ganzem Wesen, so dass auch in der Vereinigung die Selbständigkeit Beider besteht. Das Denken aber ist die Thätigkeit, welche, als unerlässliche Mitbedingung und Mitursache, dahin wirkt, dass jenes Verhältniss des Erkennens in der Zeit wirklich werde. Das Ich ist ewige Mitursache seines Erkennens, d. h. es ist Denkvermögen; es hat Trieb nach Erkenntniss, d. h. es ist sich inne, dass das Erkennen eine seiner inneren ewigen Wesenheiten ist, die zeitlich vollendet werden sollen, und es ist sich zugleich inne des Mangels seines in jeder Zeit wirklichen Erkennens; indem es nun den ewigen Zweckbegriff des vollendeten Erkennens erkennt, so ist es infolge des Urtriebes bestrebt, sein zeitlich wirkliches Erkennen jenem Zweckbegriffe gemäss stets weiterzubilden.
2) In Ansehung der inneren Mannigfalt unseres Erkennens und Denkens sind die Fragen zu beantworten: Was, als Was, und Wie erkennen und denken wir?
a) Ich erkenne und denke zunächst mich selbst und andere Vernunftwesen, die ich, wie mich selbst, in demselben Verhältnisse als Geister zu ihren Leibern in derselben leiblichen Welt (Natur) anerkenne; ich habe aber auch die Erkenntniss des einem jeden Ich Gemeinsamwesenlichen (den Begriff des Ich) und behaupte dessen Sachgültigkeit; sowie ferner den Gedanken einer unendlichen Gesammtheit aller Ich (des Reiches der Geister, der Gesammtheit aller endlichen Vernunftwesen), ob ich gleich in meinem gegenwärtigen, und in jedem endlichen Lebengebiete nur eine endliche Zahl als Menschen vereinter Geister geschichtlich kenne und anerkenne. Zweitens habe ich den Gedanken der Natur, als eines in seiner Art urganzen und selben Wesens, welches in sich unter andern auch alle organischen Leiber aller Geister ist und bildet. Drittens habe ich den Gedanken der Vereinwesenheit der Natur und des Vernunftreiches (der Vernunft) als Menschheit, welchen Gedanken ich auch als geschichtlich realisiert im endlichen Gebiete anerkenne. Endlich finde ich den Gedanken: unbedingtes, selbes, ganzes Wesen, das ist Gott, als über und vor jenen dreien und jeden andern etwa noch gedanklichen endlichen Wesen; ausser Welchem nichts, und welches Alles an, in, und durch sich ist, was ist. Es wird hier mehr nicht behauptet, als dass jeder Geist diesen Gedanken denken könne; die Frage, ob auch in Ansehung des Gedankens; Wesen, die Frage nach objectiver Gültigkeit Sinn habe, bleibt für die Folge zu untersuchen" (38, S. 21 ff.).
"c) Wir unterscheiden erstens die sinnliche Erkenntnis von der nichtsinnlichen, den sinnlichen Erkenntnissquell von dem nichtsinnlichen, oder, mit anderen Worten, Erkenntnis a priori durch das höhere Erkenntnisvermögen, von Erkenntnis a posteriori durch das niedere Erkenntnissvermögen. Hier wird unter: Sinn, das Wesen, oder auch bei leiblich sinnlicher Erkenntniss das Glied, selbst verstanden, dessen Wesenheiten und Bestimmtheiten erkannt werden. Nun finden wir ein Gebiet der Erkenntniss, bei welcher das Erkannte, und was daran erkannt wird, ein vollendet Endliches, durchaus Begrenztes und Bestimmtes, Zeitlichindividuelles ist (concretum, singulum, infinite et omnimode determinatum), wobei die Vorstellung als unmittelbar an der erkannten Sache seiend, und die erkannte Sache (das Object) als unmittelbar dem Geiste gegenwärtig, behauptet wird. Diese Erkenntniss heisst sinnliche Erkenntniss, und ist selbst eine doppelte, die leiblich-sinnliche, und die geistlich-sinnliche in Phantasie. Die erstere, sofern sie unmittelbar ist, finden wir beschränkt auf die Wahrnehmung der Zustände derjenigen Organe des Leibes, welche eben desshalb die Sinnglieder (organa sensus), oder wohl auch, weniger genau, die Sinne genannt werden. Diese leiblich-sinnliche Erkenntniss ist allerdings Anschauung, aber nicht sie allein, sondern auch die geistlich-sinnliche Erkenntniss ist Anschauung. An die unmittelbare leiblich-sinnliche Erkenntniss schliesst sich die mittelbare leiblich-sinnliche Erkenntniss an, welche, auf der Grundlage der ersteren, durch Nachbildung des äusserlich sinnlich unmittelbar Wahrgenommenen, in Phantasie, infolge nichtsinnlicher Erkenntniss, die darauf durch Urtheil und Schluss angewandt wird, zu Stande kommt; dahin gehört die ganze rein empirische Naturwissenschaft, und alle unsere individuelle Kenntniss von anderen Geistern sofern sie individuell sind. Die innerlich oder geistlich-sinnliche Erkenntniss in Phantasie nimmt den innern Gegenstand selbst unmittelbar wahr, ohne, wie bei der äusserlich-sinnlichen Erkenntnis, abhängig zu sein von der Vermittlung einzelner Organe; (und die Objecte der geistlich-sinnlichen Anschauung sind zum Theil zwar durch unsere frei nach Zweckbegriffen bildenden Thätigkeit, bestimmt, zum Theil aber werden sie uns auch als ohne unser Zuthun vorhanden gegeben, und ohne absichtliche Reflexion ins Bewusstsein aufgefasst.
Zweitens finden wir das Gebiet der nichtsinnlichen (metaphysischen) Erkenntniss, deren Gegenstand nicht als unendlich-individuell erkannt wird, also auch nicht in den Sinnen des Leibes, oder in der Welt der Phantasie gegeben sein kann, sofern derselbe auf nichtsinnliche Weise erkannt wird. Diese nichtsinnlichen Erkenntnisse sind theils Erkenntnisse vom Ich (immanente, ihrem Gegenstande nach rein subjective), theils von anderen Wesen und Wesenheiten ausser dem Ich (transiente, transcendente und transcendentale). – Insofern wir Nichtsinnliches wahrnehmen, schreiben wir uns inneren höheren Sinn oder: höheres Erkenntnissvermögen, zu. Da nun Erkenntnis als ein Verhältniss einer wesentlichen Vereinigung (Synthesis) zweier selbständiger Dinge erscheint, so ist die Frage, ob wir befugt sind anzunehmen, dass in Vorstellungen, deren Gegenstand als ausser dem Ich seiend in selbigem gedacht wird, dieser Gegenstand selbst dem Geiste gegenwärtig seie, und dass desshalb diese das Ich überschreitenden Vorstellungen dennoch objective Gültigkeit haben?
Solche nichtsinnliche, das Ich überschreitende Gedanken sind die vorhin unter a) aufgefundenen, besonders aber der Gedanke: Vernunft, Natur und Menschheit, und zuhöchst der Gedanke: Gott" (38, S. 23 ff.).
Im Folgenden wird in kurzen Zügen der Erkenntnisschritt ausgeführt, den wir als die essentialistische Wende bezeichnen wollen. Es geht um die für die Wissenschaft entscheidende Frage: Wie gelangen wir dazu, in Ansehung der transzendenten Gedanken ein allgemeines Kennzeichen der Wahrheit aufzufinden und anzuerkennen. Dies ist nur dann möglich, wenn wir durch die Frage nach dem Grund aller Gedanken dazu gelangen, einzusehen, dass auch der Grund nicht das Letzte der Erkenntnis sein kann, sondern dass auch der Grund nur eine Eigenschaft in der absoluten und unendlichen Essentialität sein kann, in der erst auch der Grund als eine Eigenschaft abzuleiten wäre. Wenn es für den Menschen nicht möglich ist, diese unendliche und absolute Essentialität zu erkennen, dann ist für ihn gewisse Wissenschaft eigentlich nicht möglich, weil er dann immer gleichsam in den Illusionen und Phantasmen dessen verbleiben müsste, was er sich in Jahrtausenden in der Wissenschaftsentwicklung durch Theoriebegriffe, die Phantasie und die "Informationen" seiner Sinne an Weltbildern erzeugt hat. Wir müssten in einander bekämpfenden und ablösenden, unterdrückenden und beherrschenden Verliesen der Relativität verharren und könnten auch das Ideal der Universalität der Menschheit nicht aufrechterhalten.
Im Folgenden wird diese Wende lediglich skizziert.[16]
"Wir wenden auf diese Erkenntnisse, sofern sie als Erkenntnisse ein Endliches, Bestimmtes sind, den selbst transcendenten, Gedanken des Grundes (der Causalität) an, und behaupten, dass Etwas der Grund sein müsse desjenigen, oben geschilderten Verhältnisses selbständiger Dinge, welches eben Erkenntniss ist. In Ansehung nun der Gedanken von Gegenständen, die ausser dem Ich seien, verhält sich der Geist, obgleich mitwirkend in freier Thätigkeit, doch auch empfangend (mit Spontaneität receptiv), und in diesem Gedanken erscheint ein Aeusseres mit dem Ich in Beziehung (sie sind synthetische Begriffe und Urtheile a priori). Dem Satze des Grundes zufolge, wonach der Grund immer das Ganze ist, dessen Inneres Besondere der Theil, als Begründetes, ist, kann nun das Ich nicht der Grund sein von transcendenten Gedanken, selbst abgesehen von der Frage nach der objectiven Gültigkeit derselben. Da wir aber, dem Satze des Grundes folgend, auch von diesen Erkenntnissen einen Grund annehmen müssen, so müssen wir behaupten, dass ein Wesentliches ausser dem Ich der Grund davon seie, dass Gegenstände ausser dem Ich von der erkennenden Selbstthätigkeit des Ich erfasst werden können. Und insonderheit der höchste Gedanke: unbedingtes Wesen, Gott, welches unbedingt-wesenlich, ganz, selbständig und Eines in unbedingter Daseinheit ist, – dieser Gedanke kann nur gedacht werden als begründet durch das unbedingte Wesen selbst, welches dieser Gedanke denkt; indem Gott gedacht wird als über und als überausser Allem, auch ausser dem Ich Daseienden, in seiner Art Bestimmten und Endlichen. Und da ebendesshalb Wesen, d. i. Gott, gedacht wird als Grund aller endlichen Wesen, das heisst, als alle Wesen und Wesenheit in sich, seiner unbedingten Wesenheit gemäss, seiend, so ist Gott zugleich gedacht als die in Ansehung des endlichen Ich äussere Ursache aller anderen transcendenten Erkenntniss, auch als die Ursache, dass andere in ihrer Art endliche Wesen ausser dem Ich, die Natur und andere Geister, mit dem Ich in demjenigen wesentlichen Vereine sind, dass sie sich dem Ich zu erkennen geben. Ja selbst das Ich, als ganzes Ich, und als erkennendes und denkendes Ich, wird erkannt als von Gott verursacht. Und weil ferner alle Wesen und Wesenheiten gedacht werden als in Gott durch Gott seiend, so ist zugleich mitgedacht, dass dem entsprechend aller Wesen und Wesenheiten Erkenntniss als Erkenntniss enthalten sei in und durch die Grunderkenntniss: Gott; es wird gedacht, dass der Gedanke Gott der Eine bleibende Grundgedanke auch meines ganzen Bewusstseins ist, dessen innere Ausführung mithin alle andere einzelne Gedanken sind.
Bei diesem Gedankengange hat uns indess der Begriff und der Satz vom Grunde nur als Anlass gedient, dass wir des Grundgedankens: Gott, soeben inne werden, keineswegs aber selbst als Grund dieser Erkenntniss (als Erkenntnissgrund Gottes); vielmehr wird in dem Grundgedanken: Gott, zugleich mitgedacht, dass derselbe, als das Ganze, auch in und unter sich enthalte den bestimmten, endlichen Gedanken vom Grunde. Der Satz des Grundes ist seinem Gehalte nach anwendbar auf sich selbst, als auch auf ein Endliches; nur in der Voraussetzung, dass der Grund, (die Ursachlichkeit), selbst Grund hat, können wir befugt sein, selbigen auf alles Endliche anzuwenden. Was aber Grund des Grundes sein soll, das wird selbst gedacht als ausser und über der Wesenheit, Grund und Begründetes zu sein, mithin selbst als unbegründet; weil bei einer Reihe von zu begründenden Gründen immer die Frage nach dem Grunde wiederkehrt. Als Grund des Grundes kann mithin nur gedacht werden das unbedingte Wesen, – Gott; dessen Gedanke also bei der Annahme der Gültigkeit des Satzes vom Grunde, ja sogar schon bei dem Gedanken des Grundes, als stillschweigend vorausgesetzt, sich findet; indem die Wesenheit: Grund und Begründetes zu sein, nur gedacht werden kann als nach ihrer Bestimmtheit enthalten in und unter der unbedingten Wesenheit Gottes, mit selbiger übereinstimmend, d. h. selbst nur als begründet durch Gott. Mithin beruht auch die Befugniss, den Satz des Grundes auf alles Endliche anzuwenden, in der Anerkennung Gottes. Der Gedanke: Gott, setzt dagegen die Gedanken: Grund, oder: Ich, oder was immer für einen Gedanken, keineswegs voraus; sondern alle diese Gedanken gehören wesentlich zu dem inneren Inhalte des Gedankens: Gott. Gott wird gedacht als vor und über Sich selbst, sofern Gott auch der Eine Grund alles Dessen ist, was Gott in sich selbst ist. Es hat keinen Sinn, nach dem Grunde Gottes zu fragen, und ein Beweis der Daseinheit Gottes, das ist, ein Beweis, dass Gott daseie, und dass der Gedanke Gott unbedingte Wahrheit und Gültigkeit habe, ist durchaus unmöglich. Desshalb aber ist dieser Gedanke, wenn derselbe anerkannt wird, nicht eine Vermuthung, ein Glauben, eine Meinung, sondern er ist nur anerkennbar als das unbedingte Wissen, die unbedingte Erkenntniss. Kann Gott gewusst werden, d. h. kann der Gedanke: Gott, unbedingtes Wesen, vom endlichen Geist als wahr anerkannt werden, so ist Wissenschaft nach ihrer ganzen Idee möglich, ausserdem nicht; denn obschon auch, noch ohne den Gedanken: Gott, anerkannt, ja sogar ohne selbigen ins Bewusstsein aufgenommen zu haben, endliche Erkenntniss mit dem Merkmale der Gewissheit möglich ist, eben weil alles endlich Erkennbare ein Wesenliches in Gott, mithin ein in seiner Eigenwesenheit Selbständiges ist: so ist doch alles solche Erkennen unvollendet, und unbefriedigt, weil der Geist, in Ahnung des Gedankens: Gott, der ewigen Wesenheit der Dinge zufolge, also unwillkürlich, nach dem Grunde alles endlichen Daseins und Erkennens fragt.
Alle unsre nichtsinnlichen Gedanken, sie mögen nun das Ich oder ein Wesenliches ausser dem Ich angehen, finden sich als untergeordnet enthalten in dem Einen unbedingten Gedanken des unbedingten Wesens, das ist, Gottes; und dieser Gedanke ist selbst nur zu denken, als im Ich durch das unbedingte Wesen verursacht; er ist keines Beweises fähig, denn selbst die Möglichkeit jeden Beweises ist erst in selbigem enthalten. Einen höheren Gedanken kann kein Wesen fassen; selbst das unbedingte Wesen wird gedacht als erkennend Sich selbst, und alle Wesen als in Ihm, nicht aber als ausser Ihm. Wir sind also mit diesem Gedanken angelangt auf der Höhe aller menschlichen Speculation, ja, sofern wir auf den Inhalt der Erkenntniss sehen, alles Erkennens überhaupt. Wenn dieser Gedanke als Wahrheit anerkannt wird, dann ist er als das Princip der Einen Wissenschaft anerkannt; und soll er anerkannt werden, so muss er als in sich selbst gewiss befunden werden, d. i. mit diesem Gedanken selbst muss dem Geiste gegeben sein die Überzeugung von seiner unbedingten, selben und ganzen, Einen Gültigkeit.
Es wird hier angenommen, dass Jeder, der an dieser Stelle der Selbstbetrachtung des Ich diesen Gedanken denkt, die Wahrheit und Gültigkeit desselben anerkenne, und dass mithin in der unbedingten Schauung: Wesen, das ist: Gott, oder, in der Wesenschauung (in der intellectualen Intuition des Absoluten) jene Grunderkenntniss gefunden seie, welche in der Einleitung als Princip der Wissenschaft gefordert wurde" (38, S. 25 ff.).
"Um uns selbst als Ich in unserem Verhältnisse zu Gott und Welt zu erkennen (zu orientiren), haben wir bereits zuförderst das Princip, aber auch einige Grunderkenntnisse auf unserem analytischen Wege gewonnen; denn wir haben gefunden und anerkannt:
1) die obersten Kategorien, als endlich und bedingt
realisiert an dem Ich, und
als unendlich und unbedingt an Wesen, als an dem
Princip; jedoch haben wir
die Kategorien noch nicht nach ihrer innern
Mannigfalt als einen Organismus erkannt, als welches erst im zweiten
Haupttheile[17] synthetisch geleistet werden kann; 2) haben
wir gefunden, dass Natur, Vernunft und Menschheit die höchsten
untergeordneten Wesen sind, die wir als in und unter Gott enthalten
anerkennen; ob aber zwischen selbigen und Gott noch höhere Wesen sein mögen,
welche wir nicht erkennen, das könnte selbst erst mittelst des Gliedbaues der
Kategorien entschieden werden, wenn es anders überhaupt möglich ist; 3)
haben wir als innere wesentliche Zustände des Ich das Erkennen, Empfinden und
Wollen, mit der Bestimmung der Endlichkeit, gefunden; auch gestatten es die oben
aufgestellten und in Selbstbeobachtung anerkannten rein übersinnlichen
Erklärungen dieser drei Wesenheiten, dass sie unbedingt, das ist, als
Wesenheiten Wesens, gedacht werden; jedoch die Gewissheit, ob wir
unbedingtes Erkennen, Empfinden und Wollen Gotte beizulegen befugt seien, kann
ebenfalls nur mittelst der synthetischen Einsicht in den Organismus der
Kategorien gewonnen werden.
Es ergeben sich also hier als die höchsten auf analytischem Wege findbaren Wahrheiten hinsichts des Verhältnisses des Ich zu Gott und Welt bloss folgende:
1) Gott ist in sich die Welt, als das Ganze aller in was immer für Hinsicht endlichen Wesen, aber Gott ist die Welt zugleich unter sich, und nach seiner Wesenheit, also (infolge der obigen Erklärung des Begriffes: Grund oder Ursache,) durch Ihn selbst; das ist: Gott ist die Ursache oder der Urgrund der Welt. Keineswegs aber kann gesagt werden: Gott ist die Welt, noch auch umgekehrt: die Welt oder irgend ein endliches Wesen ist Gott, oder: ist Gotte gleich. Wohl aber, wie weiter unten wird gezeigt werden, ist das endliche Wesen Gotte ähnlich. Hier sind die Wörter: in und unter, nicht ganzheitlich (mathematisch) zu verstehen, als wenn die Welt, und die Wesen der Welt ergänzende Theile von Gott wären; noch ist auch: in und unter, räumlich oder zeitlich zu verstehen, sondern: in und unter, bezeichnen das urwesenliche und ewige Verhältniss der Abhängigkeit der Wesenheit der Welt von der Wesenheit Gottes. Gott ist also nicht zuerst, nicht zuhöchst, nicht bloss die Welt; sondern Gott ist, als Urwesen, über der Welt, als über seinem eignen, von ihm als ganzem, selben Wesen unterschiedenen, Inneren. Sofern nun Gott, als Urwesen, über der Welt ist, ist Gott auch ausser der Welt, und die Welt insofern auch ausser Gott. Jedoch ist Gott nicht als selbes, ganzes Wesen ausser der Welt, und die Welt nicht außer Gott, als dem Einen selben, ganzen Wesen.
Mithin ist Wesen in sich, unter sich, und durch sich auch ich, und alle Ich, die ich ausser mir anerkenne, auch die Natur, welche sich mir in den Sinnen des Leibes offenbart, – sowie der Grund auch aller Lebenvereinigung. Diese endlichen Wesen der Welt sind insofern ausser Gott, als Gott als Urwesen, über ihnen ist; nicht aber ausser Gott als selbem, ganzem Wesen. Insofern aber, als wir Menschen in, und unter und durch Gott sind, ist Gott auch in uns; obgleich in keiner Hinsicht gesagt werden kann, dass Gott wir ist, noch: Dass wir Gott sind.
Anm. 1): Also gilt nicht umgekehrt: die Welt, oder ich, oder irgend ein Wesen der Welt, ist Gott; sondern bloss: alle sind in Gott, als endliche Wesen von Gott unterschieden, jedoch nicht von Gott ihrer Wesenheit nach losgetrennt und nicht ohne, noch ausser, der Beziehung der wesentlichen Abhängigkeit von Gott. Ohne die genauere wissenschaftliche Bestimmung können auch die Wörter: Theil und Glied, von dem Verhältnisse der endlichen Wesen zu Gott nicht gebraucht werden.
Anm. 2): Diese Lehre ist daher nicht Pantheismus, sondern demselben geradehin entgegengesetzt; denn sie lehret vielmehr: Nichts ist Gott, als allein Gott. Der Pantheismus lehrt dagegen: Alles und Jedes ist Gott, und betrachtet irrig Gott als ein Aggregat, oder Product der Wesen der Welt, und als identisch mit der Welt und die Welt als identisch mit Gott, das ist, als gottgleich, da sie doch bloss, als in, unter, und durch Gott, und als ausser Gott als Urwesen, seiend im Endlichen, gottähnlich ist.
Ich erkenne mich mithin als vollendet endliches Wesen in Gott, unter Gott, und durch Gott, und als ausser Gott, sofern Gott als Urwesen gedacht wird; und dass ich im Endlichen durch Gott von der Wesenheit Gottes, d. h. gottähnlich bin und sein soll, d. h. ich erkenne mich als von Gott verursachtes endliches Wesen. Mithin erkenne ich Gott an als den unbedingten Grund meiner ganzen Wesenheit, auch meiner ganzen Daseinheit, also auch als höchsten, einzigen zureichenden Grund meines ganzen Innern; mich selbst aber finde und erkenne ich nur als untergeordneten, endlichen, nächsten, mitverursachenden Grund meines eignen Innern. Und so ist hierdurch meine Grundschauung: Ich, mit ihrem ganzen Inhalte, in und durch die Wesenschauung (das Princip) weiterbestimmt, oder vielmehr gesteigert, gehoben und durchaus vollendet zu der Selbstschauung: Ich als endliches untergeordnetes Wesen in, unter, und durch Wesen, d. i. in, unter und durch Gott, und, sofern Gott Urwesen ist, ausser Gott. Ich finde nun mein Selbstbewusstsein als in, unter und durch mein Gottbewusstsein gegeben und bestehend.
Und da ich in, unter und durch Wesen bin, so entspringt für mich hieraus schon hier die Grundforderung: Gottes und meines Verhältnisses zu Gott stets inne zu sein in Erkennen und Denken, in Empfinden, im Wollen, und im ganzen Leben das ist die Forderung der Gottinnigkeit: zugleich auch die Forderung: mein selbst inne zu sein als in, unter und durch Gott, und in der genannten Hinsicht auch als ausser Gott, bestehenden und lebenden Wesens; so dass meine Selbstinnigkeit d.h. mein Selbstbewusstsein, mein Selbstgefühl, mein Selbstwollen in, unter und durch meine Gottinnigkeit seie und bestehe.
Anmerkung:
1) Diese Lehre von dem Verhältnisse Gottes und der Welt ist, geschichtlich ge-nommen, zum Theil neu, aber der darin erkannten Wahrheit nach, ewig; – sie löset den Zwiespalt der bisherigen sich entgegengesetzten Systeme, indem sie zeigt, dass die Welt zwar in Gott, unter Gott und durch Gott, aber zugleich in einer grundwesenlichen Hinsicht ausser Gott, und dass in eben dieser Hinsicht Gott ausser und über der Welt ist. Denn in ihr wird erkannt: dass Gott, als Urwesen, ausser und über der Welt, und von der Welt verschieden ist, – als selbständiges, selbstbewusstes, unendlich wissendes und heilig wollendes Urwesen ausser und über der Welt besteht und lebt, und über und in der Welt, als Vorsehung, waltet, und wirket.
2) Wer die
Wesenschauung einmal in ihrer unbedingten Wahrheit erkennt, von Dem wird sie,
und die darin gewonnene Selbsterkenntnis, zugleich eingesehen und anerkannt als
das Erste, Höchste und Beste alles seines Erkennens, und als Anfang, Mitte
und Ende aller Wissenschaft; – sie wird ihm unendlich lieb und werth; sie wird
das Leitende, Ordnende, Bewegende, das Beseelende und Begeis-ternde alles seines Denkens und
Dichtens, Empfindens und Strebens, Wollens und Thuns; – sie bewährt sich ihm als
das erwärmende, seine innerste Kraft erwecken-de
und stärkende Licht seines ganzen Wesens und Lebens" (38, 30 ff.).
Wir wollen nunmehr versuchen, die kategorialen Neuerungen der Grundwissenschaft zu explizieren, die sich aus der Einen, selben, ganzen, unendlichen und unbedingten Kategorie Wesen (Gott) und Wesenheit (Gottheit) ergeben. Dieser Organismus erfordert die Einführung einer neuen Sprache! Begriffe wie 'Ganzheit', 'Bestimmtheit', 'Gegenheit' usw. haben in diesem System völlig neue Bedeutungen! Eine vollwertige Analyse der Problematik ist mit Sicherheit nur durch ein Studium des II. Teiles der Vorlesungen über das System der Philosophie möglich (19 oder 69).
Wichtig ist bereits einleitend zu beachten, dass die deutsche Umgangssprache nicht ausreicht, um die hier entwickelten Erkenntnisse genau zu bezeichnen. Es müssen daher einige neue, klarere Bezeichnungen für das Erkannte, für das Gedachte eingeführt werden (z. B. "Or" für das Ungegenheitlich/Ganze/Eine, "ant" für das Gegenheitliche, "mäl" für das Vereinte, "Ab" für die Beziehung des Höheren zum Niederen, "Neb" für die Beziehung von Nebengliedern usw.). Da die hier deduzierten, abgeleiteten Begriffe im System (O) eine andere Bedeutung haben, als in der bisherigen Umgangssprache und den bisherigen Wissenschaftssprachen, werden sie in der Axiomatisierung (O) fett und mit höherem Schriftgrad geschrieben. Umgekehrt wird hier aber auch dazu angeregt, bisher überhaupt nicht gründlich genug Gedachtes erst einmal überhaupt zu denken.
(O 1) Was Wesen o AN sich ist
Von Wesen und Wesenheit und den besonderen Wesenheiten, welche Wesen an sich, das ist vor und über und ohne jeden inneren unterordnigen Gegensatz weset und ist.
 |
Wesen oder Gott als Inhalt der Wesenschauung (19 oder 69, S. 361 f.) ist auch der Inhalt der einen Aussage, das ist der Einen Kategorie. Der Fortgang der Wissenschaft kann nur an der Wesenschauung selbst genommen werden. Es ist also das zu erforschen, was Wesen an sich ist.
"AN" einem Wesentlichen ist, was von ihm ganz, durchaus gilt. "IN" einem Wesentlichen ist dasjenige Wesentliche, welches von ersterem ein Teil ist, und Gleichartiges des ersteren außer sich hat.
Geschaut wird was Wesen AN sich ist, also noch nicht, inwieweit Wesen vielleicht auch Teile usw. ist(O 1.1). AN Wesen o wird die Wesenheit go (in der FIGUR 2 go, gu, gi, ge usw.) erkannt. Wesenheit (essentia) wird unterschieden an Wesen; oder Gottheit wird unterschieden an Gott. Die Wesenheit aber ist hinsichts Wesens mit Wesen ganz Dasselbe (identisch). Nur endlicher Wesen Wesenheit als solche ist nicht mit dem endlichen Wesen Dasselbe (19 oder 69, 364 f.); denn sie haben ihre oiegne bestimmte Wesenheit zumtheil ausser sich, zumtheil in sich.
An der Wesenheit wird geschaut die Einheit oder Wesenheiteinheit (unitas essentiae),welche nicht mit der Einheit der Form oder der zahligen Einheit (unitas numeri) zu verwechseln ist (19 oder 69, S. 364).. Dass Wesen im weiteren (O 1.2) und (O 1.3) auch Zweiheit, Mehrheit, Vielheit, Vereinheit von mehreren Teilen usw. ist und hat, wird hier noch nicht erkannt. Die Einheit, die hier erkannt wird, ist eine ungegliederte, allen Teilheiten und Vielheiten "IN" Wesen übergeordnete Einheit, die wir der Genauigkeit wegen als OrEinheit (go) bezeichnen können.
(O 1.2) AN der Wesenheit als Wesenheiteinheit go werden erschaut als unterschiedene, entgegengesetzte, besondere Theilwesenheiten oder Einzelwesenheiten( als besondere Kategorien oder Momente) die Selbheit (Selbständigkeit) (gi) und die Ganzheit (ge).
Wenn unter Ableiten oder Deducieren, verstanden wird: an oder in der Wesenschauung erkennen, so ist schon die Wesenheit und die beiden Gegenwesenheiten derselben, Selbheit und Ganzheit an Wesen abgeleitet oder deduziert. Wird aber unter Ableiten oder Deducieren ,sowie unter Beweisen oder Demonstrieren, überhaupt ein mittelbares Erkennen eines Wesentlichen an oder in Wesen verstanden, so ist die Erkenntnis der Wesenheit nicht abgeleitet noch bewiesen, wohl aber die Selbheit und die Ganzheit, weil sie an der Wesenheit, und diese an Wesen ist. Wenn endlich unter Anbleiten oder Deducieren, und unter Beweisen oder Demonstriren die mittelbare Erkenntnis eines untergeordnete Wesenlichen irgend einer Stufe, in Wesen verstanden wird, so sind alle Wesenheiten, welche als an Wesen seyende erkannt werden, nicht abgeleitet noch bewiesen, nicht deducirt noch demonstrirt, sondern sie sind die Grundlage jeder Ableitung und Demonstration.
Jeder denkende Geist muss diese Grundwesenheiten der Wesenheit an ihnen selbst schauen (sie in absoluter Intuition percipiren). Der endliche Geist kann aber dazu aufgefordert werden, sie in ihrer ganzen Unbedingtheit zu schaun, indem ihm gezeigt wird, dass er auch sich selbst nach selbigen denkt. (19 oder 69 S. 171 f.).
Die Selbheit bezeichnet man üblicherweise mittelbarer und verneiniger Weise als Unbedingtheit, oder richtiger mit Unbedingheit (Absolutheit) und die Ganzheit mit Unendlichkeit infintias, infinitudo). Das Wort "Ganzheit" meint hier nicht eine Summe von Elementen, die zu einer Ganzheit zusammengefasst sind. (Diese finden sich erst in (O 1.2 und O 1.3.) Wesen o ist IN sich auch Summen von Teilen usw. Aber als Wesen o ist diese Verein–Ganzheit von Teilen noch nicht ersichtlich oder erkennbar. Diese Or–Ganzeit oder unendliche Ganzheit ist ein "über"geordneter Begriff. Das Wort "Selbheit" oder Absolutheit" meint, dass Wesen an sich ist, ohne irgend ein Verhältnis nach außen.
Wesenheiteinheit (go), Selbheit (gi) und Ganzheit (go) stehen in der Gliederung der FIGUR 2 zueinander. Für die Gliederung der Mathematik sind go, gi und ge die Grundaxiome. Für die Lehre von Gegensatz, Negation, positiven und negativen Zahlen sind es die Ableitungen IN go, für die Lehre von den Verhältnissen sind es die Ableitungen IN gi und für die Ganzheitslehre die Ableitungen IN ge. go und ge sind auch miteinander vereint und mit go als gu.
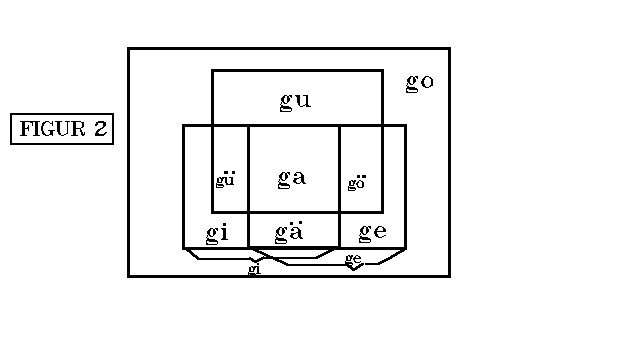
Die beiden Theilwesenheiten der Selbheit und der Ganzheit als Theilwesenheiten vereint, sind die Grundwesenheiten der Wesenheitvereinheit (die oberste Vereinkategorie) welche an sich sowohl die mit der Selbheit vereinte Ganzheit als auch die mit der Ganzheit vereinte Selbheit ist (19 oder 69, S. 368f.). Die Wesenheitvereinheit ist also auch die Vereinwesenheit der Unbedingheit und der Unendlichkeit.
Die Einheit der Wesenheit selbst in ihrem Unterschiede von ihren beiden Theilwesenheiten, der Selbheit und der Ganzheit und von der Wesenheitvereinheit, als über diesen Grundwesenheiten, ist die Ureinheit der Wesenheit oder die Wesenheitureinheit (19 oder 69, S. 368).
An der Wesenheit selbst zeigt sich ferner die Gegenheit der Gehaltwesenheit (materialen Wesenheit) und der Formwesenheit (formalen Wesenheit, Formheit), oder der Gegensatz des Gehaltes (der Materie) und der Form oder des Was und des Wie.
(O 1.2.1) Wie ist die Wesenheit-Einheit (go) und wie sind im weiteren gi, ge und alle Verbindungen Wesens als o in FIGUR 2? Die FORM der Wesenheit go ist Satzheit (gewöhnlich Gesetztheit, positio, thesis genannt) do, welche aber selbst ohne und vor aller Gegenheit oder Gegensatzheit ist und erkannt wird (19 oder 69, S.370 f.). Wesen o ist das eine Gesetzte, Positive. Hier AN Wesen o gibt es noch keine Negation, keinen Gegen–Satz usw. Wir bezeichnen diese Satzheit als Or-Satzheit.
Die Formheit oder Satzheit hat ebenfalls, wie die Wesenheit zwei Theilwesenheiten (zwei Theilkategorien als ihre Momente) an sich. Erstlich die Richtheit (Bezugheit, relatio, directio, dimensionalitas) als die Form oder Satzheit der Selbheit, welche auch mit den Wörtern zu, durch und für bezeichnet wird. In Ansehung Wesens selbst ist also die Richtheit die Form seiner Selbheit oder Unbedingheit (19 oder 69, S.371 f.)Die Form der Selbheit gi ist Richtheit di oder Bezugheit (Relationalität), aber auch hier gibt es nur die Eine Richtheit ohne noch ein Hin und Her oder sonstige einzelne Richtungen zu unterscheiden, also Or-Richtheit.
Zweitens die Faßheit (Befaßheit, Befassenheit, Umfangheit, ambitus, latitudo) als die Form oder Satzheit der Ganzheit; welche mit den Worten be, vor, um, ein (z.B. einschließen) bezeichnet wird. In Ansehung Wesens ist sie die Form seiner Ganzheit oder Unendlichkeit (19 oder 69, S. 372 f.). Die Form der Ganzheit ge ist Fassheit de ("um"fangen, befassen). AN Wesen wird noch nicht ein Um-fassen endlicher Ganzer erkannt, sondern dieses Fassen der Or-Ganzheit hat keine Endlichkeit (FIGUR 3).
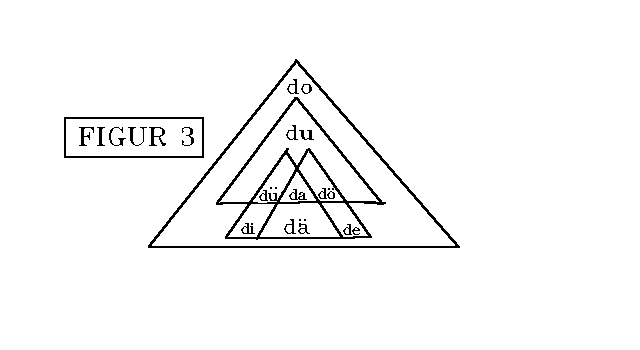
Die beiden Theilwesenheiten Richtheit und Faßheit als Theilwesenheiten der einen Formheit oder Satzheit vereint, sind die Grundwesenheit der Formvereinheit oder Satzvereinheit (Zahlvereinheit). In Ansehung Wesens ist die Formvereinheit die Form der Vereinheit seiner Selbheit und Ganzheit (19 oder 69, S. 372).
Die Einheit der Formheit oder Satzheit selbst in ihrem Unterschiede von ihren beiden Theilwesenheiten der Richtheit und der Faßheit und von der Formvereinheit oder Satzvereinheit als über diesen Grundwesenheiten ist die Ureinheit der Formheit oder Satzheit,- die Form-Ureinheit oder Satzheit-Ureinheit (19 oder 69, S. 372).
Auch die Wesenheit ist
zugleich an sich vereint mit ihrer Formheit oder Satzheit als satzige
Wesenheit oder gesetzter Wesenheit, und als diese ist die
Wesenheit an sich die Grundwesenheit oder Kategorie der Seinheit, Daseinheit oder Existenz;
und selbheitlich betrachtet das Sein, das Dasein, das Existieren.
Und Wesen selbst als satziges Wesen ist das seiende Wesen, oder kurz das
Seiende, Daseiende (19 oder 69, S. 373 bis 376).
An der Seinheit oder Daseinheit selbst wird unterschieden die Einheit der Seinheit, oder die Seinheit-Einheit. Die Seinheit oder Daseinheit ist an sich die beiden nebengegenheitlichen Grundwesenheiten, welche der Selbheit und der Ganzheit, sowie der Richtheit und der Faßheit als Vereinwesenheiten entsprechen; das ist Selbseinheit, Richtseinheit, oder Verhaltseinheit (Verhaltheit) oder Gehaltseinheit (Gehaltheit, Inhaltheit). Die beiden Theilwesenheiten der Verhaltseinheit und der Gehaltseinheit vereint sind die Grundwesenheit der Verein-Seinheit.
Wesen selbst ist an sich seine Wesenheit, das ist: Wesen ist sich seiner Wesenheit inne; oder: Weseninnesein ist eine Grundwesenheit Wesens. Und da sich diese Grundwesenheit auf die Eine, selbe, ganze Wesenheit bezieht, so ist sie selbst: das ungegenheitliche Weseninnesein, das Urweseninnesein, das Weseninnesein nach der Selbheit, das Weseninnesein nach der Ganzheit und das Weseninnesein nach der Vereinheit der Selbheit und der Ganzheit. Das Weseninnesein nach der Selbheit ist das Schauen, Erkennen, Wissen[18], das Weseninnesein nach der Ganzheit ist Fühlen, Empfinden. Wesen ist mithin sein selbst unbedingt, unendlich, ungegenheitlich inne, dann urwesenlich, dann in unbedingtem, unendlichem Schauen oder Erkennen und in unbedingtem, unendlichem Empfinden (der Seligkeit). Und in dem aus dem Erkennen und Empfinden vereinten unbedingten und unendlichen Selbstinnesein.- und da Gottes Selbstinnesein Gottes Eine, selbe und ganze Wesenheit befasst, ist Gott sich auch seines Selbstinnesein inne; also Gott schaut sein Schauen und sein Empfinden; Gott empfindet sein Schauen und sein Empfinden und so ferner. Und da außer Gott Nichts ist, sondern Gott alles was ist, an oder in sich ist, und Gott sein selbst ganz inne ist, so folgt, dass Gott auch allwissend und allempfindend ist.
(O 2) Was Wesen o IN sich ist
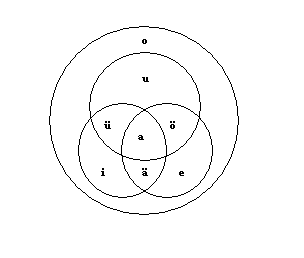
WESENGLIEDBAU
Wesen o ist IN sich zwei ihm als o untergeordnete und IN ihm selbst als Or-Wesen nebengegenheitliche Wesen Vernunft (Geistwesen) i und Natur (Leibwesen) e in obigem Schema. Diese beiden sind AN sich gleichwesentlich und sich darin neben-gegenheitlich, dass die eine von beiden ist, was die andere nicht ist und umgekehrt. Wesen o aber, sofern Wesen ÜBER sich selbst als die beiden nebengegenheitlichen entgegengesetzten Wesen i und e ist, ist Ur-Wesen u, von i und e unterschieden und insoweit ist Wesen o in sich ein doppelgliedriges AB-Gegenwesen. Wesen ist als u auch vereint mit den beiden Gegenwesen; mit Vernunft als ü und mit Natur als ö. Die beiden Neben-Gegenwesen sind ebenfalls miteinander vereint als Nebenvereinweisen ä worin die Menschheit das innerste Wesen ist. Wesen als Urwesen ist auch mit den Nebenvereinwesen von von Geist und Natur (mit ä) vereint (a) und in diesem Vereinvereinwesen ist auch Wesen als Urwesen vereint mit der Menschheit. Und Wesen ist der Wesengliedbau in Wesenheitgleicheit nur einmal . (Nähere Ausführungen unten).
(O 2.1) IN Wesen o in der ersten Gliederung sind nur 2 Wesen. Es gibt das Erste und das Zweite, das Zweite ist das Andere des Ersten. Das Erste ist, was das Zweite nicht ist und umgekehrt. Beide sind einander nebenentgegengesetzt, nebengegenheitlich, andererseits ist aber die Entgegengesetztheit der beiden gegen Wesen u eine Ab-gegenheit. Die Gegenheit der beiden Glieder gegen u ist also eine andere als die Gegenheit der beiden i und e gegeneinander. Wesen o ist IN sich beide. Man kann also nicht sagen, das Eine ist Wesen o und das Andere sind die beiden Nebenwesen i und e. Sondern es ist zu sagen: Wesen o ist In sich sowohl das Eine als auch das Andere. Unrichtig ist aber zu sagen: Wesen o ist beide. Daraus ergibt sich, dass die innere Gegenheit in Wesen o zwei Glieder hat. Es ist unmöglich anzunehmen, dass die innere Gegenheit nur ein Glied hätte. (Hier liegt z.B. ein wichtiger Unterschied zu Hegel, bei dem nämlich im Werden der Substanz in der 1.Negation nur ein Glied, nämlich das Dasein, das Äußere, die Natur, die Endlichkeit, das Anderssein, die Entfremdung wird.) Dadurch dass das eine der beiden Inwesen i nicht ist, was das andere ist, wird von Wesen o überhaupt nichts verneint. Dadurch, dass Wesen o in sich die beiden Wesen i und e ist, wird Wesen nicht zum Anderen, wird von ihm auch überhaupt nichts verneint. Weiterhin ist zu beachten, dass Wesen o, soweit Wesen ÜBER i und e ist, und erst in dieser Hinsicht eine Beziehung nach innen hat, in (O 1) aber, AN Wesen o solche Beziehungen nicht gegeben sind ( Es sei denn, man meint alle Beziehungen, die wir in (O 1) darlegten, diese Beziehungen sind Aber AN-Beziehungen.).
GLIEDBAU DER WESENHEIT
Auf gleiche Weise ist die Wesenheit Wesens der Eine Gliedbau der Wesenheit (der Wesenheitgliedbau, der Organismus der Kategorien) so dass die Eine Wesenheit ungegenheitlich, gegenheitlich und vereinheitlich (thetisch, antithetisch, synthetisch) ist.
Wenn statt Gegensatz gesagt wird: Gegenheit und statt subordinativ unterordnig oder abordnig statt coordinativ nebenordnig, statt cosubordinativ unternebenordnig und noch mehr, wenn statt ungegenheitlich, gegenheitlich und vereinheitlich gesagt wird: or, ant, mäl, so entspringt eine sehr kurze Kunstbenennung (Terminologie) der Grundwesenheiten.
(O 2.2) Die in (O 1.2) angeführten Begriffe der Wesenheit go und ihrer AN-Gliederung,
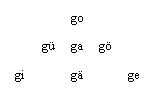
also Wesenheiteinheit, Selbeit und Ganzheit (FIGUR 2) erfahren bei der Gliederung Wesen o IN (O 2) durch die Glieder u und die beiden Glieder i und e ebenfalls eine Ab-Gegen-, Neben-Gegen- und Vereingliederung, die folgend darstellbar ist:
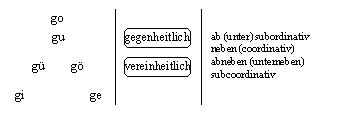
(O 2.2.1) Die Wesenheit go, erfährt in den beiden Gliedern i und e eine Veränderung. Die Neben-Gegen-Wesenheit der beiden Glieder ist ihre Artheit (Art, Qualität). In Wesen o ist zuerst einmal eine nur zweigliedrige Artheit: der qualitative Unterschied zwischen i und e.
(O 2.2.2) Für die beiden Nebengegen-Glieder i und e ergibt sich als Gegenheit der Selbheit (gi) die Verhaltheit, das Verhältnis. Sie stehen zueinander in einem Neben-Verhältnis, zu gu in einem Über-Unterverhältnis usw. AN Wesen o in (O 1) gibt es keine Gegen-Verhältnisse, sondern die Eine Selbheit, als Or-Selbheit. i verhält sich zu e in bestimmter Weise. Das Gegenselbe steht sich als ein Anderes wechselseitig entgegen, eines ist des anderen Objekt.
(O 2.2.3) Für die beiden Neben-Gegenglieder i und e ergibt sich als Gegenheit der Ganzheit (Or-Ganzheit Wesen o) die Teilheit. Das Gegenganze ist Teilheit. Wesen o ist IN sich zwei und nur zwei Teile i und e. Hier ist auch die höchste Grundlage des Mengenbegriffes gegeben. Man kann nicht sagen: Wesen o ist eine Menge, weil AN Wesen überhaupt keine Teilheit ist, wohl aber Wesen o ist IN sich in dieser ersten Gegenheit zwei und nur zwei Teile (Elemente). Wir unterscheiden aber die Ab-Teilung von der Neben-Teilung. Denn die untergegenheitlichen Teile nennt man Unter-Teile, (Ab-Ant-Ganze). In der Vereinigung ergibt sich das Vereinganze der Teile, die Erste Summenbildung von i und e.
Die Wesenheit ist also Gegenwesenheit und Vereinwesenheit. Die Gegenwesenheit ist selbst gegenheitlich und vereinheitlich als Abgegenwesenheit, Nebengegenweisenheit und Ab-Nebengegenwesenheit. Die Wesenheit als oberes Glied der Abgegenheit ist Urgegenwesenheit.Die Abgegenwesenheit ist eine doppelte, das ist die Urgegenwesenheit gegen die beiden Glieder der Nebengegenwesenheit. Die Gegenwesenheit wird Artheit (qualitas) genannt.
In der Grundwissenschaft des Wesengliedbaus ergibt sich hier die qualitative Nebengenheit zwischen Geist (i) und Natur(e). Auch hier zeigt sich wiederum der Unterschied zu Hegel, bei welchem die Natur (e) im Werden 1 der Substanz, in der Negation 1 als Entäußerung des Geistes als das sich wissende Absolute in die Natur wird ( als Dasein, Äußeres, Natur, das Bestimmte, die Endlichkeit, die Entfremdung, das Anderssein) und schließlich im Werden des Daseins, in der Negation 2, der Reflexion im Anderssein in sich selbst, als aufgehobener, in sich reflektierter Gegenstand in Aufhebung und Kampf zum Geist, Fürsich, Resultat und Ende wird.
(O 2.3). Auch hinsichtlich des Wie der Wesenheit usw. hinsichtlich der Begriffe der Formheit do usw. ergeben sich für die gegenheitlichen Glieder i und e neue Bestimmungen.
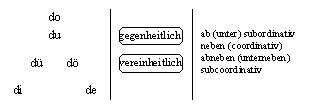
Unter (O 1.2.1) fanden wir, dass Wesen o Satzheit do hat. Hinsichtlich der Gliederung o, i, e, usw. ergibt sich hier Gegen-Satzheit und zwar wiederum Neben-Gegensatz zwischen i und e, Ab-Gegensatzheit zwischen u und i usw. Die Gegensatzheit ist die Bestimmtheit. Bestimmtheit ist also eine Teilwesenheit an der Satzheit als Gegensatzheit. i ist also gegen e bestimmt, aber auch u bestimmt e und i usw. Diese Gegensatzheit hat selbst auch eine Form. Die Or-Satzheit ist der Form nach ganz Jaheit, ohne Neinheit, also Or-Jaheit. Diese Jaheit ist nun selbst wiederum gegliedert
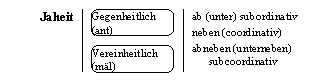
Statt der Or-Jaheit kann man sagen, die unendliche und unbedingte Positivität. Was die Gegen-Jaheit betrifft, so ist diese zugleich Gegen-Neinheit, entgegengesetzte Verneinheit (oppositive Negativität). Das Nein oder Nicht wird daher (nur bzw. erst) hier erkannt. Die Gegenneinheit ist nur an der Gegenjaheit. Dadurch dass i bestimmt ist als das Eine von zwei Wesentlichen, ist es auch zugleich bestimmt als nicht sein Anderes, sein Gegenheitliches, hier also e ist von ihm verneint. Das Nein ist also nur in einer Beziehung gegen ein Anderes. Durch die gegenseitige Teilverneinung i gegen e und umgekehrt, wird von der Unendlichkeit und Unbedingtheit Wesens o überhaupt nichts verneint. (Auch hier wieder ein wichtiger Unterschied zu Hegel, bei welchem sehr wohl im Werden der Substanz, in der Entäußerung des Geistes eine Negation derselben angenommen wird.) Hinsichtlich Wesens o ist das Nicht nicht. Die Bestimmtheit i gegen e besteht darin, dass es e ausschließt. Hier liegt die Grundlage der Wörter ja, nein, Nichts, des formal-logischen „ist nicht“. Zu beachten sind natürlich auch die Gegenjaheiten von Wesen u gegen i bzw. e (Unter-Gegen-Verneinung oder Ab-Ant-Verneinung).
(O 2.3.1) Auch die Satz-Einheit, an Wesen o, als unendliche und unbedingte Einheit der Satzheit (oder Zahleinheit), ist hier gegenheitlich zu finden als:
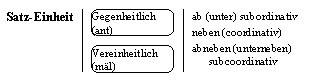
also Satz-Gegeneinheit, Satz-Vereinheit. Für die Zahl-Gegeneinheit wird das Wort Vielheit oder Mehrheit benützt. Zu beachten ist aber, dass hier noch keine Vielheit gegeben ist, die mehr als Zweiheit wäre (Gegeneinheit). Statt der Vereinzahlheit sagt man Allheit, Totalität, die aber hier nur aus zwei vereinten Gegen-Gliedern besteht. Von Wesen o gilt unbedingte und unendliche Zahleinheit, keine Vielheit, oder Mehrheit, keine Allheit. Wesen o ist IN/UNTER sich die Vielheit und das Viele, die Allheit und das All oder die Totalität, das Universum aller Glieder in sich. Jede ursprüngliche Vielheit in Wesen o ist eine Zweiheit, und jede Vereinzahlheit ursprünglich eine vereinte Zweiheit, da der Gegensatz, oder die nach Ja und Nein bestimmte Gegenheit nur zweigliedrig ist. Die unbestimmte Vielheit oder Vielzahligkeit ist hier noch nicht gegeben, z.B. die unendliche Vielzahligkeit 1,2,3,4,5, usw.
Hier liegen die Grundlagen der Zahlentheorie: die oberste Zahl ist die unendliche, unbedingte Eins (o). In ihr sind die beiden gegenheitlichen Zahlen i und e, die ebenfalls noch unendlich sind, aber gegeneinander begrenzt. Sie sind nicht mehr absolut, sondern gegeneinander und gegen u relativ. Hier liegen die Grundlagen der widerspruchsfreien Mengenlehre. Denn die beiden ersten „Mengen", INNEREN Elemente, von o sind i und e, beide selbst noch unendlich, aber bereits relativ.
(O 2.3.1.1) Die Form der Satzeinheit oder Zahleinheit ist die unendliche, unbedingte Jaheit. Die Jaheit ist dann selbst wiederum gegliedert wie unter (O 2.3). Daraus ergibt sich die Jaheit und Neinheit der Zahlheit, hier aber erst für die beiden Teile i und e. Hier findet sich die Grundlage der mathematischen Lehre von den Zahlen und Gegenzahlen (den positiven und negativen Zahlen).
(O 2.3.1.2) Auch die Richtheit di (als Form der Selbheit in O 1.2.1) erfährt hier weitere Bestimmung:
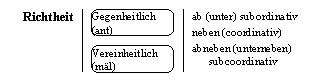
Hier wird die Gegenrichtheit erkannt. Weiters ist die Richtung von u nach i und e und umgekehrt von i nach u usw. zu erkennen. Anstatt Richtheit sagt man gewöhnlich Dimension, Erstreckung. Der Begriff der Richtheit ist für die Ausbildung der Mathematik (z.B. der Vektoralgebra) wichtig, bisher aber ungenau erkannt und entwickelt. Hier ist zu unterscheiden: die Eine Ganze Richtheit (Or-Richtheit di) Wesen o; die Neben-Gegenrichtheit an den Teilganzen i und e und andererseits die Ab-Gegenrichtheit u gegen i und e usw. Hier hat der Begriff der Richtheit noch nichts mit Zeit, Raum und Bewegung zu tun. (In der Umgangssprache wird Richtung ausgedrückt durch: hin und her, auf und ab, hinüber und herüber.)
(O 2.3.1.3) Auch die eine selbe ganze Fassheit de, als Form der Ganzheit erfährt hier Bestimmung.
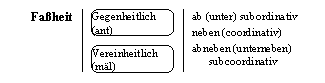
Wesen o hat „ungeteilte“ ganze Fassheit (Or-Fassheit), die beiden inneren Teile i und e haben Neben-Gegenfassheit, u hat gegen i und e Ab-Gegen-Fassheit, schließlich erkennen wir alle Vereinfassheiten. Auch hier kann man sagen, dass Wesen o ganze Fass-Jaheit hat, dass aber von i und e neben-wechselseitig Fassjaheit und Fassneinheit gilt. Denn i fasst das, was e nicht fasst und umgekehrt. Daraus ergibt sich das In-Sein und Außensein. e ist außer i und i ist außer e.
(O 2.3.1.3.1) An dieser Stelle müssen wir noch genauer fragen: Wie ist die FORM dieses In-und Außensein? Die Form dieses einander In- und Außenseins ist die Grenzheit. Grenzheit, Grenze ist also die Form des Gegenfassigen. Es ist also deutlich, dass An Wesen o keine Grenze ist, sondern dass erst in der ersten In-Teilung derselben, an i und e die Grenzheit erkannt wird. i und e haben daher eine gemeinsame Grenze.
(O 2.3.1.3.2) Fragen wir nun, was ist IN dem, was da ingefasst, eingefasst wird. Der Inhalt des Infassigen wird als groß oder Großheit bezeichnet. Damit Größe da sein kann, muss etwas innerhalb bestimmter Grenzheit bejahig befasst sein. Der Begriff der Großheit ist wiederum für die Mathematik grundlegend. Man hat daher die Mathematik oft irrtümlich auf die Größenlehre beschränkt. Hier wird aber gezeigt, dass die Mathematik viel mehr umfasst, und dass der Begriff der Großheit bisher auch nicht richtig erkannt wurde.
Betrachten wir das inbegrenzte Große, so erscheint die Grenze desselben als dessen Ende, als Endheit, oder umgekehrt als Anfang. Hier erkennen wir die Begriffe Endheit, Endlichkeit, und Un-Endlichkeit. Die Endlichkeit ist eine Bestimmung der Grenzheit, die Grenzheit wieder eine Bestimmung der Gegenfaßheit an der Großheit und mithin daher eine Bestimmung der Ganzheit als Gegenganzheit. Daraus zeigt sich, dass der Begriff der Endlichkeit nicht richtig gefunden wird, ohne die Begriffe der Einen, selben, ganzen Richtheit (di), der Faßheit (de) und der Ganzheit (ge). Von Wesen o kann nicht gesagt werden, dass Wesen an sich endlich ist, oder Grenze hat, sondern nur, dass Wesen ganz (organz) ist und in Wesens Ganzheit auch alle Endlichkeit und Grenzheit des Gegenganzen befasst ist.
(O 3) In der dritten Erkenntnis fassen wir zusammen, was bisher erkannt wurde, also was Wesen o AN und IN sich ist.
Es gilt: Wesen o ist AN sich und IN sich ein Organismus, heute würde man auch sagen eine Struktur. Die An-Gliederung und die Ingliederung wurden unter (O 1 und O 2) dargestellt.
(O 3.1) Dieser bisher dargestellte Gliedbau (Organismus, Struktur) Wesens o ist „voll"ständig. Hier ergibt sich die erste Erkenntnis hinsichtlich der Begriffe ALL-heit, Totalitiät. Diese Allheit ist aber nicht irgendeine unbestimmte verschwommene, sondern die Gliederung ist deutlich bestimmt.
(O 3.1.1) Aus dieser Gliederung ergibt sich auch, dass die Gegenheit nur zweigliedrig ist, denn es gibt keine anderen inneren Glieder Wesen o als i und e, und deren Jaheit und Gegenjaheit (Neinheit). Natürlich gibt es auch „noch endlichere“ Glieder in o, aber das wird sich erst im folgenden ergeben.
(O 3.1.2) Für diesen gegliederten Organismus gilt auch, dass alle hier entwickelten Begriffe aufeinander anzuwenden sind. So hat z.B. die Ganzheit (ge) auch Wesenheit, Selbheit und Gegenselbheit, also Verhaltheit, Ganzheit, sie hat eine bestimmte Form oder ist in bestimmter Grenzheit, gegenüber der Selbheit, usw. Wenn also derjenige Teil der Mathematik, der sich mit Größen beschäftigt, voll ausgebildet werden soll, dann muss an der unendlichen und nach innen absoluten Ganzheit (hier Or-Ganzheit Wesens o) begonnen werden, was bisher nicht geschehen ist. Ein anderer Zweig der Mathematik ergibt sich aber aus der Selbheit (gi) und Gegenselbheit (Verhaltheit, Verhältnis), wenn dieser Begriff nach allen anderen Begriffen durchbestimmt wird (z.B. die Lehre von den Proportionen usw.).
(O 4.1) Jeder der beiden Teile i und e in Wesen o (und auch die Vereinigung der beiden) ist selbst wiederum AN und IN sich Struktur, Organismus gemäß der Struktur (O 1-3), also hat selbst wieder eine Wesen o ähnliche Struktur.
Es gilt: Wie sich Wesen o zu u, i und e und deren Gegenheiten und Vereinheiten verhält, so verhält sich wiederum i zu dem, was es IN sich ist, usw...
(O 4.1.1) Die Form dieses Ähnlichkeitsverhältnisses ist die Stufung, Abstufung (Stufheit), wobei sich das unter (O 2.3.1.3) dargestellte Insein und Außensein nach innen fortsetzt.
Der Wesengliedbau und der Wesenheitgliedbau ist nach jedem seiner Teile selbst wiederum untergeordneter Teilwesengliedbau und Teilwesenheitgliedbau, wodruch die abwärts gehende Verhaltgleichheit gegeben wird. Wie sich verhält Wesen zu Wesengliedbau, so verhält sich jedes Glied des Wesengliedbaues der ersten Gliederung zu seinem inneren Wesengliedbau, also: wie sich verhält Wesen zu sich selbst als Urwesen, als Vernunft, als Natur und Vereinwesen der Vernunft und der Natur, so verhält sich ein jedes der vier Glieder wiederum zu dem, was es in sich ist. Sehen wir hier nun auf die Form welche sich in der soeben erschauten Wesenheit, das ist, an der erklärten Verhältnisgleichheit oder Proportion, findet, so ist diese Form die der Stufheit, oder Abstufung (gradualitas oder potentialitas), wonach dasselbe Verhältnis des Inseins nach innen wiederholt wird. Alle Wesen sind Potenzen des Absoluten (Wesens o) und alle Wesenheiten Potenzen der absoluten Wesenheit (go).
(O 4.1.4) An diesen endlichen Gliedern (Elementen) in/unter o ist nun in zweifacher Hinsicht Unendlichkeit.
1. In den Gliedern i, e und ihrer Vereinigung gibt es jeweils unendlich viele unendlich endliche Elemente (a1..,b1..,c1..).
2. Jedes unendlich endliche Glied a1, usw. ist selbst weiter unendlich teilbar und bestimmbar.
(O 4.1.5) Das Endliche, Bestimmte oder Individuelle jeder Art und Stufe ist also nicht isoliert, gleichsam losgetrennt von dem, was neben und außer, bzw. über ihm ist (z.B. a1 von o), es ist in/unter seinem höheren Ganzen und mit ihm vereint, wie auch mit den Nebengliedern. Die Teile bleiben daher sowohl mit dem höheren Ganzen als auch mit den Nebengliedern korelliert, was etwa in der Quantenphysik wichtig ist. Eben weil die hier dargestellten ontologischen,logischen und sematischen Beziehungen bisher nicht erkannt wurden, entstehen typische Probleme in der Interpreatation der Quantentheorie.
(O 4.1.5.1) Aus den bisherigen inneren Gliederungen der Wesens o ergeben sich nun folgende weitere axiomatische Folgerungen:
Die Stufung der Grenzheit und die Großheit sind nun mit der Selbheit und der Gegen-Selbheit, also der Verhaltheit verbunden (vereint). Die allgemeine Lehre von der Verhaltheit (von den Verhältnissen) begreift in sich Verhältnis, Verhältnisgleichheit (Analogie, Proportion), Verhältnis-Ungleichheit (Disproportion), Verhältnisreihe (Progression), nach gleichen oder ungleichen Verhältnissen; die ersten Reihen sind Gleichverhaltreihen oder Verhaltstufreihen (Potenzreihen). Hinsichtlich der Verhältnisgleichheit zeigt die reine Selbheitlehre zwei Grundoperationen: zu einen gegebenen Musterverhalte und einem gegebenen Hinterglied das gleichverhaltige Vorderglied zu finden; oder: zu einem gegebenen Vorderglied das gleichverhaltige Hinterglied zu finden. Auf die Ganzheit angewandt sind dies das Multiplizieren (Vorgliedbilden) und Dividieren (Nachgliedbilden).
(O 4.1.5.2) Ferner entsteht hier das grenzheitsstufliche Verhältnis, also das Verhältnis von Ganzen, die zu verschiedenen Stufen der Grenzheit gehören, als auch grenzheitsstufliche Verhältnisgleichheit, Verhältnis-Ungleichheit und Verhältnisreihe. Auch die analogen Axiome hinsichtlich der Verhältnisse von solchen Ganzen, die innerhalb einer und der selben Stufe der Grenzheit enthalten sind.
Die Erkenntnis der Stufen der Grenzheit ist von besonderer Wichtigkeit für die neuen Grundlagen der Logik und Mathematik.
Anhand der Arten der Räume wollen wir daher die Bedeutung der Stufen der Grenzheit näher zu erklären versuchen:
1. Räume
Der unendliche und unbedingte Raum o (Or-Raum) ist in allen drei Richtungen unendlich, hat also keine Grenzheit hinsichtlich der Richtheit. Der Räume i und e in Zeichnung 1, haben ebenfalls hinsichtlich keiner Richtung eine Grenze, sind also auch in alle drei Richtungen unendlich. Wenn auch die Richtung dä in zwei Hälften zerfällt, so ist doch das halbe dä in Richtung i unendlich lange, wie auch in Richtung e. Die Räume i und e haben daher die selbe Grenzheitstufe, wie der Raum o (Or-Raum).
Die nächste Grenzheitstufe des Raumes in sich ist durch zwei unendliche rote Flächen als Grenzen bestimmt, wie in Zeichnung 2 dargestellt. Der Raum zwischen den roten Fläche X1 und X2 ist daher nur mehr in 2 Richtungen unendlich, in einer Richtung aber endlich. Dieser Raum G ist hinsichtlich der Grenzheitstufe von den Räumen i und e sowie dem Or-Raum o artheitlich unterschieden. Zu beachten ist, dass ein solcher Raum sowohl in i als auch in e als auch in beiden sein kann.
Die nächste innere Art der Grenzstufheit der Räume ist dadurch gegeben, dass in einer zweiten Richtung Endlichkeit gegeben ist. In Zeichnung 3 ist eine unendlich lange, viereckige Säule gegeben, die durch die unendlichen roten Flächen X1, X2 und die unendlichen grünen Flächen Y1, Y2 begrenzt ist. Auch hinsichtlich der Richtung de ist nun Grenzheit gegeben, hinsichtlich di aber immer noch Unendlichkeit. Auch ein solcher Raum kann in i, e oder in beiden gelegen sein.
Schließlich ist noch eine dritte Art der Grenzheitstufung des Raumes zu erkennen, wenn nämlich in allen drei Richtungen Endlichkeit gegeben ist, wie in Zeichnung 4, wo durch die Begrenzung der endlichen roten Flächen X1, X2, endlichen grünen Flächen Y1, Y2 und endlichen blauen Flächen Z1, Z2 ein Würfel oder Quader entsteht. Endlicher kann ein Raum nicht mehr werden. Er ist unendlich endlich. Der Raum hat also in sich 3 Arten von In-Räumen.
2.Flächen
Fläche gilt als Raum ohne Tiefe. (Nicht im Sinne nicht-euklidischer Geometrien, für welche natürlich modifizierte Regelungen gelten, hinsichtlich der Frage der inneren Grenzheitstufen aber die gleichen Kategorien modifiziert Anwendung finden müssen.) Im üblichen Sinne ist daher Fläche definiert als Raum mit zwei Dimensionen. Auch hier gilt wieder, dass bei der ersten In-Gliederung der unendlichen Fläche in Zeichnung 1 durch die Linie di zwei Teile der Fläche entstehen, die jeweils den oberen Teil der Richtung de und den unteren Teil derselben befassen, dass aber in der Richtung de keine Grenzheitstufe der Fläche gegeben ist, weil de in beide Richtungen noch unendlich lange ist.
Erst wenn, wie in Zeichnung 5 durch zwei Linien m1 und m2 die Richtung de endlich wird, z.B. 3 cm lang, entsteht eine Fläche mit der ersten inneren Grenzheitstufe der Fläche, eine Fläche also, die in der Art von der unendlichen Fläche und den beiden Hälften derselben unterschieden ist. Die Fläche M ist nur mehr in einer Richtung unendlich. Die Fläche hat aber noch eine weitere innere Grenzheitstufe, die in Zeichnung 6 dargestellt ist. Wird auch die Richtung di endlich, durch die beiden Geraden n1 und n2, entsteht eine in jeder Richtung endliche Fläche. Die Fläche hat also in sich zwei Arten von In-Flächen, die nach der Stufung der Grenzheit unterschieden sind.
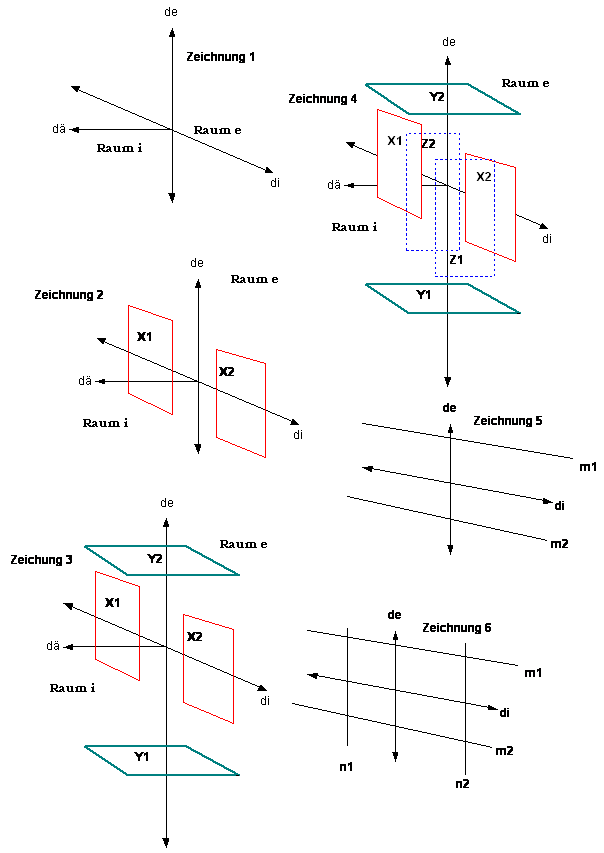
3. Linie
Hinsichtlich der Linie und ihren Grenzheitstufen sind folgende Deduktionen zu beachten:
Betrachten wir die Linie (1), so ist sie eine unendlich lange, gerade Linie o.
Nun blicken wir auf die Linie (2), die schon in der Linie (1) ist. Sie zeigt uns, was die Linie (1) in sich ist. Die Linie (1) ist in sich zwei und nur zwei Linien, i und e, die beide noch unendlich lang, aber doch insoweit gegenheitlich sind, als die eine ist, was die andere nicht ist und umgekehrt, das heißt, sie verneinen und begrenzen einander teilweise. Jede der beiden ist zwar noch unendlich lang, aber der Punkt x ist ihre Grenze gegeneinander.
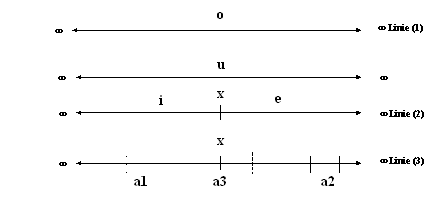
Hier in dieser ersten Ableitung der Linie (1) nach innen erkennen wir, dass es in der ersten Ableitung nach innen, wenn man von einem unendlichen Ganzen ausgeht, nur zwei Glieder gibt, die beide noch unendlich sind. Die beiden Linien haben daher die gleiche Grenzheitstufe, wie die Linie o. Wir sehen weiter, dass hier eine Neben-Gegen-Verneinung von i und e entsteht, wodurch aber die Linie (1) in keiner Weise negiert wird. Was heißt der Begriff Neben-Gegen-Verneinung? Die Linie i ist neben der Linie e, aber die eine ist, was die andere nicht ist und umgekehrt. Betrachten wir jetzt die Linie (1) mit der Linie (2) in Verbindung, so wird sichtbar, dass die Linie (1) als Ur-Linie über i und e steht und mit beiden verbunden ist. Als Ur-Linie ist die Linie (1) über beiden, die beiden sind unter ihr.
Die Linie (3) zeigt die zweite Stufe der Ableitung nach innen. Wir sehen, dass es in der Welt der Linie (1), in der zweiten Stufe nach innen, neue Arten von Linien gibt. Auf der Linie i gibt es unendlich viele Linien (a1, b1 usw.). Auf der Linie e gibt es unendlich viele Linien (a2, b2 usw.). Es gibt jedoch auch unendlich viele Linien, die sowohl auf i als auch auf e liegen (a3, b3 usw.).Diese beidseitig begrenzten Linien gehören daher einer neuen Art von Linien an, die bilden die letzte Grenzheitstufe der Linie nach innen. Begrenzter, als auf beiden Seiten begrenzt, kann eine Linie nicht sein.
Die hier abgeleiteten inneren Strukuren der Theorie des Raumes müssen mit den bisherigen anderen Raumtheorien, die besonders in der Physik benützt werden und die etwa in (Ly 04, S. 24 f. und 142 f.) behandelt werden, in Beziehung gebracht werden. Diesbezüglich werden weiter unten einige Bemerkungen eingefügt.
(O 4.1.5.3) Hier ergeben sich nun zwei in der bisherigen Mathematik und Mengenlehre nicht beachtete wichtige Folgerungen:
Jede selbganzwesenliche also unendliche und ansich unbedingte Einheit jeder Art und Stufe (hier Wesen o) ist in/unter sich unendlich viele Einheiten der nächstniederen Grenzheitsstufe und so ferner bis zur untersten Grundstufe. Diese Grundstufe ist nach allen Richtheiten (Strecken, Dimensionen) endlich, und besteht selbst wiederum aus unendlich vielen Einheiten dieser untersten Stufe. Jede jedstufige unendliche Einheit besteht aus unendlich vielen unendlich endlichen Einheiten der untersten Stufe.
(O 4.1.5.4) Hier zeigt sich auch der Grundbegriff der unendlichen Vielheit und darin der unbestimmten Vielheit oder der unendlichen und darin der unbestimmten Zahlheit, wobei ein Unendlich-Ganzes des Gleichartigen vorausgesetzt wird, worin innerhalb vollendet bestimmter Grenze, die endliche Einheit der Unendlichkeit des Ganzen wegen, willkürlich angenommen wird.
(O 4.1.5.4.1) Hierauf beruht die mathematische Voraussetzung, dass die Zahlenreihe 1,2,3,.. und so fort unendlich ist und dass auch wiederum an jeder Zahl die ganze Zahlenreihe darstellbar ist, durch Zweiteilung, Dreiteilung, Vierteilung usw. ohne Ende. Diese hier bewiesene, unendliche und unbestimmte Vielheit, als Grundaxiom der allgemeinen Zahlheitlehre (Arithmetik und Analysis) ist wiederum eine doppelte. Einmal die unendliche Artvielheit oder Artzahlheit von Einheiten, welche artverschieden sind, oder die Zahlheit der diskreten Zahlen. (Dies ergibt sich aus dem obigen Satz O 4.1.5.3)
Hier zeigt sich aber zum anderen auch die unendliche stetige Zahlheit, oder Stetzahlheit an Einheiten, welche in ihrem stetigen Ganzen selbst binnen bestimmbarer Grenze stetig und unendlich teilbar sind. Dies ergibt sich aus: Alles Stetige, Wesenheitgleiche ist in sich unendlich bestimmbar und teilbar. Die Lehre von der Artzahlheit ist übrigens von der Stetzahlheit zu unterscheiden. Hieraus ergeben sich wichtige Axiome für die Frage des Kontinuums.
(O 4.1.5.4.2) Im weiteren ergibt sich hieraus das Axiom der stetigen Großheit, und der stetigen Größen: unendliche Teilbarkeit, unendliche Vielmaligkeit jedes Endlichen in seinem Unendlichen der nächsthöheren Stufe; die Gegenrichtheit hinsichtlich der Richtheit (Strecke, Dimension), das ist die Lehre von den gegenrichtheitlichen Größen, den positiven und negativen Größen. Ferner die Axiome der Stetgroßheit und der Stetgrößen nach der SELBHEIT und der VERHALTHEIT. Denn es ist eine Größe entweder eine selbheitliche Größe (Selbgröße; absolute Größe) oder eine verhaltliche Größe (gegenselbheitliche Größe), Verhaltgröße, relative Größe, welche hinsichtlich der mit ihr verglichenen Größe groß oder klein ist. Die Größeverhaltheit ist selbst wiederum eine der Gegenselbheit (ein arithmetisches Verhältnis oder Restverhältnis) oder eine der Vereinselbheit, darunter auch der Vielheit (ein sogenanntes geometrisches Verhältnis). Das gleiche gilt von der Verhaltheit hinsichtlich der Stetgroßheit.
(O 4.1.5.4.3) Alle Größen der selben Grenzheitsstufe stehen zu einer jeden beliebigen Größe der gleichen Grenzheitsstufe in einem bestimmten Größenverhältnis, welche letztere, wenn sie das bestimmende Glied jedes Verhältnisses ist, die Grundeinheit oder absolute Einheit genannt wird. (z. B. Verhältnis 1 zu 3 oder 3 zu 1 usw.) Jedes Verhältnis der Ungleichheit ist diesseits oder jenseits des Verhältnisses 1..1, und zwar entweder eines der größeren Ungleichheit z.B. 3 zu 1 oder der kleineren Ungleichheit z.B. 1 zu 3. [vgl. auch vorne unter (O 4.1.5.1) die Grundoperationen des Multiplizierens und Dividierens].
(O 4.1.5.4.4) Rein nach der Grundwesenheit der Selbheit sind an dem Stetgroßen folgende Operationen gegeben: Addition und Subtraktion, indem entweder aus den Teilen das Teilganze oder aus einem oder mehreren Teilen des Teilganzen der andere Teil (der Rest) bestimmt wird.
(O 4.1.5.4.5) Die Verhaltheit der Stetgrößen ist selbst artgegenheitlich (qualitativ) verschieden. Denn sie ist, wie alles Endliche, Bestimmte selbst nach Unendlichkeit und Endlichkeit bestimmt. Daher ist jedes geometrische Verhältnis zweier Stetgrößen entweder ein unendliches oder ein endliches. Ersteres, wenn keine gemeinsame Einheit diese beide Glieder misst, das Verhältnis also unzahlig oder unwechselmeßbar (irrational und inkommensurabel) ist, letzteres, wenn beide Glieder von derselben Einheit gemessen werden, das Verhältnis also zahlig und wechselmeßbar ist.
(O 4.1.5.5) Für die Begründung einer antinomienfreien Mengenlehre ist folgender Satz fundamental: Ein jedes Glied, ein jeder Teil einer bestimmten Grenzheitsstufe hat zu dem ihm übergeordneten Ganzen der nächsthöheren Grenzheitsstufe überhaupt kein Verhältnis der Großheit oder endlichen Vielheit. Man kann also nicht sagen: Wesen o oder i sind größer als endliche Glieder in ihnen. Wir haben zu beachten: Es gibt die Zahl, „Or-Größe“ Wesen o, dann die beiden In-Größen i und e, und schließlich die unendlich endlichen Größen wie z.B. Menschen oder Pflanzen. (Zur Überwindung der Antinomien der Mengenlehre siehe unten).
(O 5) Das Werden
Die beiden In-Wesen in Gott, nämlich i und e, sind jede in ihrer Art unendlich, aber in ihrer Unendlichkeit im Innern unendlich bestimmt, das ist vollendet endlich und zwar insbesondere als diese beiden Teile in o; das ist, sie sind in sich eine unendliche Zahl vollendet endlicher, nach allen Wesenheiten bestimmter, Einzelwesen (O 4.1.2 ), denen wiederum alle Kategorien auf vollendet endliche Weise zukommen, und die in, mit und durcheinander zugleich in ihrem unendlichen Ganzen, von i und e sind.
Da i und e in o, durch o, nach ihrer ganzen Wesenheit vereint sind, so sind sie es auch, sofern sie die beiden entgegenstehenden Reihen vollendet endlicher Wesen in sich sind und enthalten; so dass diese beiden Reihen vereint sind. Es sind dies die unendlich vielen Wesen, die sowohl in i als auch in e sind. Darin gibt es wieder einen Typ unendlich vieler Wesen, die Menschen, welche im innersten Vereinwesen von i und e nämlich a in a sind. Die vollendet endlichen Wesen in i und e und deren Vereinigung haben unendlich viele Zustände in sich.
Der vollendet endlichen Zustände sind unendlich viele, weil auch die Wesenheit des Endlichen, als solche, wiederum unendlich ist (siehe O 4.1.4); und nur alle diese Zustände, alle zugleich sind die ganze, vollendet endliche Wesenheit dieses unendlich-endlichen Wesens, deren Zustände sie sind. Gleichwohl schließen sich alle diese vollendet endlichen Zustände an demselben Wesenlichen wechselseitig aus, da sie mit unendlicher Bestimmtheit alles Andere nicht sind. Also ist das vollendet endliche Wesen (z.B. Pflanze oder Mensch) beides zugleich, das ist, alle seine Zustände, und doch nur auf einmal ein jeder von diesen Zuständen einzeln; das ist: sie ist in steter Änderung nach der Form der Zeit, sie ist ein stetiges Werden.
Aus (69, S. 473f.) Fünfzehnter Lehrsatz: Jede Wesenheit hat bestimmte Form, folglich auch die jetzt erkannte Grundwesenheit, wonach Wesen in sich vollwesenlich, alle sich ausschließende unendlich-endliche Bestimmtheit ist. Dies hiermit deduzierte Form entspricht der in der Selbeigenschauung intuitiv bereits im analytischen Teile erfassten Form Zeit. Es ist also die Zeit die Form, dass alle sich ausschließende unendlich-endliche Bestimmtheit an demselben Wesenlichen, dem Gliedbau der Wesenheiten gemäß , zusammen sei; indem das, was nicht zugleich sein kann, nacheinander ist und aufeinander folgt. Da nun jede Form derjenigen Wesenheit deren Form sie ist, gemäß ist, und auch auf sie der ganze Gliedbau der Grundwesenheiten angewendet werden muß, so ergeben sich hieraus folgende Grundwahrheiten von der Zeit. Erstens: es ist Eine selbe ganze Zeit für Wesen-als-Urwesen, und für alle endliche Wesen in Wesen; die Zeit selbst ist Gottes, für Gott, insofern Gott in sich die soeben bewiesene Wesenheit ist. Zweitens: die Vereinheit des Ausschließens und des doch Ansichseins oder Ansichhabens aller unendlich-endlichen Bestimmtheiten ist da, existiert, in der Form des Einen, stetig verfließenden Verflußpunktes, Geschichtsmoments, Augenblicks; dieser ist die innere Grenze des Zugleichseins sich ausschließender unendlichvieler, unendlich-endlicher Bestimmtheiten, und ist stetig an sich derselbe, hinsichtlich der bestimmten Zeit aber ein anderer; mithin ist das stete Fortgehen oder Fließen des Einen Verflußpunktes die Form des steten Abflusses oder Verfließens der Zeit, das ist die Form des steten Zusammenseins aller vollendetbestimmten unendlich-endlichen Zustände an demselben, sofern diese Bestimmtheiten als entgegengesetzte an demselben nacheinander sind. Der Verflußpunkt oder Moment selbst ist nicht Zeit, noch enthält er Zeit, sondern er ist die reine, innere Grenze eines unendlich bestimmten Zustandes alles Endlichen in Gott, in Gott-als-Urwesen, und in dem Gliedbau alles Endwesenlichen im Weltall. Da nun der Verflußpunkt die stetig veränderliche innere Grenze ist der Einen Zeit, und da die Zeit, wie das, dessen Form sie ist, unendlich ist, so teilt der Verflußpunkt die Eine Zeit, als die Eine unendliche Gegenwart, in zwei Hälften, in die unendliche Vergangenheit, und in die unendliche Zukunft, das ist in die eine unendliche Vergangenheit und Zukunft der ganzen inneren unendlichen Endlichkeit, welche Wesen ist sich selbst ist, und welche auch alle endliche individuelle Wesen in Wesen in der unendlichen Zeit in sich sind. Die unendliche vergangene Zeit ist die Form derjenigen vollendet-bestimmten, unendlichendlichen Zustände, welche Wesen, als alles Unendlich-Endliche in sich seiendes Wesen auf ewige Weise noch ist, aber auf zeitliche Weise, sofern sie vorüber sind, nicht mehr ist; die unendliche zukünftige Zeit enthält diejenigen vollendet bestimmten, unendlichendlichen Zustände, welche Wesen als alles Unendlich-Endliche in sich seiendes Wesen, auf ewige Weise schon ist, aber auf zeitliche Weise, sofern sie noch künftig sind, noch nicht ist. Aber die Zeit selbst, welche in sich auch der Eine Verflußpunkt ist, ist Eine, selbe und ganze, also in ihrer Art unbedingt und unendlich; sie hat mithin keine Grenze welche das ihr Gleichartige von ihr abgrenzte, an sich oder um sich; sie hat selbst als Form keine Anfangsgrenze und keine Endgrenze, sondern bloß als Ingrenze den Zeitpunkt –sie selbst hat keinen Anfang und kein Ende, und eben deshalb hat auch das Fortgehn oder Fließen ihres inneren Verflußpunktes keinen Anfang und kein Ende. Die Zeit selbst als Eine, selbe, ganze, ist die Eine gegenwärtige Zeit für Wesen selbst und für den Gliedbau der Wesen in Wesen, und als die Eine gegenwärtige Zeit ist die Zeit auf unzeitliche, ewige Weise Eine, ein einzige und aufeinmal. (Ich unterscheide sprachgemäß die reinformlichen Bstimmnisse der gegenwärtigen, vergangenen und zukünftigen Zeit, von den gehaltformlichen Bestimmnissen der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, wobei der Gehalt selbst, dessen Zeit die Form ist, nach der Form der Zeit betrachtet wird. Gemeinhin werden aber diese Wortunterscheidungen nicht beobachtet). Und da der Verflußpunkt stetig fließt, so wird eine Eine gegenwärtige Zeit geschaut, als durch selbigen, auf ewig gleiche Weise, in zwei gleiche Hälften, die Vorzeit und Nachzeit (Kommzeit) geteilt. Auch jedes unendliche Grundwesen und jedes unendlich-endliche Wesen ist in sich die Form der Zeit als der Einen, selben, ganzen gegenwärtigen Zeit. Drittens: Wesen selbst ist nicht in der Zeit, nicht ein Zeitliches, noch ist auch die Zeit an Wesen, als wäre sie die Form Wesens selbst als des Einen, selben und ganzen Wesens (als Orwesens); sondern die Zeit ist nur in und unter Gott, sofern Gott der Gliedbau der Wesen in sich und der Gliedbau der Wesenheiten an und in sich ist, und auch dies nur in der Hinsicht, als der Eine Wesengliedbau in sich die vollwesenliche Unendlichkeit ist der ganzen unendlich-endlichen Bestimmtheit oder Individualität. Ja selbst von jedem endlichen Wesen gilt, dass es nicht als Eines, selbes ganzes Wesen, das ist nach seiner endlichen Orwesenheit die Form der Zeit hat, – dass es nicht die Zeit an sich oder um sich hat, sondern die Zeit bloß in sich ist und enthält, und zwar auch dies bloß, insofern das endliche Wesen die Gesamtheit aller seiner inneren vollendet-endlichen Bestimmtheiten ist; und sowie jedes endliche Wesen nach der Stufe seiner Wesenheit an allen göttlichen Wesenheiten teilhat, so hat es auch teil an der Form der Zeit, so ist es in sich in der Einen Zeit, welche die Zeit Gottes selbst ist, alle seine ihm wesenlichen vollendet endlichen, individuellen Zustände. Daraus folgt zugleich, dass nicht Wesenliches in der Zeit selbst entsteht oder vergeht, sondern dass nur die vollendet endlichen bestimmten Zustände jedes einzelnen endlichen Wesens , als solche, in der Zeit entstehen und vergehen. Ja die Zeit selbst ist nicht zeitlich, sie ist eine innere und untere Grundwesenheit Wesens, die da in ihrer Art selb, das ist unbedingt und ganz, das ist unendlich ist; nach ihrer Einen, selben, ganzen Wesenheit ist sie auf ewige Weise, und nur nach ihrer inneren Grenzheit, i der Form des Verflußpunktes wird sie, und ist auch sie selbst zeitlich; und in letzterer Hinsicht ist auch sie, wie das, woran sie ist, das, was sie nicht ist; und ist nicht das, was sie ist: denn als vergangene Zeit ist sie nicht mehr das, was sie war, und als zukünftige Zeit ist sie noch nicht das, was sie sein wird. Nach ihrer ewigen Wesenheit aber, ist sie die Eine selbe, ganze Gegenwart, das was sie zeitlich gewesen ist und was sie zeitlich sein wird. – Die Zeit selbst also ist ewig in dem oben erklärten Sinne des Wortes und die Erkenntnis derselben ist eine ewige Wahrheit. Ewigwesenlich ist die zukünftige Zeit, auch ehe sie wird, ehe sie zeitlich da ist. Und die Vorzeit ist nach ihrer ewigen Wesenheit noch, wenn sie auch zeitlich nicht mehr da ist; und das, was in der Vorzeit geschehen ist, besteht fortan als ewige Wahrheit.
Also sind die
unendlich-endlichen Wesen selbst vor und über ihrem Werden in der Zeit; sie selbst
entstehen und vergehen nicht, sondern nur ihre unendlich
endlichen bestimmten Zustände. Auch das Ändern selbst ist unänderlich, und
bleibend in der Zeit. Auch die Zeit ist unendlich, unentstanden, und ihr
stetig fortschreitender Verflußpunkt ist einer für Wesen o und für alle Wesen in
o. Alles in der Zeit Werdende ist die Wesenheit Wesens o und aller Wesen in
Wesen selbst, wie sie in sich als vollendete Endlichkeit ist, und sich
offenbart. Alles Individuelle eines jeden Verflußsspunktes (Momentes) ist eine
eigentümliche und einzige Darstellung der ganzen Wesenheit Wesens o in seinen
Wesen in sich; oder jeder Moment des Geschehens (der Geschichte) ist einzig, von
unbedingtem göttlichen Inhalt und Werte. Wesen o selbst als das Eine, selbe,
ganze ändert sich nicht, und ist in keiner Hinsicht zeitlich, oder in der Zeit;
denn in keiner Hinsicht ist Wesen o an sich Endlichkeit, noch ist eine Grenze um
Wesen o und die vollendete zeitlichwerdende Endlichkeit ist nur an dem
Wesenlichen in Wesen.
Wesen o selbst als Urwesen u ( O 2) ist der Eine, selbe, ganze Grund und die Ursache des Einen stetändernden Werdens in sich: und, infolge der Ähnlichkeit, ist auch jedes endliche Wesen in o in dem Gebiete seiner eigenen Wesenheit nächster Grund und Ursache seines ganzen stetändernden Werdens alles Individuellen in ihm; aber nur als untergeordneter endlicher Mitgrund und Mitursache, in Abhängigkeit von Wesen o als dem Einen Grunde und der Einen Ursache der Wesenheit jedes endlichen Wesens.
Es ergibt sich daher bezüglich der Seinheit folgende Gliederung:
jo eine, selbe, ganze Seinheit (Orseinheit)
ju Urseinheit
ji Ewigseinheit
je Zeitlichseinheit (nur hier gibt es Werden und Veränderung).
Hierbei sind alle Gegensätze (z. B. zwischen ju und je oder ji und je) sowie alle Vereinigungen zu beachten.
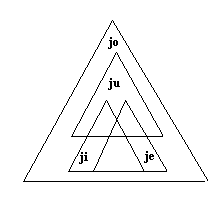
Soweit sich Lebewesen, Gesellschaften usw. verändern, werden und entwerden, folgen sie Entwicklungsgesetzen, die in (28) dargelegt sind. Sie können durch die folgende Zykloide dargestellt werden.
I. Hauptlebensalter (I. HLA): These
Das endliche Wesen, Gesellschaften von Wesen und deren innere Gesellschaftlichkeit sind zeitlich gesetzt und nach ihrer ganzen Selbstheit ungetrennt enthalten in der einen Selbstheit Gottes. Sie sind dabei in ungetrennter Wesensheiteinheit mit Gott und sind sich dessen nicht bewusst. Ihre Selbstheit ist nicht entgegengesetzt und noch nicht unterschieden in der unendlichen und unbedingten Selbstheit Gottes. Bildlich ist dies der Zustand im Mutterleib.
II. Hauptlebensalter (II. HLA): Antithese
Das endliche Wesen, Gesellschaften von Wesen und deren innere Gesellschaftlichkeit werden sich ihrer Selbstheit bewusst und zugleich setzen sie ihre Selbstheit jeder anderen Selbstheit unterscheidend entgegen. Sie setzen sich zuerst der unendlichen und unbedingten Selbstheit Gottes entgegen, ihr Eigenleben steht dann in der gegenheitlichen, entgegengesetzten und unterscheidenden Selbstheit. Dies führt zu einer Unterscheidung von allem und jedem nach außen und im Fortschritt des Lebens auch zur vernünftigen Unterscheidung in und von Gott. Bildlich ist dies der Zustand der Geburt und der Kindheit bis zur Pubertät.
III. Hauptlebensalter (III. HLA ): Synthese
In diesem Alter wird die unterscheidende Selbheit und Selbstheit als solche mit der Selbheit und Selbstheit Gottes als Urwesen und dann auch aller endlichen Wesen in Gott vereingesetzt. Die Menschen werden sich der wesenhaften Vereinigung ihres selbständigen Lebens mit dem selbständigen Leben Gottes als Urwesen und aller endlichen Wesen in Gott und durch Gott inne. Sie bemühen sich dann, soweit es in ihrem Vermögen liegt und unter Mitwirkung vor allem Gottes als Urwesen, diese Lebensvereinigung zu verwirklichen. Bildlich ist dies das vollreife Erwachsenenalter.
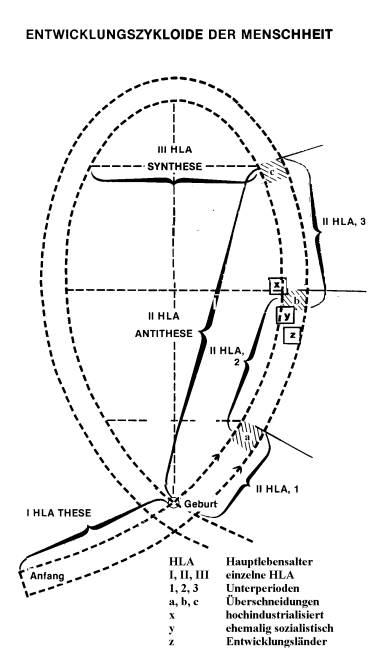
Jedes dieser HLA ist selbst wieder in drei Phasen gegliedert, die wiederum nach These, Antithese und Synthese bestimmt sind. Für uns von Wichtigkeit ist die Gliederung des II. HLA, in dessen verschiedenen Phasen sich die Menschen, Gesellschaften und inneren Funktionen und Systeme der Gesellschaftlichkeit sowie die Sozialsystemfaktoren derzeit befinden.
1. Phase (II. HLA, 1) – Autorität
Bevormundung oder autoritäre Einbindung des Elementes (z. B. Individuum oder Gesellschaft) in andere der gleichen oder einer anderen Art. Keine Selbständigkeit gegenüber anderen Faktoren oder gegenüber anderen Elementen der gleichen Art.
2. Phase (II. HLA, 2) – Emanzipation, Autonomisierung
Es kommt zur Autonomisierung des Faktors gegenüber allen anderen Faktoren und zu zunehmend freier Entfaltung der inneren Mannigfaltigkeit desselben. Innerhalb des gleichen Faktors erfolgt eine zunehmende Differenzierung, Verzweigung, Ausgestaltung, teilweise ohne Rücksicht auf die Nebenglieder der gleichen und anderer Arten. Die autonome Selbstentwicklung geht zumeist mit deutlicher Abgrenzung gegen Elemente der gleichen und anderer Art vor sich.
3. Phase (II. HLA, 3) – Integration
In der Phase der Integration wird versucht, den autonomen Individualismus unter zunehmender Berücksichtigung der Nebenglieder der gleichen und anderer Arten zu überwinden. Es kommt zur Bemühung um Abstimmung und Verbindung mit Neben- und übergeordneten Elementen. Die Berücksichtigung der gegenseitigen Abhängigkeiten nimmt zu.
4. Phase (III. HLA) – Allsynthese und Allharmonie
In der 4. Phase erfolgt eine Allsynthese und Allharmonie aller Elemente mit allen Elementen der gleichen Art und aller anderen Arten. Es bildet sich panharmonische Gesellschaftlichkeit gemäß der Struktur und Gliederung der absoluten Essentialität nach der Grundwissenschaft.
Auch für diese Universalsprache gelten die obigen mathematischen Beziehungen zwischen Unendlichkeit und Stufen der Endlichkeit nach ( O 1 bis O 4). Sie impliziert eine völlig neue Theorie der Sprache.
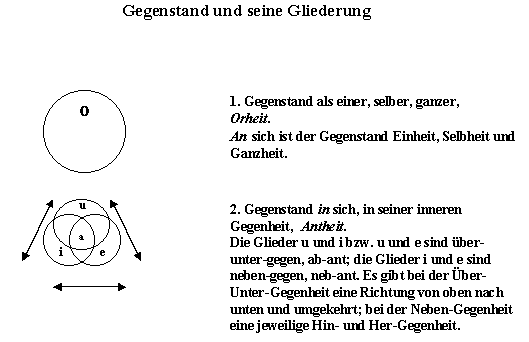
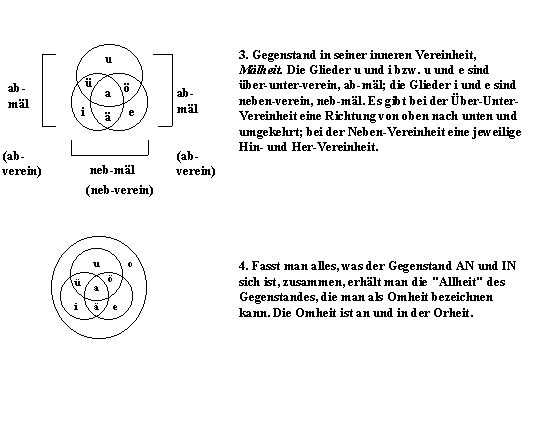
Die neuen Ausdrücke sind daher: Orheit, Antheit, Mälheit und Omheit. Die Or-Omheit ist die Summe aller obigen formalen und inhaltlichen Beziehungen. Die Ausdrücke sind Kunstwörter, wie sie auch in anderen Wissenschaften geschaffen werden. Wer sie befremdlich findet, könnte auch andere entwerfen; diese müssten nur inhaltlich den hier dargelegten Erkenntnissen entsprechen.
Unsere bisherigen Ableitungen der göttlichen Kategorien an und in Gott bilden, wie schon angedeutet, auch die neuen Kategorien der Mathematik. Die folgende Tabelle fasst nochmals kurz die Ableitungen der Grundbegriffe, Axiome zusammen, wobei sich die Zahlen nach dem Begriff auf die Seiten in (19) bzw. (69) beziehen.
WESENHEIT (Reinwesenheitslehre) 371
Gegenwesenheit (Artheit) 404
Einheit der Wesenheit (Einheitslehre) 365
Satzheit 370
Gegensatzheit, Bestimmtheit 407
Jaheit 408
Gegenjaheit, Neinheit, Negation 408
Zahlgegenheit, Vielheit, Allheit, Totalität, Vollständigkeit, 409, 417
Zweiheit, Dreiheit, 409, positive und negative Zahlen 410
|
SELBHEIT, ABSOLUTHEIT (allgemeine Selbheitslehre) 317 Gegenselbheit, Verhaltheit, Verhältnis 406; Richtheit, Richtung, Vektoren 371 Gegenrichtheit 410 Stufheit, Stufe 435 Verhältnis der Stufen 456 Multiplizieren, Dividieren 455 Gegenrichtheitliche Größen 456 Selbgröße, Verhaltgröße (relative Größe), Größenverhaltheit, arithmetisches und geometrisches Verhältnis 466 Addition und Subtraktion
|
GANZHEIT, UNENDLICHKEIT, (Ganzheitslehre) 371 Organzheitslehre, oberste Teile der Ganzheitslehre 458, 467 Gegenganzheit, Teilheit, Teil 407 Fassheit 371, In-Sein-Aussen-Sein 412 Grenze, Grenzheit, Umfang 412 Großheit, Größe, Ende, Endlichkeit 413 Grenzheitsstufe 454 Unendlichkeit am Endlichen 450 Endgroßheit, Endganzheit 455 unendliche Vielheit, unbestimmte Vielheit 456 Unendlichkeit der Zahlenreihe 456 Artgroßheit, Stetgroßheit 455 unendliche Artvielheit, unendliche Stetvielheit 456 unendliche Artzahlheit, unendliche Stetzahlheit 456 Variieren, Kombinieren, Permutieren 459 unendliche Teilbarkeit, unendliche Vielmaligkeit jedes Endlichen in seinem Unendlichen der nächsthöheren Stufe 456 Logologie, Logarithmik 466 Ableiten der Zeit, Werden, Bilden 469 f. |
Innerhalb dieser Deduktion der Mathematik sind auch die "modernen" Zweige der Mathematik als innere Teile integrierbar. Natürliche, ganze, rationale, reelle und komplexe Zahlen stellen sich als innere Teile in der Kategorien der SELBHEIT und GANZHEIT dar. In der modernen Mathematik, auch in der Konstruktion raum-zeit-unabhängiger "Räume" (z.B. Hilbertraum usw.) fehlen, wie in der Zahlentheorie die unendlichen Glieder, in unter denen erst die verschieden endlichen Glieder abzuleiten sind. Ohne diese Ableitungen ist aber die gesamte Mathematik deshalb mangelhaft, weil die Relationen zwischen dem Unendlichen und seinen endlichen Ingliedern für den Aufbau der Mathematik letztlich essentiell sind.
Beispiel: In der Mengenlehre Cantors fehlt etwa folgende Ableitung der Zahlenreihe 1, 2, 3, ...v:
Or-Ω
Ur-Ω
∞![]() i
e ∞
i
e ∞
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,....v
Dass die Antinomien der Mengenlehre weiterhin auch in der Physik ihre Konsequenzen besitzen, zeigen etwa die folgenden Ausführungen Kanitschneiders (1991, S. 388 f.)
"Gibt es, so kann man fragen, irgendwelche Erkenntnisschranken, welche die größte Menge von Objekten festlegen, die wissenschaftlich behandelbar sind? (...) Die zweite Bestimmung von 'Universum' als 'the largest set to which our physical laws can be applied' ist insofern problematisch, als die charakteristische Eigenschaft, nämlich die Geltungs- oder Reichweite der physikalischen Gesetze, selbst noch offen ist und in der Epistemologie verschiedener kosmologischer Theorien unterschiedlich gesehen wird. (...) Beide Definitionsvorschläge gehen nicht von der philosophisch naheliegenden Begriffsbestimmung einer 'physikalischen Allmenge' aus, wie sie etwa dem traditionellen Ausdruck 'Seienden' entspräche, weil die unbeschränkte Bildung der Allmenge sofort Anlaß zum Auftreten von Antinomien gäbe."
In (Ly 02, S. 4) findet sich folgende Überlegung:
Ein zweites Augenmerk sei auf den Aufsatz "Kontinuität und Möglichkeit" gelenkt, eine Studie, wie es im Untertitel heißt, "über die Beziehung zwischen den Gegenständen der Mathematik und der Physik". Der hier gesondert in Rede stehende Gegenstand der Betrachtung ist das Kontinuum. Bestehen bereits innerhalb der (Meta)-Mathematik Einwände gegen die Cantorsche transfinite Mengenlehre und den Begriff des aktual Unendlichen, so hebt Weizsäcker hervor, dass dessen Anwendung auf die vermeintlichen Kontinua der Physik, vor allem Raum und Zeit, mit der Quantentheorie in Strenge nicht vereinbar ist."[19]
Das Paradies, welches CANTOR uns in seiner Mengenlehre zu erschließen versuchte, ist erst hier richtig eröffnet. Sein Weg war nicht frei von Mängeln, die wir hier beheben. Ob und wann die Mathematiker dieses Paradies betreten werden, können sie nur selbst nach Prüfung entscheiden.
Der aufsteigende, induktive Weg CANTORs in seiner Grundlegung einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre ist nicht gründlich, vollständig und klar, weshalb er auch nicht zur reinen Erkenntnis des Grundwesens, als des Einen, selben, ganzen, unendlichen und unbedingten Or-Wesens gelangt, sondern als höchstes Symbol für das Grundwesen die absolut unendliche Zahlen-FOLGE annimmt. Wie aber die obigen Deduktionen zeigen, ist die unendliche Zahlenfolge erst eine unter (O 4.1.5.4.1) deduzierte INNERE Gegebenheit in/unter dem einen selben ganzen ABSOLUTEN Wesen o. Die Absolutheit (Selbheit) und Unendlichkeit (Ganzheit) Wesens o liegen jedoch über der Zahlvielheit, der Zahlfolge. Wohl aber ist Wesen o in/unter sich alle Zahlfolgen, alle bestimmte Ganzheit, Teilheit, Teilganzheit, alle Grenzheitsstufen. Die Or-Zahlheit Wesens o ist erst in/unter sich Zahlgegenheit.
Auch die Bildung der Zahlklassen nach dem ersten und zweiten Erzeugungsprinzip CANTORs erweist sich als mehrfach mangelhaft.
Wenn man sich unter W die Zahl denkt, welche für den Inbegriff der Zahlen 1,2,3,4,....v steht (gemäß der Definition CANTORs), so ist nach sorgfältiger Beachtung der Ableitungen unter O deutlich, dass die Zahl W gliedbaulich folgend zu sehen ist:
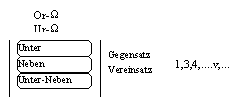 CA0
CA0
Das Eine, selbe, ganze, unendliche und nach innen absolute W ist in/unter sich zuerst einmal die beiden Zahlen i und e nach (O 2) und erst in/unter diesen beiden sind in der nächsten Grenzheitsstufe die unendlich vielen Teile 1,2 usw. die zueinander in Nebengegensatz stehen. Als Ur-Ganzes, Ur-W ist W über den Teilen i und e und weiters 1,2, ... usw. Weiters sind alle Gegenheiten und Vereinheiten klar zu erkennen.
Or-Ω
Ur-Ω
∞![]() i
e ∞
i
e ∞
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,....v
Was CANTOR im folgenden nicht beachtet, ist, dass Or-W im Verhältnis zu den Zahlen 1,2,3,.. der NÄCHSTHÖHEREN Grenzheitsstufe angehört (auch noch die beiden Zahlen i und e), dass daher W (sowie i und e) und etwa die Zahl 436 verschiedener Grenzheitsstufe angehören. Or-W folgt daher nicht, wie CANTOR annimmt, als erste ganze Zahl auf v! (Dies wäre nur bei Neben-Gegenheit von W und v möglich.) Or-W ist auch nicht größer als jedes v, sie ist vielmehr das Or-Ganze, in/unter dem auch alle Endganzen (daher auch v) sind. Die Zahl W steht mit keinem ihrer In-Teile in einem Verhältnis der Großheit, oder endlichen Vielheit, kann daher auch nicht „größer“ als eine der endlichen Zahlen genannt werden (O 4.1.5.5). Sie ist daher auch nicht die GRENZE, der die Zahlen 1,2,3,4,..v... zustreben. Jede ganze Zahl ist vielmehr eine ihrer In-Begrenzungen, während sie im Verhältnis zu ihren In-Grenzen unendlich und ganz ist. Man muss, um diesen Bau des Verhältnisses klarer darzustellen, eine verbesserte Schreibweise der Zahlen in etwa folgender Form einführen:
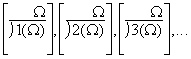 (CA1)
(CA1)
wobei das Zeichen „ ![]() “ das Verhältnis der
Untergegenheit der nächstniederen Grenzheitsstufe der Zahlen 1,2,3,..usw.
darstellt und das Zeichen „(W)“ ein
Zugehörigkeitsindex der Zahl zur Or-Zahl W sein soll.
“ das Verhältnis der
Untergegenheit der nächstniederen Grenzheitsstufe der Zahlen 1,2,3,..usw.
darstellt und das Zeichen „(W)“ ein
Zugehörigkeitsindex der Zahl zur Or-Zahl W sein soll.
Wie schon gesagt, steht die Zahl W infolge ihrer nächsthöheren Grenzheitsstufe in keinem Verhältnis der Großheit zu irgendeinem ihrer In-Unterglieder.
Der nächste Schritt CANTORs
![]() (CA2)
(CA2)
ist unbestimmt und u.U. unzulässig. Da W in/unter sich die unendlich vielen Zahlen 1,2,3,4,...v,... ist, die der nächstniederen Grenzheitsstufe angehören, addiert die Operation W+1, usw. zwei Zahlen unterschiedlicher Grenzheitsstufe. Da aber W von CANTOR bereits als der Inbegriff aller in ihr enthaltenen unendlich vielen Zahlen definiert wurde, ist die Zahlenbildung (CA2) ohne genauere Bestimmung,- jedenfalls im hiesigen Fall CANTORs sicher - unzulässig. Gibt es nämlich neben W auf der selben Grenzheitsstufe mehrere oder sogar unendlich viele W1, W2, usw. in Nebengegenheit, (so wie in unserem Beispiel unendlich viele Linien auf einer Fläche, unendlich vielen Flächen in bestimmten Räumen usw.) in/unter dem Or-Ganzen der nächsthöheren Grenzheitsstufe, so sind die Summenbildungen (CA3.1), (CA3.2), (CA3.v),.. möglich:
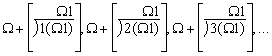 CA3.1
CA3.1
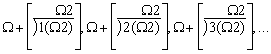 CA3.2
CA3.2
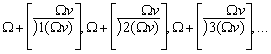 CA3.3
CA3.3
wobei W1, W2,.. andere W neben-gegen zu W in/unter dem nächsthöheren Ganzen bezeichnen, und der Index „(W1)", „(W2)“ die Zugehörigkeit der entsprechenden Zahl zur Or-Zahl W1, usw. darstellt.
Es sind im weiteren auch folgende Zahlenbildungen möglich:
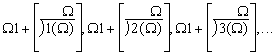 CA4.1
CA4.1
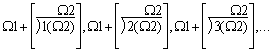 CA4.2
CA4.2
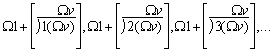 CA4.3
CA4.3
und im weiteren ähnliche Summenbildungen für jedes W, W1, W2, Wv,. mit jedem der unendlich vielen In-Glieder aller anderen W.
Werden die klaren Unterschiede der Grenzheitsstufen in/unter einer Art beachtet, so sind die Summenbildungen (CA3) bis (CA5) zulässig. Eine deutliche Spezifizierung durch Indizes und eine Angabe der Grenzheitsstufen sind aber erforderlich. Da die Zahlenbildung CANTORs diese Aspekte nicht berücksichtigt, beginnen hier die Antinomien der Mengenlehre, die aber in der zeitgenössischen formalen Logik nicht zufriedenstellend lösbar sind.
Weiters fehlt bei CANTOR die Summenbildung:
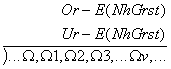 CA5
CA5
Der Index (NhGrst) bedeutet, dass E im Verhältnis zu allen W der nächsthöheren Grenzheitsstufe angehört.
Wie weit kann in der Summenbildung in dieser Art aufgestiegen werden? Wie die obige Deduktion der Mathematik zeigt, gelangt man hier jeweils zu einer nächsthöheren Grenzheitsstufe, bis man zum Einen, Selben, Ganzen, Unbedingten und Unendlichen dieser bestimmten Art gelangt, welches selbst wieder bei weiterem Aufstieg im Einen, selben, ganzen, unendlichen und unbedingten Grundwesen zu erkennen ist.
Das Eine, Selbe, Ganze, Unendliche und
Unbedingte seiner Art ist in unter sich alle unendlichen und endlichen
Teilmengen, Summen, Vereinigungen, alle bestimmte Ganzheit, Teilheit,
Teilganzheit, alle Grenzheitstufen (alle verschiedenen Ordnungen des
Unendlichganzen und Endlichganzen), alle Folgen, alle Ergebnisse aller
ganzheitlichen Verrichtungen usw. Beim Abstieg gelangt man zu den unendlich
endlichen Teilen niederster Grenzheehitsstufe, die selbst noch unendliche
innere Teilbarkeit und Bestimmbarkeit besitzen; vgl. oben ab (O
4.1.5).
Weiters gilt: Das
Potentiell-Unendliche, also die konstruktive Begründung der Zahlenreihe
durch ein Werden, durch eine ins Unbegrenzte fortschreitende Folge usw. ist
in/unter dem Aktual-Unendlichen enthalten. Wir sehen, dass bereits
CANTOR darin irrte, dass er als Grundlage der Zahlentheorie die unendliche
Zahlen-FOLGE annahm. Wie sollten wir sicherstellen können, dass wir bei
Fortsetzung einer Zahlenfolge tatsächlich nicht an ein Ende kommen, wenn nicht
dadurch, dass wir die Aktual-Unendlichkeit voraussetzen, zumindest stillschweigend
postulieren. Denn die Unendlichkeit der Fortsetzbarkeit des Zählens
endlicher Mengen ist ja erst eine INNERE, abgeleitete Unendlichkeit, welche
die Unendlichkeit, hier Wesens o, voraussetzt. Die zeitgenössische
formale Logik wird aber nicht nur im Klassenkalkül durch diesen Ansatz
grundsätzlich betroffen und verändert, sondern z. B. auch im Begriff
der "Negation" des Aussagenkalküls. Vom unendlichen, unbedingten Grundwesen
kann nicht gesagt werden: A, non A, weil vom Or-Wesen nichts verneint wird. Es
gibt nur In-Teilverneinung im Grundwesen. Nur IN Wesen
als i und e
ist
Neben-Gegenverneinung der beiden Glieder gegeneinander und
Unter-Gegen-Verneinung gegen u. Beachte: Die Bedeutung dieser grundlegenden
Begriffe ist daher im System O eine andere, als etwa in den Systemen
der formalen Logik. Auch alle bisherigen
Inhaltslogiken, vor allem die HEGELsche, erweisen sich in anderer Hinsicht
als mangelhaft. Die dazugehörige Logik ist die Synthetische Logik KRAUSES in
Werk (33).
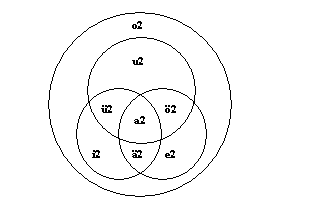
Gott ist in sich der Gliedbau der Wesenheiten (oben ausgeführt) und der Wesen, der Wesengliedbau, was durch die Begriffe "Weltall" und "Universum" ungenau bezeichnet wird.
o2 Gott als Orwesen ist in sich zwei in ihrer Art unendliche, nebeneinander stehende Grundwesen, die einander gegenähnlich sind, beide ewig, ungeworden, unvergänglich, nämlich:
i2 Geistwesen, "Geist-All" und
e2 Natur, Leib-Wesen, "Leib-All".
i2 und e2 enthalten in sich unendlich viele Arten unendlich vieler Einzelwesen (Individuen).
Gott als über den beiden seiend und wirkend, mit beiden vereint ist:
u2
Gott als Urwesen, verbunden mit i2 als ü2, mit e2 als ö2; i2 und e2 sind
auch
teilweise miteinander verbunden als ä2 und als solche verbunden mit u2 als
a2.
Durch diese wissenschaftlichen Ableitungen in Gott werden die bisher undeutlichen Vorstellungen über das Verhältnis von Natur und Geistwesen ebenso behoben wie die ungenauen Intuitionen hinsichtlich der "inneren" wahren Gestalt der Natur usw.
Die Richtungen der Geist- und Naturmystik werden dadurch weiterbildbar, da ersichtlich ist, dass Gott über beiden als Orwesen ist und in beide als Urwesen wirkt, dass sie aber beide deutlich von Gott als o2 und u2 zu unterscheiden sind und dass sie in gegenähnlicher Beziehung nebeneinander sind, beide selbständig und miteinander auch vereint. Auch pantheistische Lehren erweisen sich hiermit als ungenau. Die wissenschaftliche Deduktion der beiden Grundwesen, Geist und Natur, in Gott erfolgt in (19, 2. Teil). Auch für das Verhältnis von Geist und Körper, Ethik, Soziologie, Feminismus, Psychologie, Sexualtheorie usw. ergeben sich hier völlig neue Parameter.
Im Folgenden eine Darstellung des Unterschieds aus (23):
"Gott befasst in sich und in seiner Wesenheit Geist und Natur als die zwei sich wesentlich entgegengesetzten, obersten Grundwesen der Welt. Erforschen wir den Grundcharakter oder die Grundwesenheit von Geist und Natur, so finden wir, dass derselbe durch die zwei Grundwesenheiten bestimmt ist, nämlich durch die Selbheit oder Absolutheit und durch die Ganzheit oder Unendlichkeit, die wir oben an der göttlichen Einheit erkannt haben, wobei jedoch zu bemerken ist, dass hier nur von dem bestimmten Vorwalten der einen oder der anderen Grundwesenheit die Rede sein kann, da die höhere Einheit das In- und Miteinandersein derselben begründet. Die analytische Beobachtung von Geist und Natur entspricht dem metaphysisch aufgefundenen und ausgedrückten Grundcharakter.
Der Geist und die Geistwelt ist, wie wir schon in der wissenschaftlichen Hinleitung zur Grunderkenntnis sahen, vorwaltend durch die Selbheit Selbständigkeit, Spontaneität, Unabhängigkeit und Freiheit bestimmt, indem der Geist vorwaltend selbst und selbständig ist und handelt, sowie er auch jedes nach der eigenen Selbständigkeit desselben auffasst, sich selbst durch die Gegensetzung der Selbständigkeit, schärfer von allen anderen Wesen unterscheidet und dadurch zum Bewusstsein seiner selbst und zur Erkenntnis der ihm gegenständlichen Wesen gelangt. Infolge dieses Vermögens, vermag der Geist auch alles mehr zu sondern im Erkennen und Handeln, die Teile vom Ganzen und untereinander zu trennen, einen nach dem anderen und mit Wahl zu erforschen und auszubilden, und vermöge seiner Spontaneität sich nach der einen oder anderen Richtung hin zu bestimmen, seine geistigen Kräfte in Gesamtheit oder vereinzelt und ausschließend zu entwickeln. Durch diese Trennung, Isolierung, Abstraktion, Verselbständigung eines Geistes in Bezug auf sich und seine Verhältnisse mit der Gesellschaft und der Welt wird aber auch der Irrtum und das Übel in der geistigen Welt begründet. Die Geister in der Verselbständigung ihrer selbst und der Wesen und Eigenschaften, lösen die Bande, wodurch alles gehalten wird, verkennen die Gesetze, denen sie in freier Selbständigkeit gehorchen sollten. Der Irrtum und das Übel, welche daraus entspringen, können nur durch die Herstellung des richtigen Verhältnisses wieder behoben werden. Sowie aber nun die Selbheit an der höheren Einheit ist, so soll sich auch die Selbständigkeit der höheren Einheit frei unterordnen.
Dies geschieht; wenn in der Vernunft, dem Strahle des göttlichen Urlichtes, welches die Einheit der Welt in Gott erkennt, die geistige Welt mit der Naturwelt verbunden und das Prinzip der Selbständigkeit und Freiheit durch das Prinzip der Ganzheit ergänzt wird.
Dann wird auch das Naturprinzip in das Geistleben übertragen, das Leben des Einzelnen und der Gesamtheit erhält eine Organisation, worin, unter dem Vorwalten der Freiheit, alle im organischen Verbande der höheren Einheit gehorchen.
Die Natur, oder die im Raum sich gestaltende Welt steht unter dem Charakter der Ganzheit. Indem sie alles im Ganzen bildet, und alles ganz und zugleich bildet, zeigt sich in ihr das Vorwalten der allseitigen Gebundenheit, Wechselbestimmung und Stetigkeit. Die Natur vermag nicht wie der Geist zu trennen und trennend zu schaffen, oder einen Teil mit dem anderen zu bilden, sie gestaltet ein jedes in seiner Ganzheit, nach allen seinen Teilen auf einmal, zugleich und alles in der Natur, die Sonne wie der Wassertropfen wird durch eine Gesamthandlung gebildet und bestimmt. Diese Durchbestimmung eines Wesens oder Gegenstandes nach allen seinen Teilen und in Bezug auf alles gibt ihm den Ausdruck der Vollendung, und so vollendet die Natur jedes Einzelne als wenn alles auf dieses Einzelne angelegt und berechnet wäre. Zugleich tritt in der Natur durch diese Gebundenheit und Wechselbestimmung das gegenseitige Für-einander-Sein, das teleologische Verhältnis von Zweck und Mittel sichtbarer hervor. Aber auch die Natur ermangelt nicht aller Selbständigkeit, einer eigentümlichen Freiheit, die ihr nur eine oberflächliche Ansicht abspricht, welche aber der sinnige Naturforscher selbst in der Bildung eines Blattes noch beobachtet. Sowie aber der Geist sich durch die Natur und durch das Naturprinzip ergänzt, soll auch die Natur sich durch den Geist ergänzen, die Schöpfungen desselben in sich aufnehmen und dadurch über ihre Einseitigkeit erhoben werden. Dadurch erhält sie die volle Befreiung, die für sie möglich ist, denn die äußere Kunstwelt, welche der Geist in der Natur vermittels ihrer eigenen Gesetze und Kräfte ausführt, die sie aber nicht selbst auf diese Weise anwenden könnte, ist eine Befreiung der Natur, wodurch alle ihre Kräfte gelöst und durch einen neuen geistigen Hebel gehoben werden. So zeigt sich also die Natur durch das Prinzip der Ganzheit und organischen Gebundenheit bestimmt. Wenn in der Welt der Geister alles mehr getrennt, freier, unverbundener erscheint, so dass die oberflächliche Beobachtung gar keine höhere Einheit und keinen innigen Zusammenhang unter den Geistern anerkennt, so wird die Natur schon in der gewöhnlichen Auffassung als ein Ganzes und als eine räumliche Ganzheit oder Unendlichkeit begriffen. Sowie aber alles Entgegengesetzte zur Vereinigung bestimmt ist, so auch der Gegensatz von Geist und Natur. Diese Vereinigung der Geistwelt und der Leibwelt wird auf doppelte Weise vollzogen. Zunächst durch die gegenseitige Einwirkung, die wir soeben bemerklich gemacht haben, alsdann durch eine Vereinigung oder Vermählung der sich gegenseitig entsprechenden Einzelwesen oder Individuen in der Geistwelt und der Natur."
Naturwissenschaftliche Philosophien haben heute eine starke Tendenz zur Naturalisierung des Bewusstseins. Was in früheren Philosophien als geistige Instanz erklärt oder vorausgesetzt wurde, soll durch naturwissenschaftliche Kategorien ersetzt werden. Eine selbständige, von der natürlichen (materiellen) unabhängige geistige oder darüber göttliche Ebene erscheint obsolet[20].
Im Vereinwesen von Urwesen, Geist und Natur sind unendlich viele Arten von Naturleibern mit unendlich vielen Geistern verbunden, die sich nach drei Arten gliedern:
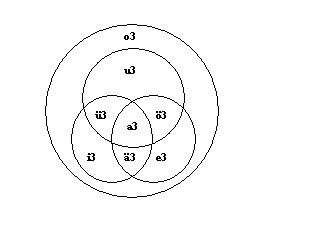
i3 Tierreich
a3 Reich der Menschheit, darin auch die Menschheit dieser Erde
Das Verhältnis von Tierreich und Pflanzenreich ist einerseits durch einen Unterschied im Verhältnis von Selbstheit zu Ganzheit bestimmt. Wichtig ist aber im Weiteren, dass nach den Deduktionen der Grundwissenschaft in der organischen Natur Pflanzenreich, Tierreich und Menschheitsreich sich durch Stufungen der Begrenzung, durch Grenzheitsstufen von einander unterscheiden, die wir oben entwickelten.[21]
Die Menschheit bildet ein vom Tierreich grundverschiedenes höheres Reich, sie ist die vollständige, harmonische Synthese aller in der Welt des Geistes und der Natur sich entwickelnden Gegensätze, Kräfte, Funktionen und Organe. Die Menschheit ist als diese Synthese mit Gott als Urwesen, u3, in selbstbewusster Persönlichkeit vereint.
In der spanischen Annäherung an die Originalschriften Krauses gibt es teilweise bedingt durch die bisherige Krauserezeption Unklarheiten, Ungewissheiten und letztlich auch Ungenauigkeiten, die hier beseitigt werden sollen.
Nach den Unterlagen, die im folgenden zitiert werden, befindet sich die Menschheit im Bereiche a (umseitige Zeichnung), also im innersten Vereinwesen von Gott, Geist und Natur, und zwar dort als innerstes Vereinglied im Verein-Vereinwesen. Nun ist zu beachten, dass nach dem 6. Lehrsatz der 4. Teilwesenschauung (19, S. 435) der Wesengliedbau nach jedem seiner Teile selbst wiederum untergeordneter Teilwesengliedbau ist. Der Teilgliedbau a ist daher selbst wiederum so in sich gegliedert, wie es der (Or-Om)-Gliedbau selbst ist. Bezeichnet man den Teilgliedbau a als "ta", so ist die Menschheit das Glied a in ta, also ata. Bis zu dieser Deduktion in Gott sind die Ausführungen Ordens nicht fortgesetzt. Ist sie aus den Schriften Krauses zu belegen?
"Denn das muss vor Allem geschaut und nie aus dem Auge verloren werden: dass der Menschheit-Wesen-Mälleben-Bund ein Vereinwerk Wesens als u-inmit sich selbst und Wesens als Menschheit (ata) seiend ist; d.h. Ein Selbinwerk Wesens. Und dass dabei Wesen als Urwesen in sich abwärts, und Wesen-als-Menschheit in sich aufwärts, – urwesenwärts – , wirket" (46, 2. Band, 1891, S. 213).
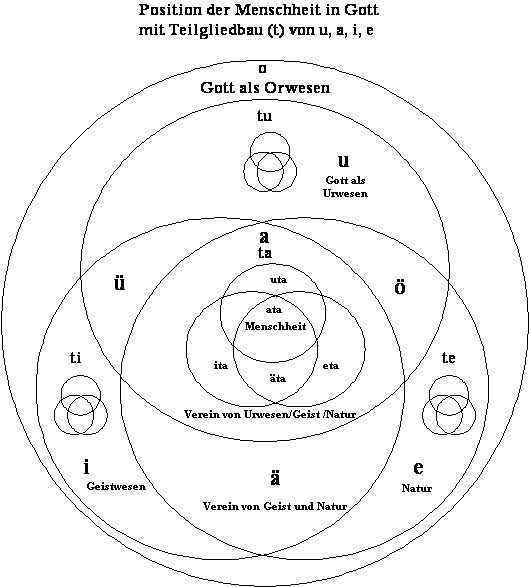
"Aus der orwesenlichen Forderung, dass Wesen in sich alle In-werdinge (Funktionen) in Einer Or-Om-Werding zeitstetig und zeitewig darseye, folgt, dass Wesen in sich alle mögliche Abstufungen und Abarten von Endlebwesen in sich, als dem Einen Orom-Lebwesen seye. (Orgrund der Darlebheit, Lebwirkigkeit (des Vorhandenseyns) aller Arten von vorgliedlebigen und gliedleblichen End-Leibwesen, aller Pflanzen und Tiere.
In der Tierwelt tritt ein Faktor erster Gliedbauordnung mehr ein; wenn nämlich Pflanzenwelt (Pflanzing) gleich f (ù verein [è und ì]) so ist Thierwelt (Thiering) gleich f [ù verein (ù verein [è und ì])]" (28, S. 502).
Daraus ist ersichtlich, dass die Menschheit nach Krause nur ata sein kann. Diese wichtigen Anmerkungen aus (28) finden sich in der neueren Ausgabe der Lebenlehre aus dem Jahre 1904 (65) nicht.
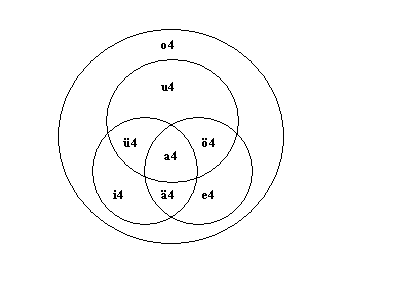
Im Menschen ist außer dem geistigen (i4) und leiblichen Prinzip (e4) ein göttlich urwesentliches Prinzip (u4), die Vernunft, wodurch er, über seine geistige und leibliche Individualität erhaben, zur wahren Persönlichkeit gelangt. Nur durch dieses urwesentliche Prinzip, welches den Menschen ewig mit Gott verbindet und stets im Lichte der Erkenntnis zu Gott leitet, kommt der Mensch auch wahrhaft im Urbewusstsein zu sich selbst. Er erkennt hierbei, dass der Gegensatz von Geist und Leib, wie er sich in seinem Wesen offenbart, in der höheren Einheit des Ichs als Ur-Ich (u4) fundiert ist. Dieser Gegensatz zwischen Geist und Leib soll durch das Urprinzip der Vernunft, welches der Grund des Ichbewusstseins ist, vermittelt, bestimmt und im richtigen Verhältnis ausgebildet werden. So ist also der Mensch eine dreigliedrige Persönlichkeit, wobei Geist (i4) und Leib (e4) durch ein göttliches Urprinzip zur Persönlichkeit vereinigt und dadurch vernünftig geleitet werden. Jeder dieser Bereiche zeigt selbst eine Dreigliederung, woraus sich die volle Struktur des Menschen ergibt.
Hinsichtlich des Verhältnisses von Ewigkeit und Zeit bringt die Grundwissenschaft bisher nicht berücksichtigte Erkenntnisse und Einsichten. Gott als o1, Vernunft i2 und Natur e2 ändern sich nicht in ihrer Einheit, Selbstheit, Ganzheit, Unendlichkeit und Unbedingtheit. Es ändern sich nur in Gott, in Geist und Natur innere unendlich-bestimmte individuelle Wesen und auch diese nur hinsichtlich ihrer inneren, sich ständig einander ablösenden, einander ausschließenden Bestimmtheiten (z. B. Planeten, Pflanzen, Tiere, Menschen usw.).
Auch jedes vollendet endliche Wesen ändert nicht seine ganze Wesenheit, denn diese ist ewig die gleiche, sondern es ändert sich nur in seinem Inneren, insofern es das Ganze seiner vollendet-endlichen, individuellen Zustände ist. Das Werden selbst aber wird nicht, und das Ändern selbst ändert sich nicht. Denn das Werden und Ändern sind selbst nichtzeitliche Grundwesenheiten. Kein Wesen und keine Wesenheit werden als solche, sondern lediglich deren innere, vollendet endliche Zustände werden und entwerden, entstehen und vergehen. Somit gilt hinsichtlich alles unendlich Endlichen, Bestimmten in Gott folgende Gliederung der Seinheit:
jo eine, selbe, ganze Seinheit (Orseinheit)
ju Urseinheit
ji Ewigseinheit
je Zeitlichseinheit (nur hier gibt es Werden und Veränderung)
Hierbei sind alle Gegensätze (z. B. zwischen ju und je oder ji und je) sowie alle Vereinigungen zu beachten.
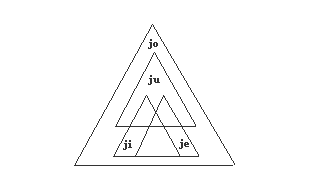
Auch in der deduktiven Gliederung und Vollständigkeit der Erkenntnisarten bringt die Grundwissenschaft Neuerungen.
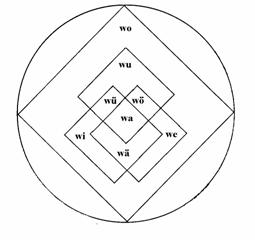
wo Einer, selber,
ganzer Begriff des Gegenstandes, Orbegriff; orheitliche
Erkenntnisart;
in Figur 1 ist es A, weiß.
wu Urbegriff,
urbegriffliche Erkenntnisart, urwesentliche Erkenntnis; in Fi-
gur 1 ist es
B, purpurn.
wi
Ewigbegriff, ewigwesentliche Erkenntnisart, Ideen, Ideale, Urbilder,
ideale
Erkenntnisart a priori; in Figur 1 ist es C(1), gelb, deduziert in
Gott.
we
Zeitlich-realer Begriff, sinnliche Erkenntnisart; in Figur 1 ist es E,
blau, in
Verbindung mit den Begriffen C(2), die mit Begriffen C(1) und den
beiden Bereichen der Phantasie D(1) und D(2) hinsichtlich der Natur G und der
Gesellschaft G(1) gebildet werden.
wä Vereinerkenntnis
von wi und we als Verbindung und Vergleich der
reinen
Ideen mit der zeitlich realen Erkenntnis und umgekehrt.
Im Weiteren sind alle Gegensätze (z. B. wu gegen wi und we gegen wi) sowie alle Vereinigungen (z. B. wu und wi als wü, we und wu als wö usw.) zu beachten.
Wird der
Erkenntnisgang bis zur Schau Gottes vollzogen, so ergibt sich, dass alles was
ist, an oder in Gott, nichts also außerhalb Gottes ist. Gefragt ist nun die
Gliederung, Stufung Gottes an und in sich (vgl. 3.1. Der
Kategorienorganismus der Grundwissenschaft).
Wie wir im weiteren sehen, versucht die Physik, laufend neue Modelle und Theorien zu entwickeln, um bestimmte physikalische "Beobachtungen" möglichst "adäquat" zu erklären. Hierbei handelt es sich um Konzepte, die im Wege der Intuition erstellt werden. Mit der Grundwissenschaft wird eine Basis bereitgestellt, durch Deduktion eine Verbindung mit den intuitiven Konzepten herzustellen. In einer Verbindung von Deduktion und Intuition kann in Konstruktion eine neue Progression in der Physik erreicht werden.
Die drei Theiltätigkeiten oder Momente des Schaubestimmens (19, u. 69)
Das Weiterbestimmen oder das Determinieren, welches wir als die dritte Grundfunction des Denkens betrachtet haben, ist gerade diejenige Verrichtung, wodurch alles unser Denken erweitert wird, fortschreitet und sich zu einem Gliedbau der Erkenntniss vollendet. Das Schaubestimmen also ist das progressive Prinzip, oder auch das formative Element alles Erkennens und der Wissenschaftbildung insbesondere. Desshalb stellt sich hier noch die Aufgabe dar, diese Grundfunctionen des Erkennens in ihren drei nächst untergeordneten Theilfunctionen zu betrachten, worin die Schaubestimmung oder Determination vollendet wird. Diese drei Theilfunctionen sind: Ableitung (deductio), die selbeigne Schauung des Gegenstandes (intuitio), und die Vereinigung dieser beiden als Schauvereinbildung (constructio). In diesen drei Functionen besteht die ganze Weiterbildung der Wissenschaft. Daher ist gerade diese Aufgabe, womit wir hier die Lehre von der Wissenschaftbildung oder die allgemeine Methodik beschliessen, die nächstwichtige von allen. Es ist eine Eigenthümlichkeit der neuen Philosophie in Deutschland seit Kant, dass diese drei Functionen des Schaubestimmens unterschieden, und wissenschaftlich erkannt worden sind; und ich habe diese Lehre von der Deduction, Intuition und Construction in mancher Hinsicht noch ausführlicher, als hier geschehen kann, vorgetragen in dem Entwurfe des Systems der Philosophie (welcher im Jahre 1804 erschienen ist); worin besonders die Lehre von der Construction in genauerer Bestimmtheit entwickelt worden ist, als bei Kant und Schelling gefunden wird. Suchen wir also jetzt diese Aufgabe auf analytische Weise, im Lichte des Prinzips zu lösen.
Die erste Function des Schaubstimmens oder Determinierens ist die Ableitung oder Deduction, d.i. die nichtsinnliche Erkenntnis oder Schauung 4ines Gegenstandes gemäß den Grundwesenheiten oder Kategorien, welche Kategorien erkannt und anerkannt worden sind als Denkgesetz und als Gesetze der Weiterbildung einer jeden Erkenntniss. Diese Function, einen Gegenstand in rein nichtsinnlicher Erkenntniss zu schauen, wie er nach den Grundwesenheiten bestimmt ist, ist erst dann ganzwesenlich und vollwesenlich, wenn Wesen selbst erkannt und anerkannt ist, und wenn die göttlichen Grundwesenheiten, als an und in der Wesenschauung enthalten, selbst synthetisch abgeleitet worden sind. (Vgl. Grundwissenschaft). Der allgemeine Grund der Möglichkeit dieser grundwesenlichen Erkenntniss eines jeden Gegenstandes ist, dass Alles, was Wesen in sich ist, an der Wesenheit Wesenstheil hat, ihm im Endlichen ähnlich ist. Da mithin jeder Gegenstand des Schauens oder Erkennens auf wesenähnliche Weise an, oder in Wesen bestimmt ist, so kann und so muss auch jeder Gegenstand ursprünglich in dieser Hinsicht erkannt werden; wird er nun so erkannt, wie er als Theil an oder in Wesen ist, so ist er abgeleitet, deduciert. Die Möglichkeit also einer wissenschaftlichen Deduction beruht in der Erkenntniss des Prinzips und in dessen Grundwesenheiten. Selbst aber bevor noch die Wesenschauung erfasst ist, verfährt schon das theilwissenschaftliche, ja sogar das vorwissen- schaftliche, Bewusstsein und Denken auf endliche Weise, und in theilweiser untergeordneter Hinsicht, ableitend, deducierend und Alles nach den, als die allgemeinsten, obersten nur als endlich gedachten Kategorien, bestimmend. Denn welcher Gegenstand auch im gemeinen Bewusstsein vorkomme, so wendet der Geist doch unwillkührlich die obersten Grundwesen- heiten, wenn auch nur als Gemeinbegriffe, auf diesen Gegenstand an, voraussetzend, er werde sein einer, ein selber, ein ganzer, er werde in sich Theile haben nach bestimmter Entgegensetzung, und so ferner. Von dem nun, was auf solche Weise überhaupt nach den Grundwesenheiten bestimmt reinübersinnlich erkannt wird, sagt man ebenfalls schon, dass es abgeleitet, deduciert sei. Gewöhnlich denkt man bei diesem Namen der Deduction nur an das Verhältniss von Grund und Folge; wenn aber gleich bei dieser Function das dadurch Bestimmte auch als das Begründete erscheint, so ist es doch nicht genug, es lediglich als Begründetes nach dem Verhältnisse von Grund und Ursache zu betrachten, sondern es ist nach allen Grundwesenheiten zu erkennen, wovon die der Begründetheit nur eine ist. Einseitiger Weise mithin erklärt man gewöhnlich die Deduction so: sie sei ein Beweisen aus dem Prinzipe. Allerdings ist sie auch ein Beweisen, weil alles endliche Bestimmte im Prinzip begründet ist, aber sie ist nicht bloss ein Beweisen, sondern überhaupt: Bestimmen des Gegenstandes nach allen Grundwesenheiten. Auch kann man eigentlich nicht sagen, dass bei der Deduction Etwas aus dem Prinzipe bewiesen wird, wenn man dabei an: ausser, denkt; sondern man sagt besser, es werde Etwas bewiesen in dem Prinzipe, durch das Prinzip. Damit nun diese Verrichtung klar werde, will ich sie an einigen Beispielen erläutern. Gesetzt der Gegenstand seie der Raum, so würde die Deduction des Raumes folgendermassen geleistet werden müssen. Da der Raum eine Form ist, so müsste erst das Wesen deduciert sein, dessen Form er ist; dieses ist die Materie oder der Stoff, das ist die Natur, sofern sie die Natur in ihrem Höhern erkannt und bestimmt wird; es müsste also erkannt sein die reine nichtsinnliche Idee der Natur, als Theilidee in der Wesenschauung; es müsste also erschaut sein, dass Wesen in sich auch die Natur ist, und welches die Wesenheit der Natur ist. Wenn also erkannt wäre, dass Wesen in sich die Natur ist, und was die Natur ist, und weiter erschaut wäre, dass die Natur ein Bleibendes ist, als welches sie die Materie ist, dann ferner, dass die Natur, wie Alles, eine bestimmte Form hat; und wenn weiter auch gezeigt wäre, dass diese Form, wie ihr Gehalt, unendlich stetig, immer weiter bestimmbar sein müsse: so hätte man als die so gefundene Idee dieser Form die reine deductive Idee des Raumes. Damit ist aber gar nicht die Anschauung oder Selbschauung des Raumes, oder die Intuition des Raumes bereits mitgegeben, sondern der Raum wäre nur erst erkannt nach seiner Wesenheit in Wesen als innere untergeordnete Theilwesenheit in der Wesenheit Wesens, und diese Schauung des Raumes wäre nur erst als eine innere untergeordnete Theilschauung in der Wesenschauung erkannt. Der Geometer, der sich lediglich an die Intuition, an die selbeigne Schauung der Sache, hält, wird sich ohne alle Deduction bewusst, dass der Raum unendlich ist, dass er stetig weiter begrenzbar ist, aber er fordert dies als ein blosses Axiom, d.h. als ein Schauniss, was ein Jeder mit hinzubringen muss, und dessen Beweis man ihm erlassen soll. Aber soll die Erkenntniss dieses Gegenstandes wissenschaftlich sein im ganzen Sinne des Wortes, so muss eben ihr Gegenstand, der unendliche Raum, auf die angezeigte Weise in der Wesenschauung gefunden, das ist, deduciert sein. -Ich zeige dies noch an einem andern Beispiele. Wir haben auf dem Wege unserer Betrachtung gefunden, was Erkennen ist; dass es ist: die Vereinigung des Selbwesenlichen mit dem selbwesenlichen erkennenden Wesen als solchem. Dieser Ausdruck besagt ganz rein und nichtsinnlich, und ganz unabhängig von der selbeignen Schauung des Erkennens, was die Wesenheit des Erkennens ist; wenn nun aber dieser Gegenstand deductiv soll erkannt werden, so müsste erkannt sein, dass Wesen selbwesenlich ist, oder dass Gott das unendliche, unbedingte, selbständige Wesen ist, es müsste erkannt werden, dass Gott als Selbwesen mit sich selbst als solchem vereint ist; wäre dies erkannt, so wäre die reine Idee des Erkennens gefunden, als nämlich der Vereinwesenheit der Selbwesenheit mit sich in Wesen für Wesen selbst, als das Selbschauen, oder Selbsterkennen Gottes. Dieses Gedankens kann der endliche Geist intuitiv sich noch gar nicht bewusst sein, und ihn dennoch deductiv haben, weil er noch nicht bemerkt hat, dass dies die Wesenheit des Erkennens ist. Wenn nun aber hier noch die selbeigne Schauung der Sache dazukommt, indem der endliche Geist sich seines eigenen Erkennens inne ist, so wird dann das Deducierte auch als solches geschaut, selbgeschaut, intuirt. Oder denken wir z.B. das Licht; so kann die selbeigne Schauung davon in unserm jetzigen Zustande nur der haben, welcher ein gesundes Auge hat; aber den deductiven Gedanken des Lichts, die reine Wesenheit des Lichts kann auch der Blinde fassen, obschon ihm die selbeigene Schauung deselben, solange er blind ist, nie zutheil wird; es kann dem Blinden naturphilosophisch deduciert werden, was das Licht ist, seiner reinen Wesenheit nach, ja er kann es schon in untergeordneter Hinsicht deductiv erkennen, dass das Licht eine Thätigkeit ist, die sich im Raume von jedem Punkte aus gleichförmig verbreitet, in gerader Linie wirkend, mit bestimmter Schnelligkeit; er kann auch davon den rein deductiven Gedanken fassen, dass das Licht in sich artverschieden, das ist farbig sei, sowohl er nie eine Farbe selbst anschaut. Z.B. der Blinde Sounderson, Newtons Nachfolger. Wenn nun ein solcher Blinder diese reine nichtsinnliche deductive Wesenheit des Lichts erfasst hat, so kann er sogar die Wissenschaft vom Lichte bis auf eine bestimmte Grenze ausbilden. Auf gleiche Weise könnte ein Tauber vermöge der deductiven Erkenntniss des Schalles, wenn er den Schall bloss als vibrierende Bewegung auffasst, sogar eine Theorie der Harmonie, sobald er nur rein deductiv die reine Wesenheit derselben erfasst, was ohne die selbeigne sinnliche Schauung oder Intuition gar wohl möglich ist. Sehen wir nun nochmals darauf hin, wie die ganzwesenliche, wissenschaftliche Deduction zustandegebracht wird, so finden wir, dass dieses nur geschehen könne, gemäss dem Gliedbau der göttlichen Wesenheiten oder dem Organismus der Kategorien, indem die Kategorien auf alles Denkbare wohlgeordnet angewandt werden. Dann dienen also diese Grundwesenheiten als allgemeine Grundgesetze, wonach der Gliedbau der Wissenschaft gebildet wird, als Gliedbaugrundgesetz der Wissenschaft. Daher Kant, der in neuerer Zeit dies zuerst eingesehen hat, bemüht gewesen ist, diese obersten Grundsätze, oder Grundgesetze, einer jeden wissenschaftlchen Deduction mit Hilfe der Kategorientafel zu entdecken und systematisch darzustellen und er nennet desshalb diese obersten Grundgesetze der Forschung und des Wissenschaftbaues: synthetische Prinzipien a priori, oder auch: Prinzipien der transscendentalen Synthesis. Wie unvollkommen auch diese Kantische Arbeit, die in der Kritik der reinen Vernunft mitgetheilt wurde, ausgefallen ist, so war es doch ein grundwesenlicher Fortschritt, nur zur Einsicht dieses grossen Problems zu gelangen. Was aber die Benennung: synthetische Prinzipien a priori betrifft, so würde besser gesagt werden: synthetische Prinzipien ab absoluto, oder auch: absolut-organische Prinzipien der wissenschaftlichen Methode. Wenn nun die Wissenschaft von der Wissenschaftbildung, deren Grundlage soeben hier analytisch in und durch die Anerkenntnis des Prinzipes entwickelt wird, selbst in die Tiefe ausgebildet werden sollte, so müssten wir es schon hier unternehmen, nach Massgabe der schon gewonnenen Einsicht in die Kategorien den Gliedbau dieser synthetischen Prinzipien zu stellen. Da aber dies unserm Plane zufolge nicht geschehen kann, so bemerke ich, dass der oberste Theil der synthetischen Philosophie, welche wir nun bald beginnen, selbst das organische Ganze dieser synthetischen Prinzipien ist. Das eine Prinzip aber dieser Prinzipien, wonach sie selbst in ihrer Befugniss erkannt werden, ist folgendes: jedes besondere synthetische Prinzip der Erkenntnissbildung muss selbst an und in der Wesenheit Wesens, in der Wesenschauung, gefunden worden sein; so dass das oberste aller synthetischen Prinzipien, oder vielmehr das eine unbedingte synthetische Prinzip, Wesen selbst ist, worin und wonach das Gesetz entspringt, jeden Gegenstand der Betrachtung als wesenähnlich, das ist, gemäss den an und in Wesen selbst, als synthetische Teilprinzipien geschauten Grundwesenheiten oder Kategorien, zu erkennen. -Soviel über die erste untergeordnete Function des Determinierens.
Nun kommt zunächst zu betrachten die selbeigne Schauung (Selbschauung, Selbeigenschauung) eines jeden vorliegenden Gegenstandes, die man gewöhnlich Anschauung vorzugweise, oder Intuition nennt. Die deductive Erkenntniss, das Theilwe- senschauen oder Ableitschauen ist die Grundlage, sie ist in sich selbst gewiss und vollendet, und bedarf hierzu als deductive Erkenntniss der Selbeigenschauung keineswegs; gleichwohl aber ist die Forderung wesenlich, einen jeden Gegenstand der Forschung rein an ihm selbst zu schauen, unmittelbar, wie er selbst dem Geiste gegenwärtig ist, wie er sich als an sich selbst wesend und seiend darstellt. Der wissenschaftliche Beweis dieser Forderung ist darin enthalten, dass Alles, was Wesen an und in sich ist, auch selbwesenlich ist, wie Wesen, mithin auch als selbstwesenlich, das ist in selbeigner (oder: eigenselber) Schauung, in Intuition, erkannt werden muss. Demnach ist z.B. der Raum ansich selbst unmittelbar zu schauen; und wer diese Schauung nicht hätte, dem könnte die Deduction dazu nicht verhelfen. Das Licht muss unmittelbar geschaut werden, wie es ist, und keine Deduction könnte je die Empfindung, die unmittelbare Schauung des Lichts hervorbringen. Ebenso muss die Natur unmittelbar geschaut werden in ihrer individuellen Erscheinung; ausserdem würde die Deduction davon zwar gewiss sein, aber nicht die Anschauung der Natur selbst gewähren. Ebenso der endliche Geist muss sich selbst in selbeigner Schauung, unmittelbar und als Unmittelbares schauen; oder die Grundschauung: Ich, ist als Selbeigenschauung das unbedingte Schauen eines insofern Unbedingten.
Auch die Selbeigenschauung ist der Wesenschauung selbst vollwesenalleineigen-ähnlich; und in einer vollgliedigen Entfaltung der Schaulehre als ein Theilingliedbau der Wesenschauung zu entfalten.
Aber wenn das Ich in seiner Verhaltwesenheit selbst und ganz geschaut werden soll, so kann dieses nur an, in und durch die Selbeigenschauung dessen, woran, worin und womit zugleich es ist, also wesenlich, vollkommen nur in der Wesenschauung (geschehen).
Hiermit wird nun zunächst eingesehen, dass das endliche Erkennen überall dann von der unmittelbaren Selbeigenschauung der Gegenstände anheben könne, wenn und sofern die Gegenstände der Betrachtung selbst in wahrer Gegenwart mit dem Geist in derjenigen Beziehung stehen, welche die Bedingniss der Erkennbarkeit ist; darin ist es begründet, dass der endliche Geist in unmittelbarer Selbschauung das Endliche zu erfassen, zu erschauen vermag, ohne an die Ableitung davon in der Wesenschauung zu denken, ohne den Gedanken des höhern Grundes, selbst ohne den Gedanken: Wesen oder Gott, zu haben; ja sogar solche Bestimmtheiten des Eigenlebens, welche durch andere endliche Wesen und selbst durch Wesen als Urwesen bewirkt und gesetzt sind am endlichen Geiste und in ihm, können der Selbwesenheit jedes Schauens und jedes Schaunisses wegen, wenn und soweit sie lebwirklich gesetzt sind, unmittelbar, und als unbedingt geschaut, erkannt und anerkannt werden. Daher ist jede Selbeigenschauung, und jedes Seibeigenschauniss wesenlich, das ist göttlich und der reinen Selbwesenheit nach dem Wesenschauen selbst gleich.. Daher kommt es, dass, wie neulich schon gezeigt wurde, einzelne Wissenschaften für sich in unmittelbarer Selbschauung gebildet werden können, wie wir es an den empirischen Naturwissenschaften sehen, insonderheit aber an der durchaus übersinnlichen Wissenschaft der reinen Mathesis. Von der andern Seite aber wird auch dies hier ersichtlich, dass die Ableitung eines Gegenstandes in und durch die Wesenschauung, die Deduction, ebenfalls nicht fordre, dass der Gegenstand selbst schon geschaut werde; sowie ich neulich bereits bemerkte, dass die Deduction ohne alle Intuition des Gegenstandes selbst die ganze und allgemeine Wesenheit desselben zu erkennen vermöge. Wenn nun aber gleich in unserm endlichen Erkennen sowohl die Deduction als auch die Intuition vorausgehen, und den Anfang der wissenschaftlichen Erkenntniss machen kann, so ist doch klar, dass der sachgernässe, eigentliche Gang der vollendet wissenschaftlichen Entfaltung von der Ableitung zur Selbeigenschauung fortgehen, von der Deduction zur Intuition führe. Denn da alle Wesen und Wesenheiten gemäss der Wesenheit Wesens an, oder in und unter Wesen enthalten sind, und da sie alle darin und dadurch ihre selbeigene Wesenheit sind und haben, so muss auch die zeitliche Entfaltung der Wissenschaft diese grundwesenliche, ewige Ordnung der Wesen und der Wesenheiten nachahmen. Auch ist offenbar, dass die Einsicht, wie ein Gegenstand in Wesen ist und bestimmt ist, oder die deductive Einsicht in denselben, dem Geiste den Weg zeigt, wonach auch die Selbeigenschauung des Gegenstandes gefunden und weitergebildet werden kann. Dies Verhältniss ist z.B. selbst in der mathematischen Wissenschaft ersichtlich, welche doch bisher überwiegend in der Selbeigenschauung des Gegenstandes gebildet worden ist; nicht eher aber konnte diese Erkenntnis wissenschaftliche Gestalt, und organischen Charakter, gewinnen, als bis in deductive Erkenntniss die Grundgesetze gefunden worden waren, welche auch an der eigenthümlichen Wesenheit dieses Gegenstandes dargestellt sind; daher denn auch dieses wissenschaftliche Ganze der Mathesis erst dann vollwesenlich gebildet werden kann und gebildet werden wird, wenn die Deduction der Grundschauung dieser Wissenschaft in der Wesenschauung in organischem Zusammenhange geleistet sein wird, d.h. wenn die Ganzheit, Grossheit, und Zahlheit, wenn der Raum, wenn die Zeit, und die Bewegung deductiv erkannt sein werden.
Es ist von grosser Erheblichkeit für die Wissenschaft und das Leben, dass dieses eingesehen, und stets inne erhalten werde. Dann erhellet der wahre Werth des Beweises endliche Wahrheit, und der Beweisführung derselben, der Demonstration. Dann erkennt man das worin und wodurch die Beweisführung (Deduction und Demonstration) ist, und woran sie ist. -Dann sieht man auch das wahre Verhältniss der untergeordneten Wissenschaften zu der einen Wissenschaft ein, und kann auch den wahren Werth, ja die göttliche Würde der echten Anschauung des Eigenlebens, des Individuellen und der Individualität einsehen, und die ganze Wesenheit und Bedeutung der Geschichtwissenschaft, und aller rationalen empirischen Wissenschaft anerkennen.
Dies also ist der eigentliche Gang der vollendeten Wissenschaft. Wenn es aber nicht möglich wäre, dass Intuition auch ohne Deduction erfasst und ausgebildet würde, so könnte ein Geist, der in die sinnliche Wahrnehmung zerstreut, sein selbst und Gottes vergessen ist, nie wieder zur wesenhaften Erkenntnis Gottes und seiner selbst gelangen. Hiervon ist unser ganzer ana- lytischer Weg bis hierher das thatsächliche Beispiel; denn von der Selbschauung des Ich ausgehend, gingen wir von Selbschauung zu Selbschauung fort, bis wir uns endlich der unbedingten, unendlichen Schauung Gottes bewusst wurden. Da nun die Selbeigenschauung und die Ableitung selbwesenliche Theilverrichtungen sind in der Grundverrichtung des Schaubestimmens oder Determinierens, so kann alle Erkenntnissbildung, auch die eigentliche Wissenschaft, keine nach ihren inneren Theilwesenheiten vollwesenliche Fortbildung gewinnen, ohne dass diese beiden Theilfunctionen selbst zugleich weiter fortgesetzt werden; -weder ohne Deduction, noch ohne Intuition kommt die Wissenschaft als vollwesenliche gliedbauliche Erkenntniss aus der Stelle, und in die weitere Tiefe des Gegenstandes. Merken wir noch auf die verschiedenen Gebiete der Selbeigenschauung, der Intuition, so zeigt sich zunächst das Gebiet der sinnlichen Selbeigenschauung, der empirisch-historischen Intuition. Wenn nun erstens bei einer bestimmten Intuition die Absicht ist, das vollendet Endliche, in der Zeit Bestimmte, Eigenlebliche, Individuelle als solches zu schauen, so waltet bei diesem Streben nach Erkenntniss die Selbeigenschauung vor und die deductive Erkenntniss des Gegenstandes erscheint dann zunächst als Mittel. Dies ist bei dem Auffassen der sinnlichen Wahrnehmungen jedesmal nothwendig der Fall; denn wir haben gefunden, dass eine jede sinnliche Wahrnehmung nur mitteist der höchst allgemeinen ewigen Schaunisse und Begriffe nach ihrer Bestimmtheit erfasst werden kann, indem selbst im vorwissenschaftlichen Bewusstsein die deductiven Grundgedanken der Grundwesenheiten oder Kategorien
dem Geiste gegenwärtig sind, und ihn bei der Intuition des Sinnlichen leiten. Bei diesem Auffassen der sinnlichen Wahrnehmungen kommt es zunächst bloss darauf an, sie in ihrer gegebenen unendlichen Bestimmtheit theilweis zu erkennen. Die Selbeigenschauung waltet aber bei der Erkenntnissbildung zeitlich individueller Gegenstände auch dann vor, wenn wir das sinnlich gegebene Individuelle auf diejenigen ewigen Begriffe beziehen, welche das enthalten, was an diesem zeitlich gegebenen Individuellen wirklich werden soll, das ist, auf die Urbegriffe, oder Ideen. Dann beurtheilen wir das zeitlich Individuelle nach seinem ewigwesenlichen Gehalte, indem wir, es mit der Idee vergleichend, abschätzen, was daran der Idee gemäss ist, und was derselben widerstreitet. Wenn aber zweitens bei der Selbeigenschauung des Individuellen es nicht darauf abgesehen ist, das Individuelle als Individuelles zu erkennen, sondern wenn es darauf ankommt, im Individuellen die Darstellung des Allgmeinen und Ewigwesenlichen zu schauen, so erscheint umgekehrt die individuelle Intuition zunächst als Mittel für den rein übersinnlichen Gedanken. Dies ist überall dann der Fall, wenn wir begrifflich, und überhaupt, wenn wir übersinnlich zu erkennen beabsichtigen; denn es stellt sich dann immer ein sinnliches Bild irn Geist ein, welches ein (Schema) oder Begriffbild genannt wird. Die Figuren, wodurch der Geometer seine allgemeinen, ewigen Wahrheiten erläutert, sind ein grosses Beispiel hiervon. Die individuelle Selbeigenschauung erscheint auch zunächst als Mittel zu der Versinnlichung der reinen, ewigen Urbegriffe oder Ideen. Wollen wir eine Idee schauen, es sei z.B. die Idee des Staates, so ist die Absicht, das Ewigwesenliche zu erkennen, was der Staat in aller Zeit darstellen soll; dann versinnbilden wir diese Idee, indem wir ein Urbild, ein Ideal davon entwerfen; dies Ideal ist eigenleblich anschaulich, individuell intuitiv, es ist ein vollendet Bestimmtes, nach seiner eignen Wesenheit Geschautes. Hier wird aber die Intuition des Urbildes durch die Deduction bestimmt, d.h. durch die in der Wesenschauung erkannte alleineigentümliche Wesenheit des Rechts und des Staates. Wenn es aber darauf ankommt, sowohl das zeitlich Individuelle zu erkennen, dass und wie es an sich und in sich seinen ewigen Begriff darbildet, als auch zugleich den ewigen Begriff, dass und wie selbiger an und in dem zeitlich Individuellen dargebildet erscheint: so ist in dieser zweiseitigen, gleichförmig gestalteten Erkenntniss Ableitung und Selbeigenschauung, Deduction und Intuition, gleichwesenlich, sie sind sich dann wechselseitig Zweck und Mittel.
Dieses nun sind die beiden sich entgegenstehenden höchsten Theilverrichtungen, durch welche unsere Erkenntniss weiterbestimmt determiniert wird. Damit aber ist die Erkenntniss noch nicht in die Tiefe vollendet, sondern es entspringt nun die dritte Forderung: Dasjenige, was abgeleitet, deduciert ist, mit demjenigen vereinzuschauen, was selbeigengeschaut, intuiert wird. Dadurch nur kommt vollwesenliche Erkenntniss des Gegenstandes zur Wirklichkeit, dass das Schauen aus diesen beiden Grundtheilen vereingebildet ist. Wenn rein in Wesen geschaut, das ist, deduciert wäre, dass in Wesen zwei oberste, sich entgegengesetzte, in ihrer Art unendliche Wesen enthalten seien, und wenn von der andern Seite selbeigengeschaut oder intuiert würde, dass die obersten Wesen, welche uns im unmittelbaren Selbstschaun gegenwärtig sind, die Natur und die Vernunft seien, so ist damit immer noch nicht erkannt, dass Vernunft und Natur eben jene beiden obersten Wesen in Gott seien, welche deduciert wären. Oder in der Natur durch alle Prozesse hindurchwirkend dieselbe sei, und wenn von der andern Seite das Licht selbeigengeschaut, intuiert wäre, als diejenige Naturkraft, welche sich als die allgemeinste erweiset, so wäre hiermit noch nicht erwiesen, dass jene deduzierte höchste Naturkraft, worin die Natur als ganze wirkt, eben das Licht seie, welches uns in unmittelbarer Intuition einleuchtet. Da mithin die Deduktion mit der Intuition zusammengebildet vereingebildet, gleichsam vereingebaut, construiert werden muss, um die Erkenntniss zu vollenden, so ist die Schauvereinbildung als die dritte Theilverrichtung der Schaubestimmung, oder Determination, grundwesenlich, und sie ist zugleich die letzte der Theilverrichtungen, in welcher die Schaubestimmung vollgebildet ist, da sie die beiden sich entgegenstehenden Grundschauungen, die reine Schauung des Gegenstandes in der Wesenschauung, und die Selbeigenschauung desselben als das beiden Grundwesenliche (die beiden Elemente) aller Erkenntniss des Endwesenlichen in Wesen, in eine Schauung vereiniget und vereinbildet. Daher hat man diese Verrichtung Vereinbauung oder Construction genannt, indem man dieses Wort von der mathematischen Erkenntniss entlehnte, wo es längst schon gebräuchlich war, da gerade in dieser Wissenschaft die Theilverrichtungen der Deduction und der Intuition am leichtesten zu fassen sind, zugleich aber auch deren Vereinbildung, die Construction, die sich als durchaus unentbehrlich ankündigt, sobald der Mathematiker erfindend weiterschreiten will. In dieser Hinsicht ist zu bemerken, dass man gewöhnlich irriger Weise meint, der Gehalt der Construction müsse ein vollendet Endliches, Sinnliches sein, indem man sich zu dieser Behauptung durch den Umstand verleiten lässt, dass dem Mathematiker bei seinen Constructionen allerdings ein bestimmtes sinnliches Schema vorschwebt. Wenn man aber bemerkt, dass die sinnliche Bestimmtheit dieser Schemen nur zur Erläuterung der allgemeinen Anschauung, nie aber zum Beweise dient, so wird man wahrnehmen, dass auch in der Mathesis die Construction, sofern es allgemeiner Wahrheit gilt, die Vereinigung ist von rein deductiven allgemeinen Gedanken mit rein intuitiven allgemeinen Anschauungen. Denn sowie überhaupt die Selbeigenschauung des Gegenstandes an sich die selbeigne Theilwesenschauung des Gegenstandes ist, welche in ihrem innern Gliedbau allerdings auch die allgemeinwesenliche oder begriffliche, nebst der (zeitlich individuellen) Schauung des Gegenstandes in und unter sich begreift, so ist auch die Selbeigenschauung der Gegenstände der mathematischen Wissenschaft ursprünglich die Theilwesenschauung derselben, welche dann auch die allgemeinwesenliche oder begriffliche, nebst der diese letztere begleitenden zeitlich individuellen schematischen oder begriffbildlichen Schauung, in und unter sich hält. -Ich verstehe demnach hier das Wort: Schauvereinbildung oder Construction so, dass es die ganzwesenliche Vereinbildung des Abgeleiteten, Deductiven, mit dem SeIbeigengeschauten oder Intuitiven bezeichnet, es mag nun dies Intuierte eine ganzwesenliche, urwesenliche, allgemeinwesenliche, oder eine individuelle Schauung sein.
Untersuchen wir nun zunächst, worauf es bei der Vereinbildung der beiden Elemente des Schauens in die Construction ankommt, so zeigt sich, dass zwei Hauptwesenheiten es sind, wodurch die Construction vollendet wird. Denn es soll durch die Construction die Vereinigung zweier unterschiedenen Reihen der theilweisen Erkenntniss bewirkt werden. daher entspringt die erste Forderung, dass die entsprechenden Glieder der Reihe der Intuition mit den entsprechenden Gliedern der Reihe der Deduction in Verbindung gesetzt werden. Wenn nun aber ein entsprechendes Glied der einen Reihe mit dem entsprechenden Gliede der anderen vereingedeckt ist, so müssen dann zweitens diese beiden vereinten Schaunisse, als vereinte, weiterbestimmt werden. Also richtiges Zusammenfassen und Vereinschauen der entsprechenden Glieder, und alsdann gesetzliche Weiterbildung der Erkenntniss dieser entsprechenden vereinten Glieder sind die beiden Grundwesenheiten, in welcher jede wissenschaftliche Schauvereinbildung oder Construction besteht. Ich erläutere dies durch das Beispiel der Naturwissenschaft. Gesetzt es wäre in reiner Deduction naturphilosophisch die ganze Idee der Natur abgeleitet; es wären darin weiter erkannt worden die ganze Folge der Naturthätigkeiten und die Stufenfolge der Naturprozesse, alles jedoch ohne Selbeigenschauung davon, rein in der Wesenschauung; und gesetzt von der andern Seite, der denkende Geist hätte das ganze Leben der ihn umgebenden Natur in unmittelbarer Intuition gesetzmässig und sorgfältig durchforscht: so entspringt nun die Aufgabe für die Construction, zu zeigen, wie der Gliedbau dieser unmittelbaren Intuitionen nach allen seinen Gliedern dem Gliedbau der deductiven Erkenntnisse der Natur gemäss sei, welcher Idee das Licht, welcher die Schwere, welcher die Pflanze, welcher das Thier, entspreche. -Hierbei aber ist vielfaches Missgreifen möglich, wodurch alsdann die Construction verfehlt und verfälscht wird. Und zwar ist dieses Fehlgreifen überhaupt in der ganzen Wissenschaftbildung um so leichter möglich, wenn einzelne Wissenschaften ausser dem Zusammenhange der ganzen Wissenschaft, in theilweiser Construction gebildet werden sollen. Wird aber ein solcher Missgriff in der Beziehung der Glieder der beiden entgegenstehenden Grundreihen der Schauung einmal gemacht, so zieht er alsdann derjenigen Wissenschaft, in deren Gebiet der Gegenstand dieses Missgriffs gehört, soweit dieses Gebiet reicht, eine Fehlbildung zu, und mitveranlasst Irrthum. Hiervon giebt die Geschichte der Wissenschaft viele Beispiele. Aber wenn überhaupt Wissenschaft gelingen soll, so muss es möglich sein, dieses Fehlgreifen zu vermeiden. Dies wird vermieden werden können, wenn die beiden Reihen der Deduction und der Intuition gleichförmig vollständig ausgebildet werden. Und dies ist möglich aus folgendem Grunde. Wesen ist in sich und durch sich auch Alles, was ist, nach einem Gesetz, denn Wesen ist in sich wesenheitgleich; und dieses eine Gesetz wird als der Organismus seiner Theilgesetze erkannt, wenn die Grundwesenheiten Wesens, oder die Kategorien erkannt sind. Wenn also diesem einen Gesetz des Gliedbaues der göttlichen Wesenheiten gernäss sowohl die Reihe der Deduction als auch die Reihe der Intuition jede für sich gebildet werden, so müssen die entsprechenden Glieder beider Reihen dem wissenschaftbildenden Geiste sich darstellen. Da aber in den bisherigen philosophischen Systemen der Gliedbau der göttlichen Grundwesenheiten nur unvollständig und nicht in der wesenheitgemässen Ordnung erkannt worden ist, so wird dadurch zuvörderst die deductive Reihe fehlerhaft, und die Glieder der intuitiven Reihe, welche in unmittelbarer Selbschauung erfasst werden, die sich nach jenen mangelhaften, deductiven Einsichten nicht bequemet, werden hernach in jene nach Gehalt und Form mangelhafte Reihe der Glieder der Deduction sachwidrig hineingefügt, und so der ganze Wissenschaftbau fehlerhaft gebildet. Ueberhaupt die Verschiedenheit der bisherigen philosophischen Systeme beruht hauptsächlich in diesen beiden Punkten: erstlich darin, dass die Grundgesetze der Wissenschaftbildung, die Prinzipien der Synthesis oder der Deduction, auf grundverschiedene Weise gefasst werden; zweitens aber auch darin, dass in verschiedenen Systemen verschiedene Glieder der intuitiven Reihe für verschiedene Glieder der Deduction entsprechend geachtet werden; daher dann auch Verschiedenheit der Grundansichten über Alles Das entsteht, was in unmittelbarer Selbschauung dem Geiste sich darbietet. Daher die verschiedenen Grundansichten über das Verhältniss von Vernunft und Natur, von Geist und Leib, zueinanderund zu Gott, wonach das eine System behauptet, die Vernunft oder das Geistwesen seie der Natur übergeordnet, dagegen das andere, es seie das Geistwesen der Natur untergeordnet, und das dritte, beide seien in gleicher Stufe nebengeordnet in Gott[22]. Daher auch die verschiedenen Ansichten über die verschiedenen Theile der menschlichen Bestimmung, z.B. über den Staat, den Religionverein, über das Verhältniss von Mann und Weib. Wer aber das gemeinsame Gesetz dieser beiden Reihen kennt, und sie in ihren Grundgliedern richtig miteinander in Verein gebracht hat, der ist nicht nur sichergestellt gegen irrige Grundansichten, sondern er vermag es auch, die Grundverschiedenheiten aller gedanklichen philosophischen Systeme, selbst organisch, mit combinatorischer Vollständigkeit zu entwickeln.
Soviel in Ansehung des ersten Moments der Construction , dass die entsprechenden Glieder der deductiven und der intuitiven Reihe zusammen vereint werden. Betrachten wir noch kurz das zweite, welches darin besteht, dass die miteinander vereinten Glieder der beiden Grundreihen des Erkennens sich einander wechselbestimmend miteinander in wechselseitiger Durchdringung fortschreiten, so dass von da an Deduction und Intuition immer nebenschreitend, parallel weitergebracht werden. Ich erläutere dies durch einige Beispiele. Gesetzt der Gegenstand wäre der Raum, und es wäre erstlich rein in der Wesenschauung die ganze Theilwesenschauung, und der ewige Begriff des Raumes gefasst, als der Form des Leiblichen, sofern das Leibliche ein bleibendes Ganzes ist, mithin als Form der Natur, sofern sie Stoff, Materie ist; es wäre von der andern Seite auch die unmittelbare Selbschauung des Raumes, die Intuition des Raumes, im Bewusstsein gegeben; und als erstes Moment der Construction wäre anerkannt, dass dieses selbwesenlich Geschaute, Intuierte, jenem in der Wesenschauung Erfassten, Deducierten entspräche: so träte dann das zweite Moment der Construction ein, dass dieses Beides, welches nun als ganz Dasselbe anerkannt wäre, sich wechselseits durchdringend bestimme, dass nun die Deduction und die Intuition des Gegenstandes, gleichsam sich die Hand bietend, und nebeneinander gehend, in die Tiefe fortschreiten. So würde dann z.B. deductiv weiter erkannt, dass der Raum als Form der Natur, sofern sie leiblich ist, Einheit, Selbheit, Ganzheit und Vereinheit hat; dass der Raum die Formeinheit oder Satzheit-Einheit des Leiblichen als solchen, dass er also unendlich ist, nach dem synthetischen Prinzipe, dass jede Form ihrem Gehalte gemäss ist; und zugleich würde auch die Selbeigenschauung des Raumes darnach bestimmt, und die bloss unbestimmte aber bestimmbare Schauung des Raumes in Phantasie dadurch zur Unendlichkeit gleichsam erweitert. Ferner würde dann deductiv erkannt werden, dass die Form des Leiblichen stetig ist, weil ihr Gehalt, das Leibliche, ganzselbwesenlich rein in sich Das ist, was es ist; wird dann hingesehen auf den angeschauten Raum und bemerkt, wie sich dies in der Anschauung erweiset, so findet sich, dass sich dies in der Stetigkeit der Ausdehnung zeigt, wodurch zugleich miterkannt ist, dass der Raum im Innern ein unendliches Theilbares ist. Ferner zeigt sich in der deductiven Schauung des Raumes, dass der Raum im Innern begrenzbar ist, weil das Leibliche, als solches, in seinem Innern begrenzbar ist, als welches zuvor deductiv bewiesen sein muss.
Hiernach wird nun wieder die Selbeigenschauung des Raumes bestimmt, wo sich dann die innern Raumgrenzen der dreistreckigen Ausdehnung zeigen in Länge, Breite und Tiefe, -die Punkte, die Linien, die Flächen. Alles dies giebt die Deduction, wenn sie gesetzmässig fortgesetzt wird, der reinen Theilwesenschauung und dem ewigen Begriffe nach, aber sie giebt nimmer die Intuition der Sache, welche gemäss der fortgesetzten Deduction selbst gesetzmässig fortgesetzt wird, indem der wissenschaftbildende Geist nun immer zusieht, wie sich das Deducierte an dem Intuierten weiset und darthut; und so wird die Wissenschaft, in unserm Beispiele die Geometrie gebildet. Die eine ganze Wissenschaft aber soll ein Ganzes der Construction oder der Schauvereinbildung sein, und soll auf diese gesetzmässige Weise ohne Ende in die Tiefe der Wesenheit, als immer tiefere, reichere Wahrheit, fortgesetzt werden. Und daher ist offenbar, dass in einem guten Sinne gesagt werden kann, der die Wissenschaft construierende Geist schaffe die Welt für sich zumtheil noch einmal nach, wenn nur von dem Schaffen der Erkenntniss die Rede ist; -denn nicht die Welt schafft er oder sich selbst, sondern die Erkenntniss davon, worin, wenn die Wissenschaft gesetzmässig gebildet wird, der Gliedbau der Wesen erscheinet, wie er ist. Gröblich aber hat man diesen Anspruch dahin missgedeutet, als wolle der construierende Philosoph sich für einen Weltschöpfer ausgeben; ebenso hat man auch das Vorhaben der wissenschaftlichen Construction dahin missverstanden, als getraue sich der philosophierende Geist, die unendlich bestimmte zeitliche Individualität der Dinge als solche, wissenschaftlich zu deducieren, zu demonstrieren, zu construieren. Denn als in neuerer Zeit die Idee der wissenschaftlichen Construction zuerst von Kant geahnet, hernach von Schelling und Andern klarer und bestimmter erkannt, und in bestimmten wissenschaftlichen Versuchen angebahnt wurde, so verlangte man von den Philosophen, sie sollten doch z.B. construieren, die ganze geschichtliche Bestimmtheit dieser Erde, dieses Sonnensystems, oder auch nur die geschichtliche Indivdidualität des construierenden Philosophen selbst. Die dieses Fordernden bemerkten nicht, dass die wissenschaftliche Construction selbst lehrt, dass alle Individualität, alles im Leben unendlich Bestimmte hervorgeht in der einen göttlichen unendlich und unbedingt freien zeitlichen Verursachung, und im Zusammenwirken untergeordneter Wesen, welche mit endlicher Freiheit zeitlich wirksam sind; dass es also ausserhalb des Erkenntnissvermögens endlicher Geister liegt, die Geschichte des Individuellen, sei es ein Sonnenheer oder ein Gewimmel von Kleinthieren, wissenschaftlich nachzuweisen; dass also die philosophische Construction es durchaus nicht zu thun hat mit dem geschichtlich Individuellen als solchem, sondern dass ihre Aufgabe in Ansehung des Individuellen nur ist: zu erkennen, dass alles Individuelle, dass das eine unendliche Leben, mit unendlicher Bestimmtheit im Weltall allaugenblicklich hervorgeht in der heiligen Freiheit Gottes; und dass sie die Gesetze erkenne, nach welchen Gott selbst als das unendlich und unbedingt freie Wesen, in der Zeit selbstthätig gestaltet, und nach welchen auch alle endlich freie endliche Wesen das Eigenlebliche in der Zeit bilden. Ebenso forderte man von den Philosophen, welche die wissenschaftliche Construction unternahmen, sie sollten doch die Grössenverhältnisse der wirklichen Dinge construieren, und z.B. nachweisen, warum ein jeder unserer Planeten so gross ist, als er gefunden wird, warum von den verschiedenen Arten der Thiere auf Erden eine jede gerade diese bestimmte Grösse halte, warum die Maus nur so gross, der Elephant aber weit grösser sei. Sie bemerkten wieder nicht, dass der construierende Philosoph es hierbei nicht zu thun hat mit der individuellen absoluten Grösse, sondern nur mit Grössenverhältnissen als solchen, auch nicht mit den individuellen Grössen, worin sie dargestellt werden. Der Philosoph aber, der die Wesenheit der Construction kennt, wird hierauf erwidern: allerdings masse er es, nicht zwar sich, sondern der die Wissenschaft bildenden endlichen Vernunft an, die Grundgesetze aller Verhältnisse zu erforschen, als z.B. den Grund anzugeben und das Mass, wonach auch die verschiedenen Individuen des Himmels und die verschiedenen Gattungen der Thiere geordnet sind; -und allerdings hat sich seit jener Zeit ausgewiesen, dass die naturphilosophische Construction wohl das Mass dieser Verhältnisse finden kann. Dies beweist die naturwissenschaftliche Stöchiometrie, wo nun die Grundgesetze der chemischen Mischungen der Zahl und Grösse nach zum Theil so gefunden sind, wie die Naturphilosophie es lehret; das beweist die Theorie der Musik, wo die ewigen Gesetze der Zahlenverhältnisse philosophisch deduciert und construiert worden sind, welche in ihrer Bestimmtheit als Melodie und Harmonie das musikalisch Schöne geben. -Soviel über die Construction als das letzte Moment der dritten Grundfunction des Erkennens, womit die ganze Verrichtung des Erkennens und Denkens organisch abgeschlossen erscheint.
Nun noch einige allgemeine Bemerkungen in Ansehung der drei Theilfunctionen des Denkens, besonders in Ansehung ihres wechselseitigen Verhältnisses.
Erstlich, die Wesenschauung selbst oder der Grundgedanke des Prinzipes, ist vor und über der Entgegensetzung dieser Functionen und ohne selbige; denn sie ist die ganze, selbe, unbedingte Schauung, innerhalb welcher erst die Glieder dieses Gegensatzes, das ist, die Deduction und Intuition und die Vereinigung der Glieder dieses Gegensatzes,das ist die Construction, enthalten, dadurch begründet, dadurch möglich sind, und worin und wodurch sie in die Wirklichkeit des wahren Wissens hervorgehen.
Zweitens, alle drei Theilfunctionen gehen mit und neben einander parallel, vorwärts in die Tiefe, und nur durch die stetige, sprunglose, lückenlose Weiterbildung dieser drei Functionen wird Wissenschaft gebildet.
Drittens, der Geist ist ausserdem frei in Ansehung der Fortbildung der Deduction und Intuition; der betrachtende Geist kann anheben von der Intuition eines Gegenstandes, und dann die Deduction dazu bringen, er kann auch die Deduction vorausgehen, und dann erst die Intuition folgen lassen; aber die Construction fordert beide, Deduction und Intuition, und setzt beide in nebengehender, entsprechender Ausbildung voraus. Ferner, das allgemeine Grundgesetz der Wissenschaftbildung ist: dass an sich die Deduction das Ehere sei; denn an allen endlichen Wesen und Wesenheiten ist das Erste dies; dass Wesen sie in sich ist, oder dass sie in, unter und durch Wesen sind. Daher ist auch das Erste der Erkenntniss der Wahrheit des Endlichen , dass erkannt werde, dass und wie es in Wesen ist, das ist, dass es deduciert werde. Aber von der andern Seite ist anzuerkennen, dass die Wirklichkeit des Lebens uns die göttliche Wesenheit in unendlicher Bestimmtheit, in unendlichem Reichthume, in unendlicher Frische darstellt, dass daher der Geist ebenso eifrig bemüht sein soll, rein die unendliche Bestimmtheit des Lebens an sich selbst, um der Alleineigenwesenheit und göttlichen Selbstwürde des Lebens willen, in sich aufzunehmen, da alle philosophische Construction die Individualität des Lebens als solche weder jemals erreichen kann, noch überhaupt erreichen soll.
Viertens, je organischer in der Wesenschauung die Ableitung oder Deduction geleistet wird, und je reicher, organischer und ausgebildeter dabei die Selbeigenschauung oder Intuition ist, desto organischer und reichhaitier kann auch die Construction sein, und die durch diese drei Theilfunctionen der dritten Grundfunction des Denkens zu bildende Wissenschaft. Aber jeder Mangel und jeder Irrthum in Ansehung dieser drei Momente verbreitet sich nothwendig abwärts durch den ganzen Gliedbau der Wissenschaft, insofern alles Untergeordnete durch sein Uebergeordnetes, und alles Nebengeordnete auch wechselseits mit und durcheinander, bedingt ist im gemeinsamen Uebergeordneten.
Alles muß, wenn es wahr erkannt, gedacht werden soll, so gedacht werden, wie es an oder in unter Gott ist. Der Bau Gottes an und in sich ist die Grundlage für den Bau des wahren Denkens.
Aus der Grundwissenschaft ergibt sich daher eine neue Logik, die Inhaltslogik[23]. Der Bau des Denkens ist vollgleich dem Bau Gottes an und in sich.
Eine Vollendung der Physik setzt voraus, daß die nach diesen Denkgesetzen arbeitet, weil sie ansonsten in bestimmter Hinsicht mangelhaft bleiben muß.
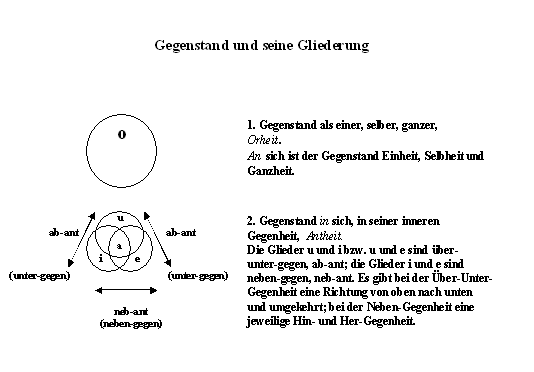
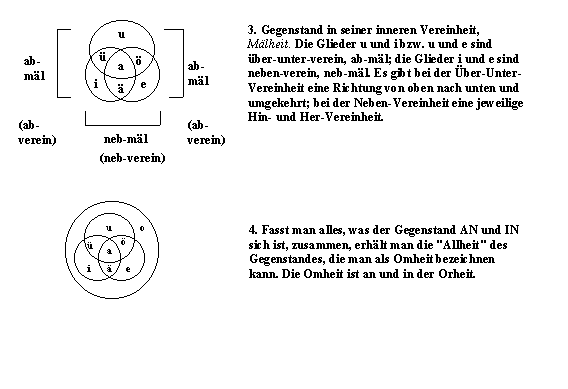
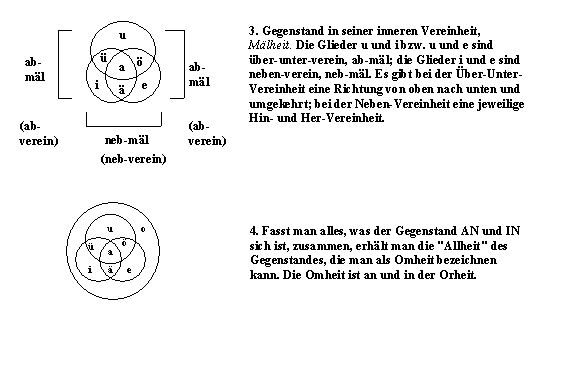
Lehrs. Der Gliedbau des Denkgesetzes entspricht dem Gliedbau der Wesenheit, das ist der Categorien. Die obersten in dem einen Denkgesetze (§89) enthaltenen Denkgesetze sind daher bestimmt: durch die Wesenheit, vor und über deren innerer Gegenheit (Entgegensetzung); durch die Gegenwesenheit, d.i. durch die Wesenheit in der Gegenheit; und durch die Verein- wesenheit, d.h. durch die Wesenheit in der Vereinsetzung. Sie sind also: das Denkgesetz der gesetzten Wesenheit (Thesis), das der Gegenwesenheit (Antithesis), und das der Vereinwesenheit (der Synthesis). Alle diese Kategorien sind vorne ausfühtrlich unter 3.1. abgeleitet worden.
Da ferner die Wesenheit wieder in sich ist (hält) die materialen Categorien der Ganzheit, der Selbheit, der Einheit, und der Ursachlichkeit, und die formalen Categorien der Satzheit, der Richtheit und der Umfangheit (§72, S.55 f.), so ist auch jedes der drei genannten obersten Denkgesetze weiter nach allen diesen Categorien, und zwar nach jeder einzeln, und nach jeder vereint mit jeder und mit jeder vereinten, bestimmt. Da endlich alle Categorien auf alle angewandt werden müssen, so müssen auch alle Denkgesetze auf alle Denkgesetze bezogen und angewandt werden; auch müssen sie eben desshalb sich alle wechselseits voraussetzen und fordern, und alle können nur zugleich gelten, keines aber allein (in abgeschiedener Alleinständigkeit, isoliert) ohne das andere.
(der Satzheit; der Thesis s. positio) ist, als Selbschauniss gedacht und ausgedrückt: Wesen; und in Form des Urtheiles geschaut und bezeichnet: Wesen zu Wesen, oder Wesen ist Wesen. Darin sind enthalten die Sätze: Wesen ist Wesenheit, Wesen ist Ganzheit u.s.f. nach allen Categorien. Und darin ist weiter enthalten das auf alles Denkbare sich beziehende Denkgesetz: Alles und Jedes, was ist (und erkannt wird), ist das, was es ist; oder: A ist A; dann auch: jedes A ist und hat Wesenheit, Selbheit, Ganzheit, u.s.f. Anm. I. Dieses Denkgesetz wird rein anerkannt und ausgesprochen in Form des Selbschaunisses: Wesen, jedes Wesen, jede Wesenheit; aber durch Selbstbeziehung erhält selbiges die Form des Urtheiles[24].
Anm. 2. Man nennt den Satz: A ist A, den Satz der Identität; und als Gesetz betrachtet, das Prinzip der Identität. Dieser Satz muss aber unterschieden werden von dem Satze: A = A (d.i. A ist wesenheitgleich A), als dem Satze der Gleichwesenheit oder die äussere Wesengleichheit des Subjects des Satzes mit einem Anderen, der Zahlheit nach von ihm Unterschiedenen, gemeint ist. Hinsichtlich Wesens bezeichnet A = A die innere Gleichwesenheit.
Anm. 3. Mit dem Satze: A ist A, ist allerdings, wenn A ein in irgend einer Hinsicht Endliches und Eigenwesenliches ist, dem Sachgrunde nach zugleich gegeben der Satz: A ist -Nicht A, den man den Satz des Widerspruchs nennt; allein der Form nach gehört dieser Satz dem zweiten Denkgesetze an.
(der Antithesis, s. princip. oppositionis) ist; Wesen ist in sich Gegenwesen; oder eigentlich in der Form des Selbschaunisses: Wesen als Gegenwesen. Und angewandt auf alles und jedes Untergeordnetwesenliche als Endliches ist es: Jedes Wesen, und jede Wesenheit, ist in sich ein Gegenwesenliches oder Entgegengesetztes; oder: alle Wesen und Wesenheiten stehn unter der Form der Entgegensetzung (der Gegenheit).
1. Setzt man Nicht-A gleichgeltend für: Entgegengesetztes von A, oder: Gegen-A, so ist das allgemeine Urtheil: A zu Nicht- A, hinsichts Wesen selbst nur nach innen, und nur insofern gültig, dass das Nicht-A ein hinsichts Wesens Inneres Bestimmtes, Endliches, dennoch aber Wesenliches, und mit Wesen selbst der Rein-Wesenheit nach Einstimmiges ist.
Wird aber als A nicht Wesen selbst, als solches, sondern irgend ein jedes ihm Inneres, Untergeordnetes gedacht, so steht dessen Gegenheit selbst wieder unter dem Gesetz der Gegenheit, indem diese sowohl eine innere, als auch eine äussere ist.
2. Die Gegenwesenheit ist nur als in und an dem seIben, ganzen Wesenlichen, was nach dem ersten Denkgesetze gesetzt ist. Sie ist die Form des inneren Bestimmens (Definierens, Determinierens ), und geschieht nach dem ganzen Gliedbau der Categorien, und zwar nach allen einzelnen und nach allen vereinten Categorien zugleich. Der Wesenheit nach ist das Entgegengesetzte (Gegenheitliche), als solches, von bestimmter Art, es ist Eigenwesenliches; welches letztere dessen Kennzeichnendes (Characteristisches) ausmacht, und dessen äussere Unterschiede bestimmt (als differentia propria aut specifica aut indivi- dualis). Hinsichts der Selbheit ist alles Entgegengesetzte Gegenselbheitliches; das ist: alle Gegenheit ist bezuglich (bezugig, relativ) .Nach der Ganzheit ist alles Gegenheitliche, als solches, Theil und Glied (pars, membrum, terminus) , obgleich wieder in sich ein untergeordnetes Ganzes. Nach der Einheit ist es ein Einzelnes oder Besonderes nebst seinem Gegeneinzelnen oder Gegen-Besonderen im gemeinsamen höheren Einen. Nach der Satzheit ist es Gegengesetztes (contrapositum, oppositim, contrarium). Nach der zur Satzheit gehörigen formalen Categorie der Jaheit und Neinheit (positio et negatio) ist das Entgegengesetzte zugleich ein Bejahiges (Bejahtes, positivum) und ein Verneiniges (Verneints, negativum); da in selbigem sein Eigenwesenliches bejaht, sein Gegeneigenwesenliches aber verneint ist. Nach der Richtheit (oder Bezugheit) ist es entweder unterordnig (subordinative) oder nebenordnig (coordinative), oder unternebenordnig (cosubordinative s. oblique) Entge- gengesetztes; und zwar mit Unterscheidung der inneren Gegenheit der Richtung (positivitas et negativitas directionis), von oben nach unten und von unten nach oben, zur Seite hin und her, und schiefabwärts und schiefaufwärts. Endlich nach der Umfangheit (besser: Fassheit; ambitus, latitudo) ist es begrenzt (finitum, definitum, limitatum) und dabei gegenumfangig, das ist, es ist an ihm das Innen und das Aussen wechselseitig entgegengesetzt.
3. Daher entspringen zwei materiale Prinzipien aller Forschung. a) Das synthetische Princip: soll A in seiner innern Gegenheit erkannt werden, so bestimme dessen Eigenwesenliches unter der Form der Gegenheit weiter nach allen Categorien. Und b) das analytische Princip: soll A nach seiner äussern Gegenheit erkannt werden, so vergleiche dessen ganzes Wesenliche nach allen Categorien mit dem Wesenlichen seines Entgegengesetzten, um das bezugliche Gegen-Eigenwesenliche Beider festzustellen. (Principium specificationis et individuationis).
4. Der Gegensatz steht ferner auch in der Hinsicht unter seinern eignen Gesetze, wonach selbiger sowohl ein unterordniger oder ein nebenordniger oder ein unternebenordniger ist. (Siehe zuvor unter 2. ) Der unterordnige Gegensatz aber ist von dem nebenordnigen wesenlich der Art nach verschieden. Der unterordnige Gegensatz ist selbst wiederum zweifach.
5. Denkt man nun zuförderst A im Allgemeinen und im Ganzen in seiner Gegenheit nach aussen, den unterordnenden und nebenordnenden Gegensatz nicht unterscheidend, aber dennoch beide als noch ununterschieden in Gedanken befassend, so denkt man überhaupt: A und Nicht-A, alles Selbwesenliche sofern es gegenheitlich, und dabei eigenwesenlich ist als solches, ganz und umfassend entgegengesetzt Allem, was diese Eigenwesenheit nicht hat, also was und sofern es dessen Äusseres ist;- Was auch übrigens beide miteinander sonst Gemeinsames haben mögen. -Diess ist der Satz des reinen, ganzen Widerspruchs (principium merae contradictionis, s. oppositionis contradictoriae universalis, et indefinitae). Derselbe kann auch der Satz der sich ausschliessenden Eigenwesenheit (oder Bestimmtheit) heissen. Das Nicht-A ist aber allemal, sofern es als wesenlich angenommen wird, ein in dreifacher Hinsicht Bestimmbares, nach den drei vorerklärten gegenheitlichen Bestimmtheiten des Gegensatzes.
6. Was dem Ganzen, als Wesenlichem, selbst abgesehen davon, dass es Ganzes und in sich Theile ist, zukommt oder nicht zukommt (was zu dessen Reinwesenheit gehört oder nicht gehört), das kommt auch zu oder nicht zu allen und jedem Theile desselben innerhalb der Entgegensetzung.
Was aber dem Ganzen, als diesem Ganzen, sofern es den Theilen entgegengesetzt ist, zukommt, das kommt den Theilen dieses Ganze, als solchen, nicht zu.
Die reine, von der Ganzheit abgesehen gedachte Wesenheit des Ganzen und aller seiner Theile ist also hinsichts aller Theile ihr Gemeinsamwesenliches. Eben dies macht aber den Inhalt jedes Gemeinbegriffes oder Allgemeinbegriffes als solchen aus; daher gilt ganz allgemein: Was von einem Allgemeinbegriffe gilt, oder nicht gilt, das gilt auch oder gilt nicht, von allen selbigen untergeordneten Theilbegriffen. (Dictum de omni et nullo) .Ein Gleiches gilt aber auch von unendlichendlichen, eigenleblichen (individuis, infinite determinatis, singularibus) Wesen und Wesenheiten (Dingen); denn was eines solchen Gegenstandes Reinwesenheit ausmacht, gilt sowohl von dem Ganzen, als auch von jedem seiner Theile, und von allen seinen Theilen zusammengenommen. (Das dictum de omni et nullo gilt auch von singulären und individuellen Dinge, als solchen).
7. Jeder coordilierte bestimmte Gegensatz der ganzen Wesenheit ist zweigliedig, wechselbejahig, und wechselverneinig, und hinsichts seiner Glieder wechselausschliessend. (Tertium non datur, principium exclusi tertii inter membra contrarie et simul contradictorie opposita; principium sejunctionis accidentiarum disparatarum. Contradictio in adjecto. Das Principiurn determinationis per quamlibet notam bezieht sich auf jeden jedartigen Gegensatz, und sagt eigentlich aus: dass Alles und Jedes in Ansehung jeder Wesenheit bestimmt ist. )
8. In Hinsicht des subordinativen Gegensatzes gilt folgendes Grundgesetz: A, sofern es vor und über aller seiner inneren Gegenheit ist, ist unterschieden von A sofern es in sich Gegenheit ist, oder hat. Und A sofern es über den Gliedern des coordinativen Gegensatzes ist, d.h. als Überwesenliches, oder als Urwesenliches seiner Art und seines Gebietes, ist unterschieden von A, sofern es in und unter sich die beiden coordiantiven inneren Entgegengesetzten ist.
Die beiden coordinativ in A Entgegengesetzten, verhalten sich zu A, sofern es überausser ihnen ist, auf gleiche Weise; jedes ist auf entgegengesetzte Weise unvollständig (weil gegenverneint), jedes fordert daher das Andere, und ist dem Andern in seinem Innern gegenähnlich (ist mit dem Andern in Parallelismus, in praestabilierter Harmonie); worauf die innere,und untere Möglichkeit der Vereinwesenheit (Vereinigung, synthesis) beruht, wovon nun die Rede sein wird.
Hier liegen daher wichtige kategoriale epistemische Strukturen, die sich aus ontologischen ergeben, welche in der Quantenphysik das Verhältnis des Ganzen zu seinen Teilen und allen Komponenten der Wechselwirkung, der Verschränkung und der Symmetrien betreffen.
Als Beispiel wollen wir hier ein Zitat aus (Ly 04, S. 189 f.) anführen, welches den Versuch unternimmt, ontologische uind logische Zusammenhänge zwischen dem ganzen und seinen Teilen im Kosmos anzugeben: "Die oben angedeutete Heuristik motiviert dazu, die übliche Reihenfolge der Argumente von lokal zu global – die übliche bottom-up-Sichtweise – umzukehren zu einer top-down-Sichtweise von global zu lokal. Nach dieser Heuristik ist zuerst das "Gesamtobjekt" Kosmos gegeben. Dieses Objekt befindet sich in keinem Raume, sondern ist einzig darstellbar durch einen wahrhaft astronomisch hoch-dimensionalen Zustandsraum. Eine Zerlegung in Teilräume, die der Teilobjekt-Darstellung dienen, führt dazu, dass man nicht-integrable Phasenfaktoren in jener Teilobjekt-Darstellung erhält. Laut Eichprinzip übersetzt sich dies in das Auftreten von Wechselwirkungsfeldern zwischen raumzeitlich arrangierten Objekten. Der Kosmos ist nun ansehbar als lauter Teilobjekte in Wechselwirkung. Man endet also mit in der Raumzeit wechselwirkenden Objekten.
In der top-down-Sichtweise deutet sich eine tiefliegende Ganzheitlichkeit des physikalischen Gesamtphänomenbereichs an – und unsere nur schematisch vorgetragenen Überlegungen deuten an, dass hinter der bis heute bekannten und genutzten Architektur der Eichtheorien tiefer liegende Schichten einer fundamentaleren Physik zum Vorschein kommen könnten, die eine Revision unseres Verständnisses der Begriffe Raum, Trennbarkeit und Wechselwirkung im Sinne eng verwobener Begriffe erfordern. Mit dieser kurzen exkursorischen Überlegung ist also der spekulative Hinweis verbunden, dass eventuell noch zu entdeckende Schichten fundamentaler Physik einen nochmals umgreifenderen Zusammenbruch des traditionellen ontolgischen Bildes getrennter Objekte in Raum und Zeit bedingen werden, als dies ohnehin schon in unseren konkreten Unterstützungsargumenten sichtbar wurde."
Aus der Wesenlehre und hier aus dem Denkgesetz ergibt sich bekanntlich, dass alles Endliche in ontologischer, semantischer, logischer und epistemischer Weise mit allem anderen Endlichen und allem darüber befindlichen Unendlichen in Verbindung steht. Es ist eben eine wichtige Aufgabe, diese Zusammenhänge logisch präzise zu erkennen, was im Rahmen der modernen Physik infolge selbst auferlegter Begrenzungen nicht möglich ist.
(der Vereinwesenheit) ist: Wesen ist in sich Vereinwesen seiner inneren Gegenwesen, und zwar der untergeordneten sowohl als der nebengeordneten, als auch der unternebengeordneten, (oblique oppositorum), so dass diese als Vereinwesen sind, und zugleich als Gegenwesen bestehen; und diese Vereinwesenheit ist vollständig. Auch die Vereinglieder erster Stufe (syntheses primi ordinis, s. primae potentiae) sind sich wiederum entgegengesetzt, und sind ferner vereingesetzt; wodurch Vereinglieder zweiter Stufe (syntheses synthesium) gegeben sind.
Daher gilt dieses Gesetz der Vereinwesenheit auch allgemein von jedem endlichen Wesen in Wesen, und von jeder Wesenheit, (Principium syntheseos contrapositorum subordinativorum et coordinationum, und zugleich antitheseos synthetorum, et syntheseos synthetorum, etc.)
Anm. Dieses Gesetz ist in allen zeitherigen Systemen der Philosophie entweder ganz vernachlässigt, oder nur unvollständig anerkannt, geschweige entwickelt. Es ist, sachlich angesehen, zugleich das Princip der Liebe, des Friedens, und der Religion. Die soeben entwickelten Denkgesetze sind zugleich die Gesetze jeder Bestimmbarkeit und Bestimmtheit. Denn laut derselben, wird anerkannt: Wesen ist in sich einstimmig; vollständig, nach allen Wesenheiten im Innern bestimmt; und Grund der Bestimmtheit alles in ihm Wesenlichen. Und auf ähnliche, aber endliche, Weise ist dieses Alles auch jedes endliche Wesen und jede endliche Wesenheit irn endlichen, beschränkter Gebiete.
Hierin ergiebt sich das Princip der Einstimmung ( convenientiae s. consensus) , das Princip der Ähnlichkeit und des gleichförmigen Entsprechens (principium analogiae et parallelismi); ferner die Criterien der Vollständigkeit, das Princip der Bestimmtheit nach allen Wesenheiten (principium determinationis omnimodae per omnia praedicata s. per quamlibet notam) und der Satz des Grundes (principium rationis sufficientis), so auch der Gliedbau der Gesetze für jede Bewiesenheit und Beweisführung.
Das eine Denkgesetz, als Organismus seiner inneren besonderen Denkgesetze dient als Urschema, oder Urtypus, für jede Deduction, und Construction; dasselbe einzusehen, und danach zu verfahren, ist eine erstwesenliche Bedingung der Ausbildung der Wissenschaft als eines organischen Ganzen.
Alle Denkgesetze gelten zugleich; doch findet, wie gezeigt, unter selbigen Unterordnung und Beiordnung statt; sie sind selbst, gemäss sich selbst, ein Gliedbau. Jedes derselben ist, in einer weiteren Ausführung der Erkenntnisslehre, in sich selbst, nach allen Denkgesetzen weiterzubestimmen.
Die Denkgesetze sind bestimmende ( constitutive ) , und leitende und ordnende (regulative ) Principien zur Bildung und Prüfung jeder Erkenntniss, also auch der Wissenschaft; und es findet von ihnen sowohl ein materialer als formaler sowohl positiver als negativer, Gebrauch statt.
Die vorangehenden Kapitel haben bestimmte Grundlagen einer neuen Naturphilosophie dargelegt. Wir sehen: Wenn die Idee der (Or-Om)-Naturphilosophie oder -Naturwissenschaft als System gelten kann, welches nicht den logischen, epistemischen und sprachlichen Problemen der Erkenntisschulen (1) bis (3), teilweise auch (4) ausgesetzt sein soll, so kann dies nur unter der Bedingung möglich sein, dass die überzeitliche Universalität und Allgemeinheit derselben in einem unendlichen und unbedingten Essentialgrund deduziert werden kann, der aber nicht nur axiomatisch postuliert, sondern auch dem Menschen grundsätzlich durch eigene Erkenntnis zugänglich ist. Deduzierbar müssen aber nicht nur eine allgemeine Idee der Natur sein, sondern, wie schon erwähnt, auch die Idee der Mathematik, der Logik und der Sprache. Alle bisherigen religiösen, theosophischen, okkulten oder wissenschaftlichen Theorien über Natur, Mathematik, Logik und Sprache müssen sich in dieser allgemeinen Theorie als unvollständige, mangelhafte oder teilirrige Sonderfälle darstellen lassen.
Sie müssten im Sinne Kanitschneiders (Ka 96, S. 174 f.) in dieser Or-Om-Struktur einbettbar sein. Einbettung bedeutet (nur nach der begrenzten Sicht Kanitschneiders) eine formale Struktur in eine umfassende Struktur einordnen. "Es steht z.B. mit keinem Befund der Wissenschaft in Widerspruch anzunehmen, dass die Welt im ganzen ein Gedanke Gottes sei." (...) Aber auch der Einbettungsgedanke hat nach Kanitschneider seine inneren Probleme. "Wenn man theologischen Gebrauch von dieser logischen Möglichkeit machen will, muß man auf irgendeine Weise die Gefahr umgehen, dass bei dieser Einbettungskonstruktion die 'Ontologie' wegläuft, d.h. dass Gott wirklich letztes Prinzip alles Seienden ist. Der theologische Metaphysiker ist gefordert, sich gute Gründe dafür auszudenken, dass die transzendente Einbettung nach dem ersten Schritt abbricht, denn mit einer nicht endenden Folge von supernaturalen Sphären wird er nicht glücklich werden." (...) "Der Theologe, der den Einbettungsgedanken im Auge hat, muss diese als nicht erweiterungsfähige Fundamentalbegründung der naturalen Ontologie denken. Wenn man z.B. das naturale Universum als Gedanken Gottes fasst, braucht man eine rationale Begründung, warum dieser Vorgang nicht nochmals von einer weiteren, höheren numinosen Entität umfasst wird." Kanitschneider geht dann auf eine Prozesskonzeption Gottes über: "Gott wird im gesamten Naturprozess als Quelle der Neuheit und der Ordnung begriffen, dies ist seine Funktion und sie liefert den Innenaspekt der Natur".
Creation is al long and incomplete process. God elicits the self-creation of individual entities, thereby allowing for freedom and novelty as well as order and structure. God is not the unrelated Absolute, the unmoved Mover, but instead interacts reciprocally with the world, an influence on all events though never the sole cause of any event. (J. G. Barbour: Ways of Relating Science and Theology).
" (...) "Gott ist damit innerlich in den Weltlauf verwoben, er hat eine transzendente Komponente, aber mit einem Teil seines Wesens ist er ein immanenter Teil der Welt.[25] Die Schwäche der Prozesskonzeption liegt an ihrem Doppelaspekt-Charakter. Es existieren keine Möglichkeiten einer wie immer gearteten Prüfung der göttlichen Wirksamkeit in der Abfolge der Ereignisse. Die erklärende Kraft dieser metaphysischen Verdopplung der agierenden Usachen ist gleich Null." (...) "Kein Jota an diesem Ablauf ändert sich, ob nun der transzendente Verursacher am Ablauf mitwirkt oder nicht. Hier drängt sich das Bild vom metaphysischen Trittbrettfahrer auf". (...) "Deshalb muß man die zusätzliche theologische Interpretation des faktischen Naturprozesses wie das Mitreisen des Schwarzfahrers bei einem fahrenden Zug deuten."
Kritik: Unsere Kritik wollen wir anhand des schon bewährten Beispiels der Ontologie, Semantik und Logik der geraden Linie anbringen. Die Details der Ontologie und Logik der Linie werden später nochmals ausführlich dargestellt. Hier nur verkürzt:
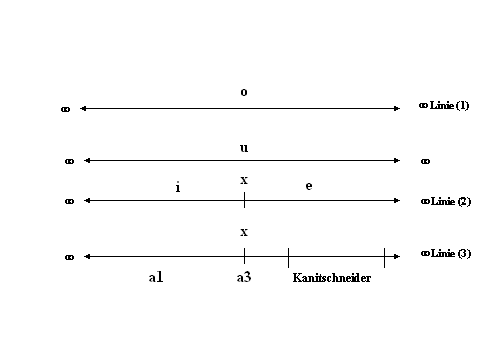
Kanitschneiders Naturphilosophie bewegt sich in Linie (3) innerhalb der beidseitig begrenzten Linie, die mit "Kanitschneider" bezeichnet ist. Er geht von einer finitistischen Kosmologie aus. Da er das Unendlichkeitsproblem sehr beengt sieht, meint er auch, die Annahme einer göttlichen Ontologie dürfte nicht nur wieder zu einer Verschiebung des Problems auf eine weitere Ebene führen, die wiederum eine weitere ermöglichen würde usw.. Und schließlich kommt er zur Ansicht, dass die Annahme einer göttlichen Übernatur eigentlich zu nicht mehr führe, als einem metaphysischen Schwarzfahrer, der auf einen fahrenden Zug aufspringt. Wenn aber die gerade Linie ontisch, semantisch, mathematisch und logisch so gegliedert ist, wie wir es oben darstellen, dann drehen sich die Verhältnisse dramatisch um. Erstens zeigt sich dann, dass die Ontologie der unendlichen Linie (1) (Or-Linie) auf jeden Fall die höchste ontologische Stufe für alle anderen, inneren Linien (2) und (3) darstellt. Die Gefahr der Möglichkeit einer weiteren ontologischen Ebene besteht nicht mehr. Aus dieser Ontologie, Logik und Semantik der Linie ergibt sich aber, dass die Ontologie, Semantik und Logik aller endlichen Linien IN der Linie (1) überhaupt nicht richtig erkannt werden kann, wenn man nicht diese Gliederung beachtet. Die Ontologie aller endlichen Linien ist daher in jeder Hinsicht von der Ontlologie der unendlichen und nach innnen unbedingten (absoluten) Linie (1) abhängig, durch sie bedingt. Alle Arten endlicher Unendlichkeit endlicher Teile IN der Linie (1) sind daher ontologisch, semantisch und logisch als Teile IN der unendlichen Unendlichkeit der Linie (1) zu erkennen. Und dann erweist sich die Frage des Schwarzfahrers tatsächlich als umgekehrt. Die endliche Linie "Kanitschneider" ist nämlich unbedingt von der Linie (1) ontologisch, semantisch und logisch abhängig. Sie wird durch die Linie (1) in jeder Hinsicht bestimmt und nicht etwa die Linie (1) durch die endliche Linie "Kanitschneider". Die erklärende Kraft dieser metaphysischen Verdopplung ist nicht gleich Null, sondern umgekehrt kann die endliche Linie "Kanitschneider" ohne die unendliche Linie (1) überhaupt nicht sachgültig erklärt werden! Die Theorie des Potenziell-Unendlichen, die für die Erklärung der endlichen Linie "Kanitschneider" in seiner Kosmologie herangezogen wird, ist ohne die Erkenntnis der Aktual-Unendlichkeit der Linie (1) überhaupt nicht möglich. Der Schwarzfahrer könnte hier höchstens derjenige sein, der das Potenziell-Unendliche fordert, ohne zu sehen, dass er damit ein Aktual-Unendliches benötigt, in dem diese Potentialität liegen muß!
Im Sinne der Wesenlehre gelangen wir auf diesem Wege zum Allbegriff der Physik, der für eine bestimmte Weiterbildung der modernen Physik die Grundlage bildet. Natürlich kann und wird sich die Physik wohl noch länger ohne Einsatz dieses Allbegriffes weiterbilden, aber es werden ihr neue Probleme erwachsen, bestimmte heutige werden ihr erhalten bleiben.
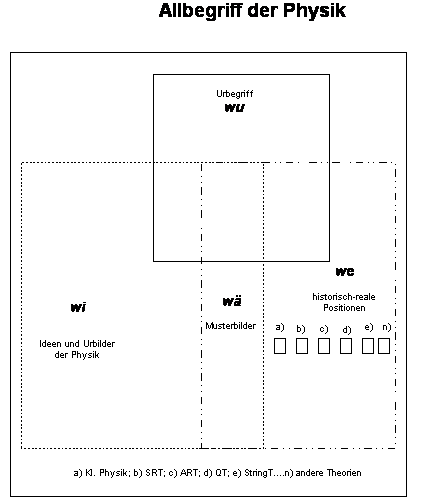
Voraussetzungen
Grundlagen dieser allgemeinen Theorie sind folgende Schritte:
Bewusstseinsanalyse und essentialistische Wende (vgl. vorne das gleichnamige Kapitel:);
grundwissenschaftliche Deduktion der Natur in Gott (19, S. 390 f. und vorne das Kapitel über die Grundwissenschaft);
das folgende Schema sei zur Verdeutlichung eingefügt:
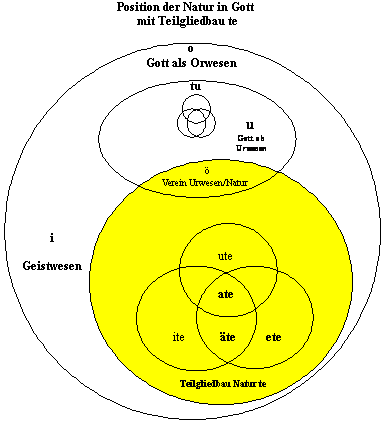
Grundwissenschaftliche Ableitung der Logik (Synthetische Logik);
höchste kategoriale Erkenntnis der dyadischen, inhaltlichen Komplementarität, Neben-Gegenheit, Neben-Gegen-Ähnlichkeit, Symmetrie und Harmonie;
Deduktion der Mathematik (siehe die obige Tabelle), der Logik (33 und 17), Sprache (19, S. 441 ff.), (55) und das Kapitel: "Zukunftshorizonte der Wesensprache";
Deduktion der unendlichen, nach innen unbedingten Zeit (19, S. 473 ff.) als göttlicher Kategrie;
Verhältnis von Orsein, Ursein, Ewigsein und Zeitlichsein (vgl. vorne das Kapitel: "Die Seinsarten"). Wichtig ist, dass die Zeit als göttliche Kategorie und nicht nur als subjektive Anschauungsform (Kant) erfasst wird. Die endlichen Zustände in Geist und Natur sind nicht in der Zeit, sondern sie alle haben die Zeit in sich, als Eigenschaft, insoweit sie sich ändern.
Deduktion des unendlichen, nach innen unbedingten Raumes und seiner Grenzheitsstufen (19, S. 412 und S. 455) und vorne die Darstellungen. in der Grundwissenschaft.
Auch der Raum ist nicht ein Medium, in dem die endliche Zustände sind, sondern die endlichen Zustände in Geist und Natur haben den Raum als Eigenschaft in sich.
Einführung und Benützung des des Denkesetzes;
Einführung des Verfahrens von Deduktion-Intuition und Konstruktion.
Die Natur ist ein unendliches Grundwesen in Gott neben der Vernunft, wie schon mehrmals dargestellt wurde. Sie ist mit Gott als Urwesen verbunden. Die Natur ist unvergänglich, orseinheitlich, urseinheitlich und ewig gleich. Nur hinsichtlich der inneren begrenzten Zustände in sich ist sie änderlich, zeitlich. Dass sie in dieser Hinsicht zeitlich ist, ist selbst aber wieder nicht zeitlich. Die Natur selbst wird nie zu Ende gehen und hatte nie einen Anfang. Soweit sich aber endliche Systeme in der Natur bilden, entstehen und vergehen, unterliegen sie den vorne angedeuteten Evolutionsgesetzen. Aber auch das zykloidische Werden und Vergehen endlicher Wesen in der Natur ist selbst nicht werdend, sondern wiederholt sich ewig. Die Vorstellung der Allgemeinen RT, dass es in der Vergangenheit einen Zustand unendlicher Dichte gegeben habe, den Urknall, der den Anfang der Zeit markiert, und der die schwierigen Probleme der Singularität[26] provoziert, die wiederum zu verschiedenen Lösungsmodellen Anlaß gab, erweist sich als mangelhaft.
Aus (17, S. 38 f.): Die Natur ist an und in sich selbst, sie existiert, sie ist nicht eine Wesenheit in uns, die wir bloß denken, nicht ein bloßer Gedanke.
Natur ist nicht alles, was ist, – nicht alles Wesenliche (Reale), – nicht alle Wesenheit (Realität). Also ist sie nicht die Welt, sondern nur ein Teil der Welt.
Natur ist selbwesenlich (selbständig), jedoch nicht alleinwesenlich (nicht isoliert).
Und da sie nicht alles ist, was ist, so behaupten wir, dass sie von allem Anderen, was sie nicht ist, und was nicht sie ist, verschieden ist, – dass sie eigentümliche Wesenheit hat, oder mit anderen Worten, dass sie eigenwesenlich ist.
Die Natur ist ganz (ein Totum) und in ihrer Art Alles (omne), also in ihrer Art urganz d.i. in ihrer Art unendlich; – keineswegs aber in aller Art oder unbedingt unendlich.
Also ist sie Eine, Eines in ihrer Art (eine Monas) sie hat Einheit. Die Einheit ihrer Wesenheit ist Gleichwesenheit (Wesengleichheit, Homogenität). Auch ist die Einheit der Natur stetig nach Art (d.i. nach ihrer Eigenwesenheit), und nach Ganzheit.
Wesenheit, Selbheit und Ganzheit sind also die höchsten Urbegriffe (Kategorien) unter denen wir die Natur denken.
Raum Zeit und Bewegung sind innere Formen der Natur, sowie sie auch innere Formen des Geistes sind. Sie sind formale Kategorien.Die Zeit ist Form des Lebens der Natur. Aber die Natur selbst ist nicht in der Zeit, noch in der Zeit entstanden; sie selbst ist urwesenlich und ewig. Auch von dem Einzelnen, unendlich Endlichen in der Natur behaupten wir, dass es in der Zeit nur seiner Form und Gestaltung nach entstehe und vergehe. Wir behaupten dies zufolge des noch höheren, auch über die Natur hinaus geltenden Grundsatzes: Das Wesenliche der Wesen (die Substanz) bestehet, während die Gestaltung, als gerade diese endliche, sich ändert (wechselt) und vergeht. Die Natur ist auch der Zeit nach selbwesenlich, urganz, einheitlich, und zwar alles dies stetig; die Natur bildet in Einer stetigen, unendlichen Zeit, in einem stetfortgehenden (vergehenden) Verflußpunkte, ganz und auf einmal, durch ihre ganze Wesenheit hindurch, ihr Eines Leben. Die Stetigkeit der Zeit erscheint, (hinsichtlich jedes endlichen Zeitteiles) als unbeendbare Teilbarkeit, und als ohne Ende fortgeschrittene und fortschreitende Erweiterbarkeit.(Vgl. auch oben die Ableitung der Zeit unter der Göttlichen Wesenheit unter (O. 5.).
Anmerkung: Das Unendliche, d.h. das Urganze jeder Art, ist als Vernunftidee denkbar, erkennbar, schaubar, nicht aber mit dem Verstande in seinem Gehalte überschaubar, noch durch Phantasie vollendbar und vorstellbar. Dasselbe gilt also auch für Zeit und Raum sofern sie unendlich sind, sowie von der Natur selbst, sofern sie unendlich ist.
Der Raum ist die Form der Vereinwesenheit (des Vereinseins, des jedartigen Zusammenseins) des Leiblichen (Körperlichen, Materiellen, Stoffigen) in der Natur. Wir behaupten, dass die Natur auch dem Raume nach selbständig, unendlich (urganz) und stetig ist. Der Raum ist ausgedehnt in drei Gegenstrecken (Dimensionen); und hat die Linie und die Fläche zu inneren Grenzen, welche selbst noch in ihrer Art unendlich sind, wie der Raum.(Vgl. hierzu die obigen Deduktionen der inneren Grenzheitsstufen von Räumen, Flächen und Linien). Des Raumes Urgrenze ist der Punkt, als das reine bezugliche Nichts in Hinsicht des Raumes. Die Unendlichkeit des Raumes setzen wir auf einmal im Vernunftbegriffe des Raumes, nicht im Begriffe des Verstandes, noch in der Vorstellung der Phantasie; sie (die Unendlichkeit) ist eine doppelte, einmal des Raumes selbst als des Urganzen seiner Art, sodann jeden Endraumes (endlichen Raumes) als eines ohne Ende (unbeendbar) Teilbaren. Beiderlei Unendlichkeit des Raumes gestattet für Verstand und Phantasie ein unbeendbares Fortschreiten durch Ändern der Grenzen; aber durch dieses Fortschreiten wird der Gedanke (die Schauung) des unendlichen Raumes weder gegeben, noch vermittelt, sondern dabei vielmehr schon vorausgesetzt.
Die Natur, sofern sie in Raum und Zeit Endliches in sich ist, steht unter der Form der Bewegung, welche die Vereinform ist von Zeit und Raum. Die Bewegung ist dem Raume und der Zeit nach stetig und in beiden Hinsichten unendlich, insofern sie durch die ganze unendliche Zeit und durch den ganzen unendlichen Raum stattfindet; wiewohl an sich selbst, als Form des Endlichen endlich; denn sie ist Vereinwesenheit eines endlichen Raumes mit einer endlichen Zeit zu einer endlichen Geschwindigkeit. Sie ist in Ansehung des Bewegten eine innere, eine äußere, und diese beiden in Vereinigung. Die innere Bewegung ist entweder eine chemisch-dynamische oder eine schwingende (vibrierende). Die äußere Bewegung erscheint durch die innere vermittelt.
Zum Vergleich eine wesentlich beschränktere These unter (Ly 96, S. 6): "The cosmic time (the epoch) is correlated with the total number of urs, i.e. the increase of the number of urs has to be understood as an expression of time. Consequently at a certain epoch there will be only a finit number of urs in the world. This number can be estimated at about 10120. Weizsäcker calls this open finitism. If we keep the curvator radius R of S3 constant, we find, that with passing time there are more an more alternatives available to divide R into smaller and smaller intervals. Equivalently , we could say, that our unit sticks to measure spatial lengths decrease. But for open finitism, it follows that the procedure of division, i.e. "counting" of ur-alternatives, takes time and, thus, space is "continuous (i.e. infinite) only in a potential sense." Eine zusätzliche Überlegung sagt (in Ly 94, S. 6):" Space is by no means "empty", it is at least filled up with urs. Moreover, its structure as a global S3 is a consequence of the isomorphic structure of the abstract symmetry group of urs, i.e., space is the appearance of pure information in the world. Apart from this further appearances of information like energy and matter exist. Hence radiation and massive particles as well as the vacuum density will be described by density situations of urs, i.e. information. In that sense energy and matter can be looked upon as condensates of information in front of background of urs representing vacuum."
In (Ly 04) finden sich Zusammenfassungen über die in der Physik relevanten äußerst divergenten Theorien über Raum und Zeit, die hier wiederum weiter verkürzt als Hinweis und zum Vergleich zu den Konzepten der Wesenlehre aufgeführt werden.
Newton vertrat die These eines absoluten Raumes als universellem Bezugssystem für alle Bewegungsvorgänge. Der Raum hat eigenständigen Realstatus und Substantialität. Die Eigenschaft eines Körpers, sich an einem Raumpunkt zu befinden ist intrinsisch also nicht relational[27]. Leibniz vertrat eine relationistische Raumtheorie. Raum ist die Menge der Lagebeziehungen oder Körperrelationen. Die Eigenschaft eines Körpers, sich an einem raumpunkt zu befinden ist nicht intrinsisch sondern relational, einzig bezogen auf die Lagen anderer Körper. Dies bedeutet Anti-Realismus bezüglich des Raumes, da weder dem Raum insgesamt noch Raumpunkten irgendeine ontologische Eigenständigkeit zugestanden wird. Leibniz analysiert auch die Fragen dreidimensionaler Drehgruppen, der Invarianten der Drehgruppen. Die Realinterpretation einer Symmetrie zielt nicht auf die Gruppenelemente bzw. Repräsentanten der Äquvalenzklasse, sondern allenfalls auf die Gruppe als Ganzes, die Gruppenstruktur, die ganze Gruppe oder Äquivalenzklasse als "Objekt". Untersucht wird weiters das Problem der Händigkeit: etwa bei Händen, Füßen, Schrauben, Knoten, rechts- oder linksdrehende Milchsäuren und Zuckermoleküle, DNA-Moleküle, rechts- oder linkspolarisierende optisch aktive Kristalle[28]. Kant vertrat offensichtlich in manchen Werken eine substantialistische These eines absoluten Raumes, in der 'Kritik der reinen Vernunft' wiederum eine relationale (Raum als reine Anschauung a priori). Krause kritisierte diese Raumtheorie bei Kant gründlich, auch seine Auffassungen zur Händigkeit in ( 41, S. 102 f.), worauf hier nicht eingegangen werden kann. Krause betont aber, dass der Mangel der Ansicht Kants darin besteht, dass er annimmt, es bestehe keine qualitative Gegenheit. "denn es beruht die Lösung auf Einsicht in die Gegenrichtheit und Gegengestaltbarkeit (asymmetria) des Raumes nach jeder seiner drei Strecken. Die Schwierigkeit kommt daher, dass jeder Endraum dreistreckig und nach zwei Seiten mit einem anderen gleichartig, dabei aber nach der dritten hinsichtlich gegenheitlicher Bestimmnisse gegenheitlich, also unverwechselbar sein kann."
Mit der Entwicklung der nichteuklidischen Geometrien verschärfte sich die Frage, welche Geometrie dem wirklichen Raum zugrunde liege, was die wahre physikalische Geometrie sei. Das Kant`sche Apriori ist bekanntlich dreidimensional und euklidisch, die ART benützt einen nichteuklidischen Riemann-Raum (Ly 04, S. 144) betont aber, dass der Riemann-Raum euklidische Konzepte im Kleinen benützt (lokale Koordinaten als Kartenabbildungen nach Rn) . Eine Apriori-Verteidigung des Raumes erfolgt etwa auch im Erlanger Konstruktivismus im Sinne des "meßtheoretischen Aprioris", insofern die Naturgesetze als Bedingungen der Möglichkeit apparateabhängiger und experimenteller Erfahrung angesehen werden.
Im weiteren entwickelte sich ein Streit um die apriorischen und empirischen Anteile bei der Begründung der physikalischen Geometrie. Die Maßstabsdefinition führt zu den Problemen des Konventionalismus ihrer Elemente. Reichenbach etwa unterscheidet zwischen der reinen (mathematischen) Geometrie und der physikalischen Geometrie im Rahmen einer konventionellren Zuordnungsdefinition einer Längenheinheit zu einem starren Körper. Einstein vertrat hier eher einen "Nicht-Poisitivismus", den Lyre als Duhemschen Holismus verstehen will.
Die Konventionalismusdebatte unterscheidet schließlich die epistemische von der ontologischen Dimension. Schließlich kreist Lyre um die Frage nach einer realistischen Ontolgie der geometrischen Arena. Es läge nahe, den strukturellen Aspekten, also den Symmetrien dieser Geometrie Realstatus zuzubilligen. "Dennoch ist auch der intermediäre Strukturenrealismus ein letztlich unvollendetes Programm. Man betrachte etwa die Charakterisierung der Raumzeit als Träger physikalischer Eigenschaften: Auch bei voller Akzeptanz des Leibnizschen Symmetriearguments als Realitätsfilter und des hole Arguments verbleiben der Raumzeit als Ganzer noch gewisse intrinsische Eigenschaften. Neben den topologischen Eigenschaften ist dies etwa die Signatur der Metrik. Die Analyse der Eichtheorien und vermutlich der Gesamtbestand heutigen physikalischen Wissens reichen noch nicht aus, um eine bestimmte Variante des Strukturenrealismus auszuzeichnen, wenn gleich die intermediäre Variante dem Trend der Physik am ehesten angepasst scheint".
Unter (28, S. 133 ff.) finden sich weitere Deduktionen, Grunderkenntnisse der Naturwissenschaft. Die mechanistisch-atomistische Naturtheorie mit einem strengen Determinismus erweist sich als mangelhaft. Die Natur bildet mit eigentümlicher Freiheit alles in ihr Endliche auf einmal im Ganzen, frei nach ewigen Ideen. Soweit die Natur das bleibende, aber bildbare Wesen ist, ist sie bildbarer, gestaltbarer Stoff, also leiblich, materiell, und in dieser Hinsicht ausgedehnt in Form des einen unendlichen Raumes. Sofern sie als Materie bildbar ist, ist sie auch ausgedehnt in Form der unendlichen Zeit. Die Materialität der Natur ist nicht ihre ganze Wesenheit. Als die eine Materie ist die Natur durch und durch belebt. Die Natur ist daher kraftheitlich, dynamisch. Die eine Lebenskraft der Natur formt ohne Unterlass frei nach Ideen, die in ihrer ganzen Idee enthalten sind. Die allseitige Wirkung des Lichtes und anderer Strahlen in alle Richtungen, die Durchdringung "fester" Körper usw. widerlegen die atomistisch-mechanistische Naturansicht. Die Natur ist in sich ein seiner Art nach unendliches Lebewesen, das natürlich auch alles in sich erkennt.
Schema der Naturprozesse
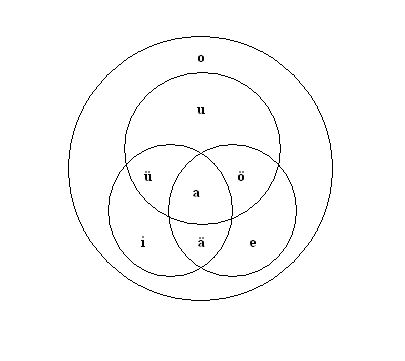
Oberste Naturprozesse:
1. Akt der reinen Selbstheit, des Bildens bestimmter mit Selbheit seiender Einzelwesen (Individuen); der Kreis o im obigen Schema. System der Himmelskörper als der obersten räumlich erscheinenden Einzelwesen. Dies geschieht durch die Aktionen des Zusammenhaltes (Kohäsion) und die Teiltätigkeiten des besonderen Zusammenhaltes aller einzelnen selbständigen Körper und der inneren Schwere und der Wechselschwere, Wechselanziehung der Gestirne gegeneinander als des Gravitationsprozesses.
2. Akt der Entfaltung des Gegensatzes. Jeder Stern bildet in sich Gegensätzliches aus, er steht aber auch mit anderen Gestirnen in einem Gegensatz, in Gegenselbheit. Die inneren weiteren Unterschiede dieses innerlichen und äußerlichen Prozesses sind die Grundtätigkeiten des Magnetismus und der Elektrizität. Es sind dies Prozesse, die auf der Neben-Gegenheit von i und e basieren. Hieraus ergibt sich in der Neben-Gegenheit die inhaltliche Nebengegenähnlichkeit, dyadische Komplementarität und die komplementäre Symmetrie zwischen der sich bildenden Neben-Gegenheit i und e (vgl. das Schema im Kapitel "Ausblick").
Alles, was die Natur bildet, steht aber auch mit sich in Vereinigung, daher ist die Natur als ganze Tätigkeit u mit dem Prozess des Magnetismus und der Elektrizität verbunden. Die Urkraft der Natur ist selbst wieder nach allen göttlichen Kategoren bestimmt:
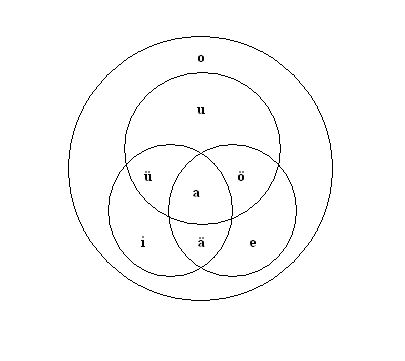
Gliederung der Ur-Kraft der Natur über allen Einzelprozessen
Universalität (Or-Omheit) ihrer Wirkung
Für die Erklärung der Wechselwirkungen, der Veschränkung u.a. ist die Einsicht in die über den inneren, gegenheitlichen Phänomenen, Kräften und Gebilden der Natur stehende Urkraft und die "Mächtigkeit ihrer Universalität" von Bedeutung.
3. Akt der Vereinheit (Synthese) in der Natur. Die
erste synthetische Tätigkeit ist die Neben-Vereinigung von zwei im 2. Akt
gebildeten In-Teilen (Produkten),
z. B. i und e des allgemeinen
Grundprozesses. Es ist ein dynamisches Durchdringen und Durchwirken als
chemischer Prozess. Es entsteht eine wesenhafte Vereinheit. Die zweite
synthetische Tätigkeit ist die subordinative Synthese (unterordnige Vereinheit),
wo die Natur als Urwesen ihrer Art von oben nach unten in den chemischen Prozess
in der innigsten Synthese und Harmonie der Natur in sich hereinwirkt. Diese
Synthese ist der organische Prozess. Der organische Prozess ist daher aus
den bisher genannten Prozessen nicht zu erklären. Das organische Reich besteht
aus dem Tier- und dem Pflanzenreich und als innerster Synthese aus dem
Menschenleib, der qualitativ als panharmonische Synthese über dem Tierleib
steht. Der organische Prozess findet in a statt. Auch im organischen Prozess
finden sich gegenähnliche Komplementaritätssymmetrien, z. B. die
Komplementaritäten im Aufbau der DNA im männlichen und weiblichen
Körper usw.
Die Annahme, dass man die Grenzen der Oszillationen der Theorien der modernen Physik zwischen den Erkenntnisschulen (1) bis (3) überschreiten könnte und jenseits derselben, wenn auch nur in endlicher Weise, zu einer menschlichen Erkenntnis der absoluten und unbedingten Essentialität Gottes (gleichzeitig ontisch dem unbedingten und unendlichen Sein) gelangen kann: wird diese Annahme noch zu weit von den limitierten Horizonten der modernen Physik entfernt sein? Wird man dieses evolutive Angebot als idealistisches, spekulatives Residual des 19. Jahrhunderts abtun, das vor allem von den Begriffsstrukturen, Problemstellungen, logischen und mathematischen Grundlagen der modernen Theorien so weit entfernt ist, auf diese viel zu wenig eingeht, eingehen kann, und daher als unbestimmter, unverbundener rein spekulativ hypothetischer, monistisch gefärbter Überbau eigentlich nur den geltenden Theorien übergestülpt werden soll, ohne deren internen Konfigurationen und Problemstellungen überhaupt zu berühren? Ist es nur ein nicht der Beachtung werter Versuch längst überholte philosophische Systeme in unzulässiger, regressiver Weise mit den erkenntnistheoretisch aufgeklärten Positionen der modernen Physik zu verbinden oder zu konfrontieren?
Um diesen Fragen ihre Virulenz zu nehmen, sind zwei Entlastungsmöglichkeiten denkbar: Zum einem könnte man argumentieren, dass zumindest bestimmte Denker nach einem Studium des Aufsatzes vom Inhalt desselben, also vor allem von der Möglichkeit der menschlichen Erkennbarkeit der göttlichen Kategorien (Vernunftbegriffe) und ihrer internen Deduktionen in Gott überzeugbar sind und die "logische Bündigkeit und Notwendigkeit" dieser ontischen, logischen, mathematischen und sprachlichen Relationen subjektiv für sich nachvollziehen und anerkennen können und damit in ihrer Arbeit in den geltenden physikalischen Theorien zu einem Um- und Weiterdenken und Umgestaltungen gelangen. Zum anderen könnte eine gewisse Überzeugungskraft vielleicht in dem Unternehmen liegen, alle philosophischen Perspektiven, die in der heutigen Diskussion der einzelnen physikalischen Theorien und ihren Verbindungen bestehen, als we im obigen Allbegriff der Physik mit den aus der Grundwissenschaft der Wesenlehre abgeleiteten Ideen wi konkret in Verbindung zu denken, und damit die Anregung eines Weiterbildens zu initiieren. Ein solches Unternehmen kann in diesem Rahmen nicht geleistet werden; es ist jedoch langfristig unbedingt erforderlich, eine derartige Analyse durchzuführen, wobei das Denkgesetz und die Verfahren von Deduktion, Intuition und Konstruktion anzuwenden wären.
Zumindest an zwei aktuellen Ansätzen wollen wir darstellen, wie die logische Operation aussehen müsste, in welcher eine Theorie we1 mit den Ideen wi1 im Allbegriff verbunden werden.
Mittelstaedt (Mi 89, S. 216 f.) schreibt zum Verhältnis zwischen klassischer Logik und Quantenlogik:
"Unsere Überlegungen haben gezeigt, dass die effektive Logik eine Theorie ist, die a priori für alle unbeschränkt verfügbaren Aussagen gültig ist. Zu diesem Aussagetyp gehören alle Aussagen der klassischen Physik und alle die Aussagen, die das Vorliegen objektiver Eigenschaften[29] an einem quantenmechanischen System behaupten. Darüber hinaus gilt für die quantenmechanischen und die klassisch-physikalischen Aussagen auf Grund ihrer Wertdefinitheit auch das Tertium non datur und damit die volle klassische Aussagenlogik.
Wesentliche Änderungen treten jedoch auf, wenn man sich mit denjenigen Aussagen befasst, die das Vorliegen beliebiger messbarer, also auch inkommensurabler Eigenschaften eines quantenmechanischen Systems behaupten. Unter diesen Umständen können dann zwei Fälle eintreten: Entweder man benützt bei der Anwendung der Logik die üblichen Deutungen der Quantentheorie. Dann werden einige Sätze der Logik unanwendbar, bleiben aber weiterhin richtig. Oder man klammert diese Deutung der Quantentheorie bei der Anwendung logischer Gesetze ausdrücklich aus, betrachtet also uneigentliche Gegenstände und deren Eigenschaften. Dann werden einige Gesetze der Logik falsch. Der Grund ist, dass die quantenmechanischen Aussagen wegen der besonderen physikalischen Bedingungen , unter denen sie nur bewiesen werden können, nicht mehr unbeschränkt, sondern nur mehr beschränkt verfügbar sind. Die Folge davon ist, dass die wesentlichen Restriktionen sich bereits in der effektiven Logik bemerkbar machen. Dort wird insbesondere der Satz A→ (B→A) ungültig. Die auch für beschränkt verfügbaren Sätze der effektiven Logik hatten wir dann als effektive Quantenlogik bezeichnet. Auf Grund der Wertdefinitheit der verwendeten Aussagen, sind aber auch hier noch weitere Sätze beweisbar. So ist insbesondere das Tertium non datur auch noch in der vollständigen Quantenlogik gültig. – "
Die folgende Tabelle fasst diese Ergebnisse noch einmal zusammen:
|
Aussagen über
|
Interpretation
|
Logische Theorie
|
Gültigkeit
|
|
klassische und quantenmechanische Gegenstände (objektive Eigenschaften)
|
— |
klassische Logik |
w, a |
|
Quantenmechanische Gegenstände
|
nicht objektivierend
|
klassische Logik
|
w, ┐a
|
|
Uneigentliche Gegenstände
|
objektivierend
|
klassische Logik Quanten-Logik
|
┐w, a w, a
|
Bemerkung zur Tabelle: Spalte 1 bezieht sich auf den Gegenstand, von dem die Aussagen handeln. Spalte 2 gibt die Interpretation an, die bei der Anwendung der logischen Gesetze zusätzlich verwendet wird. Spalte 3 gibt die verschiedenen Theorien und Spalte 4 deren Gültigkeit an. w bedeutet wahr, a anwendbar; ┐w nicht wahr; ┐a nicht anwendbar.
Das Problem der Gültigkeit der Logik in der Quantenphysik steht in engem Zusammenhang mit den Fragen, die sich bei der Diskussion des Substanzbegriffes und des Kausalitätsgesetzes ergeben hatten. Das gemeinsame Problem , das diesen Fragen zugrunde liegt, ist das der Objektivierbarkeit beliebiger Eigenschaften eines quantenmechanischen Systems.
Bereits bei der Diskussion des Substanzbegriffes zeigte sich an Hand des Zwei-Löcher-Experiments, dass der Bezug aller messbaren Eigenschaften auf ein System, also deren Objektivierung, zu logischen und wahrscheinlichkeitstheoretischen Widersprüchen führt. Auch das Kausalgesetz verliert seine Gültigkeit, wenn man es auf inkommensurable Eigenschaften anwendet, die man als objektive Eigenschaften eines quantenmechanischen Systems interpretiert. Schließlich zeigte die Untersuchung der Logik, dass für Aussagen, die das Vorliegen inkommensurabler Eigenschaften eines Systems behaupten, einige Gesetze der Logik falsch werden. Ein spezielles Beispiel für einen solchen Satz ist dabei der schon im Zusammenhang mir dem Substanzbegriff besprochne logische Satz. Weiterhin erwiesen sich die Restriktionen der Wahrscheinlichkeitstheorie, die sich bei der Diskussion des Zwei-Löcher-Experiments zeigten, als eine Folge der Einschränkungen innerhalb der Logik.
Eine naheliegende Schlussfolgerung aus diesen Ergebnissen ist, dass eine Objektivierung inkommensurabler Eigenschaften nicht möglich ist. Denn die Objektivierung führt, wie wir gesehen haben, zu logischen und wahrscheinlichkeitstheoretischen Widersprüchen und zum Verlust des Kausalgesetzes.
Auf der anderen Seite aber haben die Untersuchungen der Logik gezeigt, dass durch die Objektivierung nur einige Gesetze der Logik und entsprechend nur einige Sätze der Wahrscheinlichkeitstheorie ungültig werden. Das Kausalgesetz geht allerdings vollständig verloren. Die verbleibenden Theorien, die Quantenlogik und die Wahrscheinlichkeitstheorie inkommensurabler Aussagen, sind aber durchaus als brauchbare logische und mathematische Theorien anzusehen, die nach wie vor ein sinnvolles Sprechen über die uneigentlichen Gegenstände der Quantenphysik erlauben.
Man kann infolgedessen die Objektivierung aller Eigenschaften durchführen, d.h. die quantenmechanischen Systeme als Objekt im klassischen Sinn auffassen, wenn man dafür die erwähnten Einschränkungen der Logik, der Wahrscheinlichkeitstheorie und des Kausalgesetzes in Kauf nimmt."
Wie heikel allein, ohne Berücksichtigung unserer Einbettung der Thesen Mittelstaedts in den Allbegriff der Physik bereits in der bisherigen Diskussion das Verhältnis von Subjekt, Messapparat und "Objekt" der Messung ist, haben wir zwar bereits oben erwähnt (1.2.1.1.1. Der Tastsinn), wir möchten die Stelle hier aber neuerdings einfügen:
Enthält auch nach den präzisen Ausführungen (Ze 03) das Problem, dass wir für die Beobachtung eine nach der klassischen Physik gebauten (und daher mit traditionellen Raum-Zeitbegriffen konstruierten und auch von uns erkannten Apparatur), benützen, mit der wir im Sinne der klassischen Physik übliche Beobachtungen machen, die daher auch schon durch unsere hierbei benützten Begriffe und die gesamte Intention des klassisch ausgelegten Versuches konstitutiv durch "Brillen" der klassischen Physik konstruiert werden.
Zeilinger sagt daher richtig: "wovon wir weiter noch sprechen können, sind die Elemente des experimentellen Aufbaus, so etwa die Linse, sowie der Ort, an dem sich diese Linse befindet, sicherlich auch noch die Quelle, mit der wir unsere Elektronen erzeugen, die Lichtquelle, aus der das Photon kommt, das am Elektron gestreut wird, und die für den gesamten Aufbau benötigten Teile des notwendigerweise klassischen Apparates, die das Ganze zusammenhalten. Genaugenommen können wir nur über diese klassischen Objekt sprechen. Alles andere sind unsere mentalen Konstruktionen. (...) Es läuft alles darauf hinaus, dass der Zustand, den die Quantenphysik den Systemen dann zuordnet – wie z.B. die Superposition des Photons in allen diesen Möglichkeiten – zu nichts anderem dient, als eine Verbindung zwischen klassischen Beobachtungen herzustellen."(S.169).
"Die Komplementarität ist letztlich eine Konsequenz der Tatsache, dass zur Beobachtung der beiden Größen, in unserem Fall Ort und Impuls, makroskopische klassischer Apparate notwendig sind, die einander ausschließen" (S. 170) Wir würden sagen, die zwei unterschiedliche Brillen sind, welche bereits die Beobachtung konstitutiv prägen. Ähnlich auch: "Die Komplementarität ist in diesem Falle wieder die Konsequenz der Unmöglichkeit eines gleichzeitigen Aufbaus zweier verschiedener makroskopischer Apparate" (S. 171)
Gedankenexperiment: Wie müsste eine Beobachtungsapparatur aussehen, die nicht in klassischen Kategorien und Begriffen aufgebaut ist und andere als klassische Begriffe von Raum und Zeit benützt, die also nur Begriffe der Quantentheorien selbst benützt und nur "Objekte" baut, die diesen Theorien entsprechen.
Ergebnis: Die offensichtlich zwangsweise inhaltliche Verknüpfung der von klassischen Begriffsstrukturen konstitutiv miterzeugten Beobachtungen mit quantentheoretischen Ergebnissen ist ein Problem, das man u.U. wohl nur dadurch lösen könnte, dass wir als Menschen uns von den "Illusionen" der "klassischen Welt", aus ihrem Traum lösen und nur mehr in den Begriffen der Quantenmechanik denken, mit ihren Begriffen unsere Welt erzeugen und verändern und unsere Beobachtungsapparaturen in ihr entwerfen usw.[30]
Zurück zu Mittelstaedt: Wenn seine Ausführungen als weMittelstaedt in den Allbegriff der Physik eingefügt werden, sehen sie sich Veränderungen ausgesetzt.
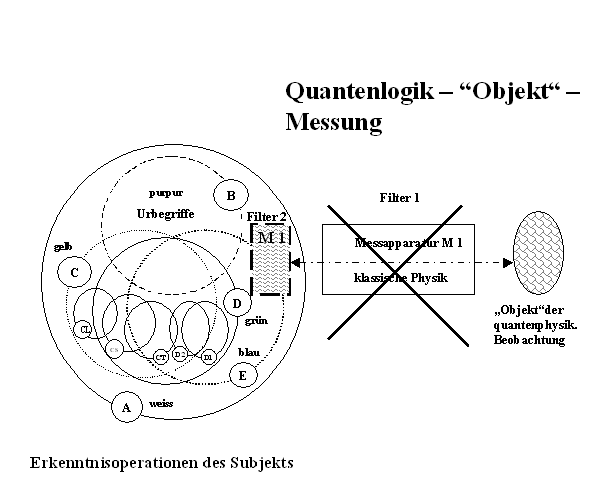
Wie die obige Zeichnung zeigt, ist die übliche Analyse der Frage aus der Sicht der Erkenntnistheorie der Wesenlehre ungenau. Es werden gleichsam zwei Brillen(Filter)-Systeme angenommen, die auf das Objekt gerichtet sind. F1, das Meßsystem und F2 das Subjekt mit Stempel auf den Sinnesorganen E, Phantasietätigkeiten D1 und D2 und einer Reihe miteinander verknüpften Begriffsystemen: CT den Begriffen der Theorie, hier der klassischen Physik und der QT, CL Begriffen der Mathematik und Logik und schließlich Begriffen der Umgangssprache CS, mit der wir gerade hier wieder einen Zusammenhang zwischen allen diesen Beziehungen herstellen! Während M. offensichtlich noch davon ausgeht, dass Aussagen über ein Objekt mit dem Objekt verbunden werden können, um die Wahrheit der Aussage festzustellen, und Zeilinger bereits Objekt und Information über das Objekt gleichzusetzen beginnt[31], gehen wir von folgenden Tatsachen aus: Auf die Weise der hier geschilderten physikalischen Erkenntniswege ist ein Zugang zum "Objekt" im Sinn eines Vergleiches desselben mit unseren Aussagen grundsätzlich nicht möglich. Erkenntnisschulen, welche von dieser Position abrücken, und das Problem dadurch zu lösen versuchen, dass sie nur mehr von subjektiven und natürlich auch intersubjektiven Konstrukten ausgehen, kommen aber über bestimmte Grenzen auch nicht hinaus. Sie stehen vor den Problemen des Vergleichs unzähliger einander ablösender Konstruktkonfigurationen bezüglich dessen, was welche Wirklichkeit darstellt, was als wahr zu gelten hätte, wie diese Konstrukte verglichen werden sollen und ob es eine evolutiv erkennbare Richtung eines Erkenntnisfortschrittes gibt (eben die Situation der Postmoderne). Was den Filter 1 (die Messapparatur) betrifft, und ob er den Begriffen der klassischen oder einer anderen Physik entsprechend konfiguriert ist, muss natürlich ebenfalls bedacht werden, dass wir niemals Messapparaturen außerhalb unser "haben", "erkennen", sondern dass wir es auch - unter oft kostspieligem Einsatz – nur mit Bewusstseinskonstrukten zu tun haben, die wir als außer uns gelegen annehmen, ja sie selbst als "außer uns" konstruieren. Der "äußere" Filter 1 wird daher zu einem innersubjektiven Filter 1(i), der mit dem Filter 2, welcher die "Ergebnisse" der Messungen mit Filter 1(i) das "Objekt" konstruieren, verbunden ist. Die bei Mittelstaedt bemühte Unterscheidung zwischen nicht objektivierender Interpretation quantenmechanischer Gegenstände und objektivierender Interpretation uneigentlicher Gegenstände und deren Implikationen müsste in diesem Falle für innersubjektive oder intersubjekive Konstrukte in das Subjekt verlegt werden.
Wir haben nicht die Absicht, diesen strengen subjektiven und intersubjektiven Konstruktivismus, der eine Reihe idealistischer Erkenntnisschulen beherbergt, als letzte Basis der QT anzuerkennen. Aber diese Position ist auf jeden Fall gegen realistischere Schulen zu verteidigen[32].
Dem Problem, dass der Gegenstandsbereich nicht mehr eine isolierte, autonome Existenzweise besitzt, weil nicht mehr alle Auswirkungen der Informationsgewinnung im Prinzip eliminierbar sind, und welche Rolle dem Bewusstsein des Beobachters zukommt, widmet auch Kanitschneider in (Ka 96, S. 99 f) ein wichtiges Kapitel. Er behandelt die Übertragung der Quantenmechanik auf den Messvorgang selbst durch Neumann 1936. "Da es der Beobachter ist, der die Art des Messgerätes und damit die dynamische Variable aussucht (Energie, Impuls, Ort, Spin...), scheint er den Ausschlag zu geben, welchen zukünftigen, quantenmechanischen Zustand das System annimmt. Aus der Wahlmöglichkeit des Beobachters ergibt sich eine gewisse Versuchung, ihm eine konstitutive Funktion bei der Etablierung der Mikrowelt zuzugestehen." Die Fragestellung führte dann vor allem Duch Bauer und London zu einer extremen Bewusstseinsphysik. Der Beobachter, als ein mit einem Ich-Bewußtsein ausgestattetes Lebewesen, konstituiert die neue physikalische Objektivität, also die Drehung des Zustandsvektors im Hilbertraum. Dagegen wurde insbesondere eingewendet, dass auch das menschliche Bewusstsein und seine Zustände selbst wieder in den Sog der quantentheroetischen Überlagerungen gezogen werden müsse und keine Sondereigenschaften besitzen dürfte. Als weitere Frage wurde vorgebracht, wie man den Messprozeß jemals zu Ende bringen könnte, da jedem Beobachter ein weiterer nachgeschaltet werden könnte und die wachsende Überlagerung quantenmechanisch beschreibbar wäre. Man gelangt, um nicht in einen infiniten Regreß zu gelangen zum Modell des "Ultimate Observers" (Barrow und Tippler). Die beiden "setzen den Letzbeobachter beim geschlossenen Universum auf die Endsingularität, für den offenen Fall verschieben sie ihn in die zeitartige Zukunftsunendlichkeit. An diesen extremen Orten macht der "Ulitmate Observer" nun wirklich die letztmögliche Beobachtung. Da jenseits dieser Ränder des Universums Zeit nicht mehr existiert, ist nach der Endbeobachtung keine weitere Zeit mehr möglich. Es gibt also unter dieser Annahme eine unendliche Folge von Beobachtungen, zu der keine Beobachtung mehr hinzugefügt werden kann. Damit reduziert der Endbeobachter die Riesensuperposition auf einen Wert – ohne die v.Neumann Katastrophe, aber nur weil dieser Beobachter nicht auf einem Element der Raumzeit sitzt, auf die die Quantenmechanik anwendbar ist. Dieser Lösungsversuch für das Messproblem macht also von der Tatsache Gebrauch, dass die Endsingularität bzw. die zeitartige Zukunftsunendlichkeit nicht Teile, sondern nur Ränder der Raumzeit bilden."
Alle hier möglichen Varianten der Erkenntnis von "Objekten" und ihre Oszillationen stellen im Sinne des Allbegriffs der Physik Verfahren der INTUITION dar. Was geschieht, wenn diese intuitiven Varianten im Wege der DEDUKTION mit den göttlichen Grundbegriffen in Verbindung gebracht werden?
Wahrheitstheorie: Im Subjekt (in der Kommunikation von Subjekten) erzeugte Konstrukte (Aussagen) über Objekte, die als vom Subjekt unabhängig erkannt werden, können nur dann als wahr gelten, wenn erkannt werden kann, wie Subjekt und Objekt in unter Gott sind. Der Bau eines Objektes wird nur dann als wahr erkannt, wenn in DEDUKTION erkannt werden kann, wie das Objekt für Gott in sich gebaut ist. Hierzu ist aber a) zu sichern, dass dem Subjekt die Möglichkeit eröffnet ist, alles so zu erkennen, wie es an oder in unter Gott gebaut ist (vgl. vorne die Grundwissenschaft). Da für Gott zwischen seiner ontischen An- und Instruktur einerseits und seiner Erkennntis (Logik) dieser seiner An-und Instruktur inhaltliche Deckung besteht, ergibt sich hieraus auch eine neue (inhaltliche) Synthetische Logik, die so wie die klassische Logik eine eigene Evidenz besitzt, in der die von Mittelstaedt benützte formale klassische Logik und die Quanten-Logik nur innere, endliche und in vieler Hinsicht irrige Sonderfälle sind. In unserer Zeichnung werden daher folgende Begriffstypen betroffen:
CT die Begriffe der physikalischen Theorie selbst;
CL die Begriffe der klassischen Logik und der Quantenlogik und die Grundbegriffe der Mathematik, die in vielfacher Hinsicht die Grundlagen der klassischen und der modernen physikalischen Theorien mitgestalten;
CS die Begriffe der Umgangssprache als Metasprache, die auch wir hier wieder im Metadiskurs benützen.
Für die Deduktion wichtig sind die im Allbegriff der Physik enthaltenen Begriffe C (wi), die Ideen aller hier thematisierten Bereiche.
Wir sagen daher nicht, dass "Objekte der Physik" reine subjektive Illusion seien, sondern wir gehen sehr wohl von der Annahme aus, dass es außersubjektive "Objekte" gibt. Die Zugänge, die uns die Erkenntnisschulen (1) bis (3) bieten, haben aber ihre ernsten theoretischen und wie wir in der Quantenphysik deutlich sehen, auch experimentellen (Messung) Grenzen. Wir haben aber auch noch einen weiteren Zugang zum vorerst nur einmal ein inner- oder intersubjektives intuitives Konstrukt darstellenden "Objekt". Dieser führt über die unendliche göttliche Wesenheit, in der wir selbst und das "Objekt" enthalten sind. Die DEDUKTION wird mit dem intuitiven Produkt in KONSTRUKTION verbunden.
In einem logischen Atomismus in der Abstrakten Quantentheorie (AQT) versucht Weizsäcker und im weiteren Lyre eine fundamentale Begründung der Naturphilsophie (jenseits der Ereignisse in der Raumzeit). Diese Theorie wird hier infolge ihrer hohen philosophischen Ansprüche aufgeführt. Ihre Mängel im Sinne der Wesenlehre werden herausgearbeitet. Dieses Verfahren ist aufwendig, seine Folgerungen wirken jedoch auch auf andere Interpretationsversuche der Quantenphysik weiter. In (Ly 04) heißt es u.a.:
Die Ur-Theorie setzt die fundamentale Gültigkeit der Quantentheorie voraus. Dabei wird der Theorientyp " Quantentheorie" ganz allgemein als Vorhersagetheorie über empirisch entscheidbare Alternativen angesehen. In der so verstandenen Quantentheorie - Weizsäcker nennt sie Abstrakte Quantentheorie (AQT) - ist zunächst noch nicht von Teilchen in Raum und Zeit die Rede, sondern lediglich von Alternativen.
Für den zentralen Terminus der Ur-Alternative gibt Weizsäcker die folgende Definition: Die binären Alternativen, aus denen die Zustandsräume der Quantentheorie aufgebaut werden können, nennen wir Ur-Alternativen. Das einer Ur-Alternative zugeordnete Subobjekt nennen wir ein Ur. (Weizsäcker 1985, S. 392).
Man kann auch sagen: Ur-Alternativen repräsentieren den Informationsgehalt einer möglichen Ja-Nein-Entscheidung, also 1 bit quantentheoretisch behandelte potentielle Information (Quantenbit).
Die Ur-Hypothese besteht nun in der Annahme, dass die Zustandsräume aller Objekte der Physik essentiell aus Uren aufgebaut sind. Im Sinne der AQT ist dies ein logischer, kein räumlicher Atomismus. Da sich nun jeder n-dimensionale Hilbertraum in das Tensorprodukt von k zweidimensionalen Hilberträumen mit 2^k > n abbilden lässt, so dass seine lineare und metrische Struktur erhalten bleibt, ist die Ur-Hypothese quantentheoretisch trivial.
Die wesentliche Symmetriegruppe eines Urs ist die SU(2). Eine Welt, die aus Uren aufgebaut ist, sollte also wesentlich invariant unter dieser Gruppe sein. Die zentrale Grundannahme der Ur-Theorie ist nun, dass bereits der Ortsraum eine Folge der Ur-Hypothese und mithin der Symmetriegruppe des Urs ist.
Diese Annahme lässt sich wie folgt motivieren: Man kann den Ortsraum als Parameterraum der Wechselwirkungsstärke ansehen. Ein geeignetes Ortsraummodell wäre demnach die Parametermannigfaltigkeit der SU(2) selber, d.h., die SU(2) als homogener Raum aufgefasst. Diese ist topologisch eine S^3, d.h., die Einheitssphäre des R^4, also isomorph dem Ortsanteil eines Einstein-Kosmos. In der Ur-Theorie wird die SU(2) daher selbst als naheliegendes, genähertes Modell des Kosmos aufgefasst.
Man sieht hieran, dass Ure keinesfalls als gewöhnliche Elementarteilchen in Raum und Zeit zu verstehen sind, denn sie sind als Funktionen auf der Gruppe nicht lokalisierbar. Dies paraphrasiert Weizsäcker, wenn er sagt, das Ur kennt den Unterschied zwischen Teilchenphysik und Kosmologie noch nicht (Weizsäcker 1985, S. 400). Seine Symmetrie begründet erst den Raum.
Das Buch Die Einheit der Natur (Weizsäcker 1971) erscheint. Es enthält in seinem zentralen Kapitel II,5 die Übersetzung des Aufsatzes The unity of physics, eines Konferenzbeitrags Weizsäckers von 1968. Hier wird nun die Einheit der Physik in der bereits etablierten Quantentheorie gesucht. Diese wird als eine allgemeine Theorie zur Vorhersage empirisch entscheidbarer Alternativen axiomatisch, der Dissertation von M. Drieschner (Drieschner 1970) folgend, aufgebaut. Aus dem Finitismus, der Betrachtung endlichdimensionaler Zustandsräume, folgt die Existenz eines endlichen Raumes. Objekte im Raum werden aus Ur-Objekten oder kurz Uren mit zweidimensionalen Hilberträumen aufgebaut. Weizsäcker schätzt ihre Zahl auf 10^120 und führt in einer kleinen Rechnung vor, dass aus der Urhypothese ungefähr die kosmische Massendichte folgt. Es ist wichtig zu sehen, dass Ure keine gewöhnlichen Elementarteilchen in Raum und Zeit sind, sie können als "logische Atome" aufgefasst werden, deren Symmetrien die Raum-Zeit und alle Objekte mit ihren Wechselwirkungen bestimmen.
Im Rahmen der AQT werden, wie wir sehen, die Natur, der Kosmos, im weiteren die Raumzeit nicht vom ontologisch Unendlichen und Absoluten nach innen erkannt, sondern ausgehend von logischen Alternativen, Ur-Alternativen, logischen Atomen, die den Informationsgehalt einer möglichen Ja-Nein Entscheidung, also 1 bit quantentheoretisch behandelte potentielle Information (Quantenbit) enthalten.
In (Ly 96, S 6) ergeben sich Lyres Auffassungen:
"The cosmic time (the epoch) is correlated with the total number of urs, i.e. the increase of the number of urs has to be understood as an expression of time. Consequently at a certain epoch there will be only a finit number of urs in the world. This number can be estimated at about 10120. Weizsäcker calls this open finitism. If we keep the curvator radius R of S3 constant, we find, that with passing time there are more and more alternatives available to divide R into smaller and smaller intervals. Equivalently , we could say, that our unit sticks to measure spatial lengths decrease. But for open finitism, it follows that the procedure of division, i.e. "counting" of ur-alternatives, takes time and, thus, space is "continuous (i.e. infinite) only in a potential sense." Eine zusätzliche Überlegung sagt (in Ly 94, S. 6):" Space is by no means "empty", it is at least filled up with urs. Moreover, its structure as a global S3 is a consequence of the isomorphic structure of the abstract symmetry group of urs, i.e., space is the appearance of pure information in the world. Apart from this further appearances of information like energy and matter exist. Hence radiation and massive particles as well as the vacuum density will be described by density situations of urs, i.e. information. In that sense energy and matter can be looked upon as condensates of information in front of background of urs representing vacuum."
"Ganz allgemein enthält der abstrakte Aufbau der Quantentheorie lediglich Begriffe wie Zustand, Objekt, Wahrscheinlichkeit und Dynamik, aber noch keine "konkreten" physikalischen Konzepte wie Raumzeit, Energiematerie oder Teilchen." (Ly 99, S. 8).
Lyre versucht in diesem Rahmen auch die Frage der Aprioris neu zu durchdenken. In (Ly 97) zeigt sich, dass vor allem der Begriff der Ganzheit und deren Teile, sowie deren Verhältnis zueinander fundamental sind. "In der klassischen Physik ist ein Ganzes jederzeit in Teile trennbar, derart, dass die Teile echt unkorreliert sind. Hier zeigt sich der Zusammenhang zwischen der Teil-Ganze-Problematik und dem Begriff unseres dreidimensionalen Ortsraumes. Eine Bedingung dafür, dass zwei Objekte tatsächlich voneinander isoliert sind, ist der empirische Nachweis, sie an getrennten Orten im Raum zu finden." (...) Der quantentheoretische Zustandsraum ist mathematisch ein sogenannter HILBERT-raum. Hierbei sind zwei Charakteristika beachtenswert. Erstens im Gegensatz zum Phasenraum der klassischen Physik lässt sich ein durch einen HILBERTraum dargestelltes Objekt nicht a priori eindeutig in Teilobjekte, d.h. Teilräume, zerlegen. Zweitens ist die Zerlegung von der Art, dass die Teile auch nach der Zerlegung in Beziehung zueinander stehen. Der Gesamt-HILBERT-raum wird nämlich durch ein Tensorprodukt von Teil-HILBERT-räumen gebildet, wobei die Struktur des Tensorproduktes erzwingt, dass weiterhin Korrelationen zwischen den Teilobjekten bestehen." Die Quantentheorie enthalte daher eine "Art von Holismus". Lyre legt Wert auf die Feststellung, dass sich aus der seiner Meinung nach universellen Gültigkeit der QT nicht ergeben darf, dass auch das erkennende Subjekt quantentheoretisches Objekt werden könnte. Es bliebe dann kein Subjekt mehr übrig, für das die durch das Objekt ausgedrückte Information noch Information wäre (Irreduzibilität des Subjektes in der transzendentalen Argumentation). Folgender Satz geht in eine selten beschrittene Richtung: " Aus diesen faszinierenden Erwägungen folgt jedoch noch nicht, das Phänomen des Bewusstseins als informationstheoretisch reduzibel anzusehen. Es bleibt offen, ob nicht gerade Begrifflichkeit und Empirizität nur möglich sind über den Urgrund nicht-empirischen, nicht-propositionalen, nicht-begrifflich artikulierbaren "Wissens"[33].
Der vollständige Begriff der Information soll nach Lyre auf die beiden rudimentären apriorischen Prinzipien der Unterscheidbarkeit und der Zeitlichkeit zurückgeführt werden können. "Das Subjekt muss zum begrifflichen Diskurs fähig sein. Die Fähigkeit, Begriffe zu bilden setzt aber rudimentär voraus, dass Unterscheidungen möglich sind. Denn einerseits ist begriffliches Denken trennend in der Art, dass diejenigen Einzelbegriffe, die unter einen Ober-Begriff fallen, als prinzipiell trennbar angesehen werden , andererseits setzt sich ein Begriff trennend von demjenigen ab, was nicht unter ihn fällt. In der Quantentheorie finden wir vergleichbare Strukturen: um ein Objekt zu konstituieren, muss es vom Rest der Welt trennbar gedacht, also unterschieden werden. Die an ihm vorfindbaren Zustände sind ebenfalls unterscheidbar. Dabei befinden wir uns zunächst im Stadium der Möglichkeit der Unterscheidung" (potentielle Information ).
"Indem ich Möglichkeit von Wirklichkeit, Potentialität von Faktizität absetze, kommt die Zeitlichkeit als weitere apriorische Vorbedingung ins Spiel. Das speziell empiriebegabte Subjekt, welches in jeder Erfahrungswissenschaft vorauszusetzen ist, muss wenigstens die strukturellen Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung erfüllen. Es ist daher die Struktur der Zeit, namentlich der Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft, vorauszusetzen. (...) Der Indeterminismus ist daher eine notwendige Eigenschaft einer fundamentalen Physik. Die Zukunft ist offen, die Vergangenheit faktisch. Die Reduktion der Wellenfunktion ist Ausdruck des notwendig stattfindenden Übergangs von potentiell zu aktuell bei Kenntnisnahme der an einem Objekt gewinnbaren Information durch ein empiriebegabtes Subjekt. Die Basisprinzipien der Unterscheidbarkeit und Zeitlichkeit verweisen durchaus auf den Holismus der Quantentheorie. Ein Ganzes ist der Möglichkeit nach in unterscheidbare Teile zerlegbar. Aber getrennte Teile liegen erst dann vor, wenn faktisch eine Teilung mittels Messung durchgeführt wurde. Dann aber ist das ehemalige Ganze bereits zerstört. Man beachte, wie in diesen Verbalisierungen unterscheidende und zeitliche Sprechweise ineinandergreifen. Die Quantentheorie kennt die Teilbarkeit in ununterscheidbare Teile. Hierin kommt noch der primäre Charakter des Ganzen zum Ausdruck, das nur prinzipiell, dann aber bei Zerstörung des Ganzen, in Teile zerlegt werden kann. Vor der aktuellen Teilung sind die Teile nicht individuiert. Ein Quantenfeld "besteht" daher als Ganzes aus ununterscheidbaren Feldquanten."
Lyre versucht dann eine Verbindung zwischen der Welt als Ganzem und dem logischen Atomismus herzustellen. Kann man nun eine quantentheoretische Vereinheitlichungstheorie entwerfen, die sowohl der Ganzheitlichkeit gerecht wird, "als auch der erkenntnistheoretischen Verankerung der Quantentheorie als abstrakter Theorie der Information in der es in Näherung Objekte gibt, sofern diese eben von Subjekten konstituiert werden. "Betrachten wir die Welt als Ganzes. Es gibt dann einen denkbaren Zustandsraum dieser Welt, der zunächst keine Zerlegung in Teilobjekte präjudiziert. Dieser Zustandsraum kann als extrem hochdimensional aber endlich[34] angenommen werden, denn die durch ihn beschriebene Welt ist die Gesamtheit des empirisch Wissbaren – wissbar ist aber in endlicher Zeit immer nur endliches Wissen. Dieses Wissen können wir als Menge an Information ansehen. Unter den vielen möglichen Zustandsraumzerlegungen ist dann diejenige ausgezeichnet, die den Zustandsraum in quantentheoretische binäre Alternativen sogenannte Quantenbits zerlegt. Der obigen Charakterisierung der Wellenfunktion als potentieller Information im Sinne von Quanteninformation, so dass ein n-Bit-Zustand in einem n-fachen Tensorprodukt von 1-Quantenbit-HILBERTräumen, also zweidimensionalen komplexen Vektorräumen dargestellt wird. Es ist dann mathematisch trivial, dass jeder endlichdimensionale HILBERTraum in ein endliches Tensorprodukt von Quantenbits eingebettet werden kann. Die Quantentheorie führt geradezu zwangsläufig auf diese Art logischen bzw. informationstheoretischen Atomismus." (...) "Ure sind Elementarteilchen in der Raumzeit, ein einziges Ur ist bereits eine Darstellung des gesamten Kosmos."
Jenseits des mathematisch-physikalischen Apparates der AQT arbeitet Lyre sorgfältig die philosophischen Grundlagen derselben aus (Ly 98, S. 164 f.). Gerade sie sind für unsere Kritik als Basis wichtig. Entscheidend ist, dass Lyre selbst zugibt, dass die AQT spekulativ ist, da gegenwärtig kein empirisches Falsifikationskriterium existiert (Ly 98, S. 191).
Ausgegangen wird von der binären Alternative ( z.B. a ODER b). Unterschieden wird zwischen einer vollständigen Alternative (A oder Nicht-A) und einer allgemeinen Alternative mit der Struktur: A oder B, wobei A nicht notwendigerweise Nicht-B oder umgekehrt B nicht notwendigerweise Nicht-A entspricht. Zu Recht nimmt Lyre an, dass vollständige Alternativen fundamentaler sind. Geklärt wird jedoch nicht, wie wir bei fundamentalen Alternativen wissen können, wann sie INHALTLICH "wirklich" vollständig sind. Wir müssten dann ja den binär alternativen Inhalt in eine inhaltliche Beziehung zu etwas setzen können, demgegenüber sie inhaltlich vollständig alternativ sind.
Lyre geht den Weg, diese Frage über die empirische Entscheidbarkeit zu prüfen. Empirisch entscheidbare Alternativen sind solche, deren objektive, d.h. intersubjektive Entscheidung durch eine Beobachtung oder Messung im Rahmen eines prinzipiell für jedermann wiederholbaren Experiments herbeigeführt werden kann. Die "Objektivität" der Entscheidung wird durch Intersubjektivität "gesichert". Wir sehen hier eine empiristisch orientierte "Wahrheitstheorie" formuliert, die bereits beachtliche Grenzen der Theorie absteckt (vgl. hierzu in der Wesenlehre trans-(inter)subjektive und transobjektive Wahrheitssicherung in der absoluten und unendlichen Essentialität). Das Objekt-Subjekt-Problem wird im weiteren zirkulär gelöst. Erfahrung setzt einen Vorgang in der Zeit voraus. Die zeitliche Struktur lautet: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Die Vergangenheit ist faktisch, die Zukunft offen.
Ein abstraktes Ableitungssystem soll den vollständigen Informationsbegriff entwickeln.
Begriffliche Erkenntnis setzt Unterscheidbarkeit voraus. Unterscheidung ist möglich, sofern begriffliche Erkenntnis möglich ist. Unterscheidbarkeit ist notwendige Vorbedingung von Erkenntnis. Unterscheidbarkeit ist mögliche Form oder potentielle Struktur. Ohne jegliche Unterscheidung wäre alles eins. Das Prinzip erscheint in seiner Abstraktheit unhintergehbar – es ist gewissermaßen so selbstverständlich, dass es häufig übersehen wird." Er nimmt Bezug auf das formal-logische A und Non A.
Und nun folgt der entscheidende Satz, der Lyres weiteren Weg vorgibt und womit er sich die Erkenntnis bestimmter Arten von Begriffen verschließt:
"Die Unmöglichkeit mit Mitteln der Sprache über das Eine zu reden, es zu denken, ohne die Vielheit, beginnend etwa mit dem Nicht-Einen, ebenfalls zu denken, ist ja ein klassischer philosophischer Topos, wie er bereits in Platons Parmenides-Dialog deutlich wird."
Kritik: Wie hier in der Wesenlehre gezeigt wird, ist es sehr wohl möglich, eine Sprache zu erfinden, die es ermöglicht, die neuen Erkenntnissen über das Eine, nämlich über Gott als das Eine, unendliche und unbedingte Grundwesen zu formulieren. Die neue Sprache muss allerdings eine neue Struktur haben, die der Struktur Gottes an und in sich entspricht. Diese Sprache überschreitet natürlich die Sprachen der derzeitigen formalen Logik und Mathematik (vgl. vorne "Struktur der Universalsprache, Or-Omsprache und http://www.internetloge.de/krause/krspra.htm ).
Die Ableitung Lyres beginnt daher mit der Zweiheit, da nach seiner Ansicht die Einheit überhaupt der begrifflichen Erkenntnis nicht zugänglich ist! Wie sich aber zeigt, kann der Inhalt binärer Alternativen überhaupt erst durch die inhaltliche Deduktion derselben aus einer übergeordneten Einheit möglich sein. Wie wir sehen werden, geht aber Lyre immer iterativ von Binaritäten zu weiteren Binaritäten zirkulär vor, und meint, wie viele andere Erkenntnistheorien, dieser Zirkel sei das einzige Vehikel der Entwicklung von Erkenntnis. Wir erblicken darin einen der Gründe dafür, weshalb er auf S. 159 zugeben muss, dass die Beschreibung der Wechselwirkung das große, bislang ungelöste Problem der Urtheorie sei.
Die einfachste überhaupt mögliche Unterscheidung wird nach Lyre Binarität genannt. Alternativen sind logische Darstellungen von Unterscheidbarkeiten. In Alternativen werden Aussagen logisch unterschieden. Lyre meint natürlich im Sinne der formalen Logik.
Nun tritt er in die äußerst heikle Objekt-Subjektbeziehung ein. Subjekte treffen Unterscheidungen. Unterscheidbarkeiten gibt es für Subjekte. Objekte werden durch mögliche Unterscheidungen konstituiert. Unterscheidbarkeiten gibt es an Objekten. "Die Setzung eines Subjekts und eines Objekts beruht bereits auf einer Unterscheidung." Sehr treffend stellt Lyre fest, dass das Unterscheidbarkeitsprinzip notwendigerweise selbstanwendbar ist. "Die notwendige Selbstanwendbarkeit des Unterscheidbarkeitsprinzips bedeutet, dass jegliche Unterscheidung immer nur möglich ist vor dem Hintergrund bereits vorgenommener, bzw. möglicher Unterscheidungen, welche man auch durch Subjekte und Objekte bezeichnen kann. Jede Binarität setzt in diesem Sinne bereits eine unbestimmte, aber sicher große Zahl anderer Binaritäten voraus." Dies führt nach Lyre zur Zirkularität, einer inhärenten Zirkularität von Information, die Zirkularität von Information ist unvermeidbar. "Es kann keinen Startpunkt geben".
Kritik: Zum einen ist zu beachten, dass das Konzept der Zirkularität selbst nicht der Zirkularität unterworfen wird. Selbstereferentielle Konsistenz ist nicht gegeben[35]. Denn es wird angenommen, dass die Zirkularität selbst nicht zirkulär ist, denn ansonsten müsste sie selbst zirkulär veränderbar sein. Die Zirkularität wird selbst zum Startpunkt.
Der bei Lyre so deutliche Akzent der subjektiven Konstruktion des 'Objektes' in der Information wird auch nicht konsequent durchgeführt. Es gibt in diesem Sinne keine "Objekte" sondern die Unterscheidung von Subjekt und Objekt ist auf dieser Ebene der Analyse ausschließlich eine Binarität IM Subjekt, also eine inner-subjektive oder inter-subjektive binäre Konstruktion. Es gibt in diesem Sinn keine Objekte, sondern nur bestimmte Modifizierungen innersubjektiver Konstruktvarianten in der "Unterscheidung des Subjektes vom Objekt". Es gibt im übrigen bereits eine Vielzahl von Varianten hinsichtlich der Art, wie Subjekte die Unterscheidung von Subjekt und Objekt (subjektiv oder intersubjektiv) durchführen. Gegenstand der Postmoderne ist eben die Frage einer Verwaltung dieser verschiedenen Varianten der Konstruktion der Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt als subjektiver Konstrukte in verschiedenen Subjekten zu sichern.
Im weiteren erarbeitet Lyre den Begriff der Information, als dem Maß (Maßbegriff) für den Grad der Unterscheidbarkeit. Ihre Einheit ist das bit. Das bit ist die Informationsmenge einer Binarität. Wieder ungenau ist dann der Satz: Information gibt es für ein Subjekt an einem Objekt. Wir sahen, dass es auf dieser Art der Erkenntnis keine 'Objekt' gibt, das etwas anderes wäre als ein innersubjektives Konstrukt. Es müsste daher richtig heißen: " Information als subjektives Konstrukt gibt es für ein Subjekt an seinem Konstrukt, das es durch Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt in sich als 'Objekt' konstruiert hat. Natürlich wird zu Recht angenommen, dass es ein 'Objekt' "unterschieden vom Subjekt" gibt, aber die Zugänglichkeit ist keine andere als die über die Erzeugung subjektiver Konstrukte, für deren Sicherung der "Adäquanz zum Objekt" (Wahrheitsproblematik usw.) wir auf dieser Ebene keine Kriterien besitzen. Lyre schreibt: "der vollständige Informationsbegriff beinhaltet, dass Information weder als eine rein subjektive noch als eine rein objektive Größe angesehen werden kann." "Demnach besteht die Möglichkeit zur Unterscheidung einerseits objektiv, insofern es Information gibt, die intersubjektiv prüfbar ist. Ferner besteht Unterscheidbarkeit andererseits subjektiv, da klar ist, dass eben wir, vernunftbegabte Subjekte, es sind, die von Information reden – dies gilt aber natürlich grundsätzlich für alle Begriffe. Die strenge Trennbarkeit zwischen reiner Subjektivität und reiner Objektivität von Information gerät durch die hier gegebene Transzendentalbegründung der abstrakten Theorie des vollständigen Informationsbegriffs offenbar an ihre Grenzen". "Subjekt und Objekt, Beobachter und Beobachtetes sind infolge der Figur der Rückbezüglichkeit nicht eindeutig voneinander trennbar."
Wie nahe Lyre oft Kant kommt, zeigt (Ly 04, S. 195): "Die objektive Realität der Physik ist die Realität physikalischer Objekte als Erscheinungen, nicht die transzendentale der ihnen zugrundeliegenden Dinge an sich. Insofern unser Aufweis dieser Realität an Konstitutionsleistungen apriorischer Erkenntnis gebunden ist, bricht die Unterscheidung zwischen ontisch und epistemisch zum Teil zusammen. Vielleicht rührt die Attraktivität eines intermediären Weges des Strukturenrealismus genau hierher."
Kritik: Da Lyre oben selbst betont, dass Information subjektives Konstrukt darstellt, ist die nunmehr akzentuierte Trennbarkeit in eine objektive und eine subjektive Seite nicht zulässig. Auch die 'Objektivität' ist auf dieser Ebene der Erkenntnis ein Aspekt der Subjektivität. Wie schon öfter betont, führt erst die Aufsuchung eines transsubjektiven und trans'objektiven' Grundes der beiden zu einer Überwindung dieser Fesselung der Erkenntnistheorie in den Fängen der Subjektivität, die sich (nicht bei Lyre!) dann noch in naiven Varianten einbildet, sie könnte einen Bereich des Objektes als getrennten Bereich neben dem Subjekt erkennen und seine Erkenntnisse mit dem beobachteten Objekt vergleichen und dann feststellen, ob seine diesbezüglichen Erkenntnisse wahr sind. Weiters ist Lyres Gleichstellung von Objektivität mit intersubjektiver Prüfbarkeit einer Information ungenau. Etwas, das jemand über ein 'Objekt' subjektiv oder intersubjektiv konstruiert, wird dadurch nicht schon objektiv, dass es intersubjektiv geprüft wird, da auch die Prüfung intersubjektiv und nicht objektiv ist. "Insofern Information aber nur dasjenige ist, was für ein Subjekt an einem Objekt existiert, ist Information weder eine rein subjektive noch eine rein objektive Größe." Eine objektive Größe kann es in diesem Rahmen der Untersuchung überhaupt nicht sein, sie ist immer subjektives Konstrukt. Sehr bedenklich, wenn auch intuitiv wiederum interessant ist der Satz: "Der Stoff aus dem unser Wissen besteht, ist per se auch der Stoff, aus dem die Welt selbst besteht (da wir sinnvoll nur von einer Welt reden können, die prinzipiell wißbar ist). Dieser 'Stoff' ist Information." Einerseits muss ein subjektives Wissen über etwas auf keinen Fall aus dem gleichen Stoff sein, wie dasjenige was gewusst wird. Zum zweiten würde das in der Naturphilosophie bedeuten, dass unser Wissen von der Natur nur Natur sein kann, was immer man darunter versteht. Es ist aber keineswegs so klar, dass die subjektiv-epistemische Seite unseres Wissens von der Natur lückenlos durch die objektiv-ontische Seite unserer Herkunft aus der Natur bestimmt ist! Wichtig ist aber besonders, dass Lyre seine Transzendentalität nicht konsequent verfolgt, denn sonst müsste er sagen: Wir erzeugen mit unserem subjektiven Stoff an Begriffen ein Bild von Objekten, eben subjektiven Stoff, subjektive Information (eine semantische Ebene), aus welchem Stoff das Objekt nun "wirklich ist", können wir nicht wissen. Wir dürfen nicht die Bilder, die Informationen, die wir subjektiv konstruieren als etwas Getrenntes in Verdoppelung auf Objekte außer uns übertragen, und dann auch noch sagen, die Struktur unserer subjektiven Information ist auch die Struktur (Information) des durch Verdoppelung erzeugten Objektes außer uns. Es gibt für uns erst einmal nur EINE Information, EINEN Stoff, der sich auf ein 'Objekt' bezieht! Diese Verdoppelungstendenz führt daher zu gefährlichen Gleichsetzungen, die epistemisch Lyres Grundannahme widersprechen. Zum Satzteil Lyres: "ist auch per se der Stoff aus dem die Welt besteht": Intuitiv interessant ist diese Überlegung nur, weil wir eben sehr wohl die Frage stellen können: Wie könnten wir wissen, ob die Struktur unserer subjektiv erzeugten Information über ein Objekt mit der Struktur des Objektes wirklich übereinstimmt, daher wahr ist. Doch um diese Frage sinnvoll stellen zu können, müssen wir prüfen, ob wir die Möglichkeit haben, in einem absoluten und unendlichen Urgrund (höchste semantische Ebene) zu erkennen, wie Subjekt und alle Objekte außer dem Subjekt in diesem absoluten Urgrund strukturiert sind. Gerade davon behaupten wir, dass diese Frage lösbar ist. Aber hier muss natürlich jeder selbst prüfen und entscheiden.
Der Informationsbegriff wird im weiteren hinsichtlich seiner Syntaktik, Semantik und Pragmatik ausdifferenziert.
Die Zeitlichkeit erarbeitet Lyre über die empirische Erkenntnis. Das Zukünftige ist möglich, das Vergangene aktuell. Der zeitliche Übergang zwischen diesen beiden Gegensätzen ist dasjenige, was erfahrbar, also auf empirischem Wege erkennbar ist. Denn die Erfahrung ist gekennzeichnet durch die Kenntnisnahme dessen, was vorher potentiell, nachher aber aktuell besteht. Empirische Erkenntnis setzt Zeitlichkeit voraus. Zeitlicher Übergang ist möglich sofern Erfahrung möglich ist. Unterscheidbarkeit und Zeitlichkeit sind verwoben. Und dann die Formulierung der beiden Aprioris: " Information ist aus Unterscheidbarkeit und Zeitlichkeit als Bedingungen der Möglichkeit von empirischer Erkenntnis ableitbar" (Transzendentalbegründung der Information. Gegenüber Kant hält Lyre seinen Anspruch für umfassender, da Unterscheidbarkeit alleine für ihn als Bedingung von Erkennntnis (nicht nur möglicher Erfahrungserkenntnis) gilt. Lyre räumt aber ein: " Der Aufweis apriorischer Prinzipien kann aber nur vorbehaltlich der Möglichkeit geschehen, dass sich durch zukünftige Kenntnisse heutige Voraussetzungen als zu eng oder schlicht als falsch erweisen." Gerade dies versuchen wir zu zeigen, nämlich dass Lyres Apriorisierung noch mangelhaft ist.
Wir wollen schließlich die Begründungssätze Lyres hinsichtlich des Informationsbegriffes mit seinen eigenen kosmischen Überlegungen konfrontieren. Objekte werden nach Lyre durch mögliche Unterscheidungen konstituiert. Wir versuchten zu zeigen, wie sehr die Information ein innersubjektives Konstrukt bleibt, auch wenn Lyre versucht, es in der Unterscheidung subjektiv-objektiv zu verdoppeln. Die schon oben zitierten Sätze Lyres müssen wir jedoch auch in seinem Sinne als subjektive, vielleicht intersubjektiv überprüfbare Konstrukte auffassen.
"The cosmic time (the epoch) is correlated with the total number of urs, i.e. the increase of the number of urs has to be understood as an expression of time. Consequently at a certain epoch there will be only a finit number of urs in the world. This number can be estimated at about 10120. Weizsäcker calls this open finitism. If we keep the curvator radius R of S3 constant, we find, that with passing time there are more an more alternatives available to divide R into smaller and smaller intervals. Equivalently , we could say, that our unit sticks to measure spatial lengths decrease. But for open finitism, it follows that the procedure of division, i.e. "counting" of ur-alternatives, takes time and, thus, space is "continuous (i.e. infinite) only in a potential sense." Eine zusätzliche Überlegung sagt (in Ly 94, S. 6):" Space is by no means "empty", it is at least filled up with urs. Moreover, its structure as a global S3 is a consequence of the isomorphic structure of the abstract symmetry group of urs, i.e., space is the appearance of pure information in the world. Apart from this further appearances of information like energy and matter exist. Hence radiation and massive particles as well as the vacuum density will be described by density situations of urs, i.e. information. In that sense energy and matter can be looked upon as condensates of information in front of background of urs representing vacuum."
Hat nun Lyre oder Weizsäcker die 10120 Ure, die als binäre, empirisch entscheidbare Alternativen potentialiter jenseits von Raum und Zeit existieren, erst konstruiert oder nimmt man an, sie bestünden auch ohne Konstruktion durch Weizsäcker in welcher Form als "objektiv". Wer kann diese potentiellen Ure in die Aktualität überführen? Nur jemand, der solche Konstrukte wie die Ure in sich konstruiert oder auch jeder andere? Was geschähe mit den potentiellen Uren, wenn kein Mensch eine Konstruktion in ihre Hinsicht erzeugte? Stören die Konstrukte anderer theoretischer Physiker, welche andere Konstrukte bezüglich des Aufbaus des Kosmos jenseits von Raum und Zeit erzeugten, die Bildung aktueller Raumzeitsituationen der Ure (postmoderne Vielfalt der Theorien über den Aufbau des Kosmos)? Lyre versucht auf Seite 198 die Frage, ob diese Thesen "bloß subjektiv" seien mit dem Zirkularitätsargument zu beseitigen. Wir erwähnten aber das Problem, dass die Zirkularitätsthese selbst konstitutiv, als Bedingung der Möglichkeit ihrer selbst aus der Zirkularität ausgenommen sein muss! Die Selbstanwendung der Zirkularität führt zu ihrer Beseitigung! Die Annahme Lyres: "Ure sind sowohl als subjektive Ur-'Alternativen' wie als (objektive) Ur- 'Objekte' charakterisierbar" ist eben seine Verdopplung, die unzulässig erscheint, und die er durch die nicht streng mögliche Trennung von Subjekt und Objekt zu suggerieren versucht.
Ist die Zeit erst mit der Konstruktion empirischer Erkenntnis der Ure entstanden, und ist erst durch den Übergang der potentiellen Information der Ure in empirischer Erfahrung daraus aktuelle Information in der Raumzeit geworden? Wie sind Raum und Zeit subjektiv-objektiv zirkulär? Sind sie also subjektive Aprioris oder auch in der gleichen Weise, wie Lyre meint, objektive Eigenschaften des Kosmos. Aus dem offenen Finitismus Weizsäckers ergibt sich auch eine finitistische Erkenntnistheorie, die dazu führt, dass die Gesamtzahl der Ure ein Maß für die Menge an potentieller Information im Kosmos gibt, d.h. diejenige Zahl binärer Alternativen, die empirisch entschieden werden könnte, falls man sich für eine Entscheidung interessiert. Werden dann nur so viele Ure in aktuelle Information umgewandelt, als Menschen sich für eine empirische Entscheidung interessieren? Wie geht das vor sich?
Weitere Fragen: Warten die Ure als potentielle Informationseinheiten darauf, subjektiv empirisch erkannt zu werden, auf ihre Aktualisierung? Was ist im Kosmos, wenn niemand sie erkennen will? Warten außer den Uren auch andere Konstellationen jenseits von Raum und Zeit und jenseits der subjektiv-empirischen Erkennung durch Menschen (oder andere erkenntnisfähige Wesen?) auf ihre Aktualisierung durch empirische Erkenntnis? Gibt es zwischen den im Kosmos befindlichen Uren und anderen prä-subjektiven und jenseits von Raumzeit potentiellen Strukturen der Information eine Kollision, schon bevor sie durch subjektive Erkenntnis aktualisiert werden?
Um eine Verbindung zwischen dem logischen Atomismus der Ur-Theorie Weizsäckers und der Inhaltslogik der Wesenlehre herzustellen, wollen wir ein Gedankenexperiment entwerfen, ein Vorgang, der in der Physik durchaus üblich ist. Wir wollen uns vorstellen, dass es ein Volk der Karidonier gibt, welches in einem Kosmos lebt, der nur aus einer einzigen geraden Linie besteht, die unten dargestellt wird. Die Menschen leben in der Linie und beginnen im Lauf der Jahrhunderte, die Struktur der Linie, natürlich vom endlichen Umfeld ausgehend, zu erforschen, indem sie mit Begriffen Konzepte über die Zusammenhänge auf der Linie entwerfen, bis sie nach mehreren Jahrtausenden zu dem unten erläuterten Ergebnis gelangen. Dieses Ergebnis bedeutet für sie:
a) dass ontisch der Bau des Seins aller Elemente an und in der Linie auf diese Weise vollständig und in der Struktur erschöpfend dargestellt wird;
b) dass logisch im Sinne einer neuen Inhaltslogik der kategoriale Bau der Logik mit dem ontischen Bau der Linie an und in sich deckungsgleich ist;
c) dass alle vor dieser Neuerung entwickelten Theorien über die ontischen, logischen und mathematischen Zusammenhänge bezüglich der Linie und ihre Gliederung als innere, teilweise mangelhafte Theorien nachweisbar sind, deren Mängel in der neuen Theorie behebbar werden.
Wir führen nun dieses vollständige und umfassende Ergebnis der Karidonier in den Grundzügen vor[36].
Kategorienstruktur der geraden Linie
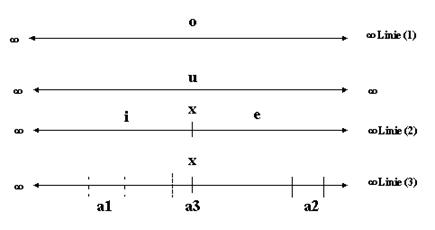
In unserem Gedankenexperiment wollen wir , wie schon erwähnt, annehmen, es lebe irgendwo eine Gesellschaft von Menschen, das Volk der Karidonier, deren Universum nur aus einer unendlich langen, geraden Linie besteht. Generationen von Forschern analysieren dieselbe und stellen Überlegungen an, wie diese Linie richtig zu erkennen sei, welche Logik sich aus den Inhalten dieser Erforschung ergebe. Sie fragen also: Wie muss der Bau unserer Logik sein, damit wir die Linie so denken, wie es ihrem Inhalt, ihrem Bau entspricht.
Wichtig ist bereits einleitend zu beachten, dass die deutsche Umgangssprache nicht ausreicht, um die hier entwickelten Erkenntnisse genau zu bezeichnen. Es müssen daher einige neue, klarere Bezeichnungen für das Erkannte, für das Gedachte eingeführt werden (z. B. "Or" für das Ungegenheitlich/Ganze/Eine, "ant" für das Gegenheitliche, "mäl" für das Vereinte, "Ab" für die Beziehung des Höheren zum Niederen, "Neb" für die Beziehung von Nebengliedern usw.). Da die hier deduzierten, abgeleiteten Begriffe im System (LO) eine andere Bedeutung haben, als in der bisherigen Umgangssprache und den bisherigen Wissenschaftssprachen, werden sie in der Axiomatisierung (LO) höherer Schriftgeröße geschrieben. Umgekehrt wird hier aber auch dazu angeregt, bisher überhaupt nicht gründlich genug Gedachtes erst einmal überhaupt zu denken.
(LO 1) Was die unendlich lange, gerade Linie o AN sich ist
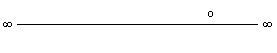
"AN" einem Wesentlichen ist, was von ihm ganz, durchaus gilt. "IN" einem Wesentlichen ist dasjenige Wesentliche, welches von ersterem ein Teil ist, und Gleichartiges des ersteren außer sich hat. Betrachtet wird bei der Linie o in (LO 1), was sie AN sich ist, also noch nicht, inwieweit sie vielleicht auch Teile usw. hat (LO 1.1). AN der Linie o wird die Wesenheit go (in der FIGUR 2 go, gu, gi, ge usw.) erkannt. An der Wesenheit die Einheit. Dass die Linie im weiteren (LO 1.2) und (LO 1.3) auch Zweiheit, Mehrheit, Vielheit, Vereinheit von mehreren Teilen usw. ist und hat, wird hier noch nicht erkannt. Die Einheit, die hier erkannt wird, ist eine ungegliederte, allen Teilheiten und Vielheiten "IN" der Linie übergeordnete Einheit, die wir der Genauigkeit wegen als OrEinheit (go) bezeichnen können.
(LO 1.2) AN der Wesenheiteinheit go der Linie werden die Selbheit (gi) und die Ganzheit (ge) erkannt. Die Selbheit bezeichnet man üblicherweise als Absolutheit und die Ganzheit als Unendlichkeit. Die Linie ist AN sich Eine, absolut und unendlich. Das Wort "Ganzheit" meint hier nicht eine Summe von Elementen, die zu einer Ganzheit zusammengefasst sind. (Diese finden sich erst in (LO 1.2 und LO 1.3.) Die Linie o ist IN sich auch Summen von Teilen usw. Aber als Linie o ist diese Verein–Ganzheit von Teilen noch nicht ersichtlich oder erkennbar. Diese Or–Ganzeit oder unendliche Ganzheit ist ein "über"geordneter Begriff. Das Wort "Selbheit" oder Absolutheit" der Linie o meint, dass sie an sich ist, ohne irgend ein Verhältnis nach außen. (Dies stimmt auch in unserem Modell, da es bei den Karidoniern außer der Linie o ja nichts gibt.) Wesenheiteinheit (go), Selbheit (gi) und Ganzheit (go) stehen in der Gliederung der FIGUR 2 zueinander. Für die Gliederung der Mathematik sind go, gi und ge die Grundaxiome. Für die Lehre von Gegensatz, Negation, positiven und negativen Zahlen sind es die Ableitungen IN go, für die Lehre von den Verhältnissen sind es die Ableitungen IN gi und für die Ganzheitslehre die Ableitungen IN ge. Go und ge sind auch miteinander vereint und mit go als gu.
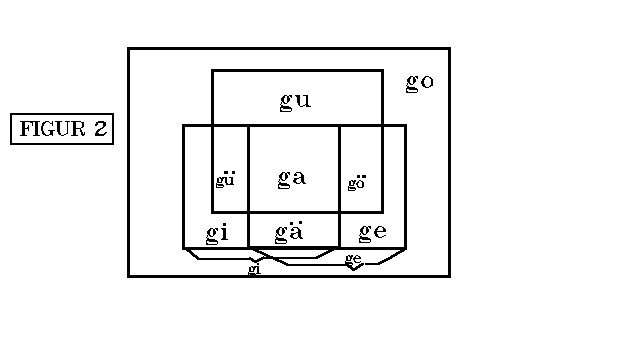
(LO 1.2.1) Wie ist die Wesenheit-Einheit (go) und wie sind im weiteren gi, ge und alle Verbindungen der Linie o in FIGUR 2? Die FORM der Wesenheit go ist Satzheit do. Die Linie o ist das eine Gesetzte, Positive. Hier An der Linie o gibt es noch keine Negation, keinen Gegen–Satz usw. Wir bezeichnen diese Satzheit als Or-Satzheit. Die Form der Selbheit gi ist Richtheit di oder Bezugheit (Relationalität), aber auch hier gibt es nur die Eine Richtheit ohne noch ein Hin und Her oder sonstige einzelne Richtungen zu unterscheiden, also Or-Richtheit. Die Form der Ganzheit ge ist Fassheit de ("um"fangen, befassen). AN der unendlichen, ganzen Linie wird noch nicht ein Um-fassen endlicher Ganzer erkannt, sondern dieses Fassen der Or-Ganzheit hat keine Endlichkeit (FIGUR 3).
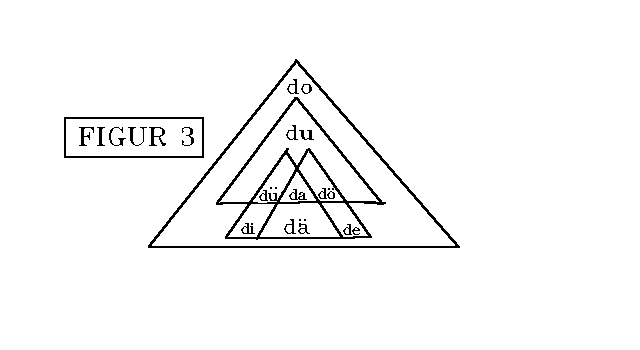
(LO 2) Was die Linie o IN sich ist
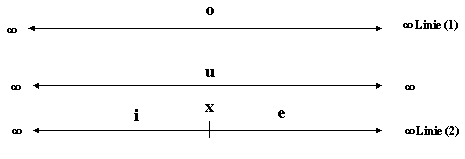
Die Linie o ist IN sich gemäß der obigen Zeichnung Gegenlinie und Vereinlinie nach INNEN, so dass die Linie IN sich zwei ihr als o untergeordnete und IN ihr selbst als ganzer selber Linie nebengegenheitliche Linien i und e ist, welche AN sich gleichwesentlich und sich darin neben-gegenheitlich sind, dass die eine von beiden ist, was die andere nicht ist und umgekehrt. Die Linie o aber, sofern sie ÜBER sich selbst als die beiden nebengegenheitlichen entgegengesetzten Linien i und e ist, ist die Urlinie u, von i und e unterschieden, und insoweit ist die Linie o in sich eine doppelgliedrige AB-Gegenlinie. Die Linie ist als u auch vereint mit den beiden Gegenlinien i und e. Die beiden Neben-Gegenlinien sind ebenfalls miteinander vereint.
(LO 2.1) IN der Linie o in der ersten Gliederung sind nur 2 Linien, die durch den Punkt X voneinander getrennt sind. Es gibt das Erste und das Zweite, das Zweite ist das Andere des Ersten. Das Erste ist, was das Zweite nicht ist und umgekehrt. Beide sind einander nebenentgegengesetzt, nebengegenheitlich, andererseits ist aber die Entgegengesetztheit der beiden gegen die Linie u eine Ab-gegenheit. Die Gegenheit der beiden Glieder gegen u ist also eine andere als die Gegenheit der beiden i und e gegeneinander. Die Linie o ist IN sich beide. Man kann also nicht sagen, das Eine ist die Linie o und das Andere sind die beiden Linien i und e. sondern es ist zu sagen: Die Linie o ist IN sich sowohl das Eine als auch das Andere. Unrichtig ist aber zu sagen: Die Linie o ist beide. Daraus ergibt sich, dass die innere Gegenheit in der Linie o zwei Glieder hat. Es ist unmöglich anzunehmen, dass die innere Gegenheit nur ein Glied hätte. Dadurch dass die eine der beiden Linien i nicht ist, was die andere Linie e ist, wird von der Linie o überhaupt nichts verneint. Dadurch, dass die Linie o in sich die beiden Linien i und e ist, wird sie nicht zum Anderen, wird von ihr auch überhaupt nichts verneint. Weiterhin ist zu beachten, dass die Linie o, soweit sie ÜBER i und e ist, und erst in dieser Hinsicht eine Beziehung nach innen hat, in (LO 1) aber, AN der Or-Linie o solche Beziehungen nicht gegeben sind ( Es sei denn, man meint alle Beziehungen, die wir in (LO 1) darlegten, diese Beziehungen sind Aber AN-Beziehungen.)
(LO 2.2) Die in (LO 1.2) angeführten Begriffe der Wesenheit go und ihrer AN-Gliederung, also Wesenheiteinheit, Selbheit (LO 2.2)
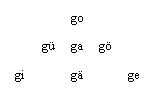
n also Wesenheiteinheit, Selbeit und Ganzheit (FIGUR 2) - erfahren bei der Gliederung der Linie o IN (LO 2) durch Linie u und die beiden Linien i und e ebenfalls eine Ab-Gegen-, Neben-Gegen- und Vereingliederung, die folgend darstellbar ist:
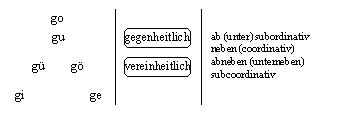
(LO 2.2.1) Die Wesenheit go, der unendlichen unbedingten Linie o erfährt in den beiden Linien i und e eine Veränderung. Die Neben-Gegen-Wesenheit der beiden Linien ist ihre Artheit (Art, Qualität). In der Linie o ist zuerst einmal eine nur zweigliedrige Artheit: der qualitative Unterschied zwischen i und e.
(LO 2.2.2) Für die beiden Nebengegen-Glieder i und e ergibt sich als Gegenheit der Selbheit (gi) die Verhaltheit, das Verhältnis. Sie stehen zueinander in einem Neben-Verhältnis, zur Linie u in einem Über-Unterverhältnis usw. AN der Linie o in (LO 1) gibt es keine Gegen-Verhältnisse, sondern die Eine Selbheit, als Or-Selbheit. i verhält sich zu e in bestimmter Weise. Das Gegenselbe steht sich als ein Anderes wechselseitig entgegen, eines ist des anderen Objekt.
(LO 2.2.3) Für die beiden Neben-Gegenglieder i und e ergibt sich als Gegenheit der Ganzheit (Or-Ganzheit der Linie o) die Teilheit. Das Gegenganze ist Teilheit. Die Linie o ist IN sich zwei und nur zwei Teile i und e. Hier ist auch die höchste Grundlage des Mengenbegriffes gegeben. Man kann nicht sagen: die Linie o ist eine Menge, weil AN der Linie überhaupt keine Teilheit ist, wohl aber die Linie o ist IN sich in dieser ersten Gegenheit zwei und nur zwei Teile (Elemente). Wir unterscheiden aber die Ab-Teilung von der Neben-Teilung. Denn die untergegenheitlichen Teile nennt man Unter-Teile, (Ab-Ant-Ganze). In der Vereinigung ergibt sich das Vereinganze der Teile, die Erste Summenbildung von i und e.
(LO 2.3). Auch hinsichtlich des Wie der Wesenheit usw. hinsichtlich der Begriffe der Formheit do usw. ergeben sich für die gegenheitlichen Linie i und e neue Bestimmungen.
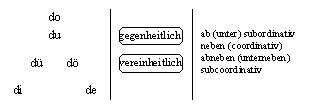
Unter (LO 1.2.1) fanden wir, dass die Linie o Satzheit do hat. Hinsichtlich der Gliederung o, i, e, usw. ergibt sich hier Gegen-Satzheit und zwar wiederum Neben-Gegensatz zwischen i und e, Ab-Gegensatzheit zwischen u und i usw. Die Gegensatzheit ist die Bestimmtheit. Bestimmtheit ist also eine Teilwesenheit an der Satzheit als Gegensatzheit. i ist also gegen e bestimmt, aber auch u bestimmt e und i usw. Diese Gegensatzheit hat selbst auch eine Form. Die Or-Satzheit ist der Form nach ganz Jaheit, ohne Neinheit, also Or-Jaheit. Diese Jaheit ist nun selbst wiederum gegliedert
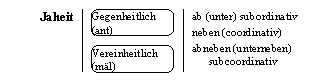
Statt der Or-Jaheit kann man sagen, die unendliche und unbedingte Positivität. Was die Gegen-Jaheit betrifft, so ist diese zugleich Gegen-Neinheit, entgegengesetzte Verneinheit (oppositive Negativität). Das Nein oder Nicht wird daher nur hier erkannt. Die Gegenneinheit ist nur an der Gegenjaheit. Dadurch dass i bestimmt ist als das Eine von zwei Wesentlichen, ist es auch zugleich bestimmt als nicht sein Anderes, sein Gegenheitliches, hier also e ist von ihm verneint. Das Nein ist also nur in einer Beziehung gegen ein Anderes. Durch die gegenseitige Teilverneinung i gegen e und umgekehrt, wird von der Unendlichen und unbedingten Linie o überhaupt nichts verneint. Hinsichtlich der Linie o ist das Nicht nicht. Die Bestimmtheit i gegen e besteht darin, dass es e ausschließt. Hier liegt die Grundlage der Wörter ja, nein, Nichts, des logischen „ist nicht“. Zu beachten sind natürlich auch die Gegenjaheiten von der Linie u gegen i bzw. e (Unter-Gegen-Verneinung oder Ab-Ant-Verneinung).Angemerkt sei, dass dieses "ist nicht" keineswegs die gleiche Bedeutung besitzt, wie die Negation "¬" in der üblichen formalen Aussagenlogik.
(LO 2.3.1) Auch die Satz-Einheit, an der Linie o, als unendliche und unbedingte Einheit der Satzheit (oder Zahleinheit), ist hier gegenheitlich zu finden als:
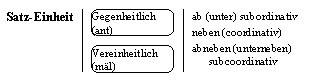
also Satz-Gegeneinheit, Satz-Vereinheit. Für die Zahl-Gegeneinheit wird das Wort Vielheit oder Mehrheit benützt. Zu beachten ist aber, dass hier noch keine Vielheit gegeben ist, die mehr als Zweiheit wäre (Gegeneinheit). Statt der Vereinzahlheit sagt man Allheit, Totalität, die aber hier nur aus zwei vereinten Gegen-Gliedern besteht. Von der Linie o gilt unbedingte und unendliche Zahleinheit, keine Vielheit, oder Mehrheit, keine Allheit. Die Linie o ist IN/UNTER sich die Vielheit und das Viele, die Allheit und das All oder die Totalität, das Universum aller Glieder in sich. Jede ursprüngliche Vielheit in der Linie o ist eine Zweiheit, und jede Vereinzahlheit ursprünglich eine vereinte Zweiheit, da der Gegensatz, oder die nach Ja und Nein bestimmte Gegenheit nur zweigliedrig ist. Die unbestimmte Vielheit oder Vielzahligkeit ist hier noch nicht gegeben, z.B. die unendliche Vielzahligkeit 1,2,3,4,5, usw.der unendlich endlichen, beideitig begrenzten Linien.
Hier liegen die Grundlagen der Zahlentheorie: die oberste Zahl ist die unendliche, unbedingte Eins (o). In ihr sind die beiden gegenheitlichen Zahlen i und e, die ebenfalls noch unendlich sind, aber gegeneinander begrenzt durch X. Sie sind nicht mehr absolut, sondern gegeneinander und gegen u relativ. Hier liegen die Grundlagen der widerspruchsfreien Mengenlehre (vgl. oben unter 3 in der Grundwissenschaft). Denn die beiden ersten „Mengen", INNEREN Elemente, von o sind i und e, beide selbst noch unendlich, aber bereits relativ.
(LO 2.3.1.1) Die Form der Satzeinheit oder Zahleinheit ist die unendliche, unbedingte Jaheit. Die Jaheit ist dann selbst wiederum gegliedert wie unter (LO 2.3). Daraus ergibt sich die Jaheit und Neinheit der Zahlheit, hier aber erst für die beiden Teile i und e. Hier findet sich die Grundlage der mathematischen Lehre von den Zahlen und Gegenzahlen (den positiven und negativen Zahlen).
(LO 2.3.1.2) Auch die Richtheit di (als Form der Selbheit in LO 1.2.1) erfährt hier weitere Bestimmung:
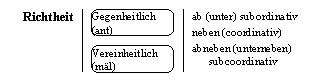
Hier wird die Gegenrichtheit erkannt. Und zwar haben i und e nebengegenheitliche Richtheit. i „fängt“ bei X an und „geht in die eine Richtung", e „fängt“ bei X an und „geht in die andere Richtung“. Weiters ist die Richtung von u nach i und e und umgekehrt von i nach u usw. zu erkennen. Anstatt Richtheit sagt man gewöhnlich Dimension, Erstreckung. Der Begriff der Richtheit ist für die Ausbildung der Mathematik wichtig, bisher aber ungenau erkannt und entwickelt. Hier ist zu unterscheiden: die Eine Ganze Richtheit (Or-Richtheit di) der Linie o; die Neben-Gegenrichtheit an den Teilganzen i und e und andererseits die Ab-Gegenrichtheit u gegen i und e usw. Hier hat der Begriff der Richtheit noch nichts mit Zeit und Bewegung zu tun. (In der Umgangssprache wird Richtung ausgedrückt durch: hin und her, auf und ab, hinüber und herüber.)
(LO 2.3.1.3) Auch die eine selbe ganze Fassheit de, als Form der Ganzheit erfährt hier Bestimmung.
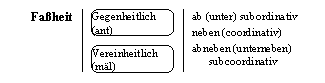
Die Linie o hat „ungeteilte“ ganze Fassheit (Or-Fassheit), die beiden inneren Teile i und e haben Neben-Gegenfassheit, u hat gegen i und e Ab-Gegen-Fassheit, schließlich erkennen wir alle Vereinfassheiten. Auch hier kann man sagen, dass die Linie o ganze Fass-Jaheit hat, dass aber von i und e neben-wechselseitig Fassjaheit und Fassneinheit gilt. Denn i fasst das, was e nicht fasst und umgekehrt. Daraus ergibt sich das In-Sein und Außensein. e ist außer i und i ist außer e.
(LO 2.3.1.3.1) An dieser Stelle müssen wir noch genauer fragen: Wie ist die FORM dieses In-und Außensein? Die Form dieses einander In- und Außenseins ist die Grenzheit. Das sieht man leicht indem man sagt: X ist die Grenze von i und e. Dort wo die Inbefassung von i aufhört, an der Grenze X, da fängt die Inbefassung von e an. Grenzheit, Grenze ist also die Form des Gegenfassigen. Es ist also deutlich, daß An der Linie o keine Grenze ist, sondern dass erst in der ersten In-Teilung derselben, an i und e die Grenzheit als X gegeben und erkannt wird. i und e haben daher eine gemeinsame Grenze. Die Grenze X ist weder i noch e, sie ist ihre gemeinsame Grenze.
(LO 2.3.1.3.2) Fragen wir nun, was ist IN dem, was da ingefasst, eingefasst wird. Der Inhalt des Infassigen wird als groß oder Großheit bezeichnet. Damit Größe da sein kann, muß etwas innerhalb bestimmter Grenzheit bejahig befasst sein.
Betrachten wir das inbegrenzte Große, so erscheint die Grenze desselben als dessen Ende, als Endheit, oder umgekehrt als Anfang. Hier erkennen wir die Begriffe Endheit, Endlichkeit, und Un-Endlichkeit. Die Endlichkeit ist eine Bestimmung der Grenzheit, die Grenzheit wieder eine Bestimmung der Gegenfaßheit an der Großheit und mithin daher eine Bestimmung der Ganzheit als Gegenganzheit. Daraus zeigt sich, daß der Begriff der Endlichkeit nicht richtig gefunden wird, ohne die Begriffe der einen, selben, ganzen Richtheit (di), der Faßheit (de) und der Ganzheit (ge). Von der Linie o kann nicht gesagt werden, dass sie an sich endlich ist, oder Grenze hat, sondern nur, dass sie ganz (organz) ist und in ihrer Ganzheit auch alle Endlichkeit und Grenzheit des Gegenganzen in sich befasst.
(LO 3) In der dritten Erkenntnis fassen wir zusammen, was bisher erkannt wurde, also was die Linie o AN und IN sich ist.
Es gilt: Die Linie o ist AN sich und IN sich ein Organismus, heute würde man auch sagen eine Struktur. Die An-Gliederung und die Ingliederung wurden unter (LO 1 und LO 2) dargestellt.
(LO 3.1) Dieser bisher dargestellte Gliedbau (Organismus, Struktur) der Linie o ist „voll"ständig. Hier ergibt sich die erste Erkenntnis hinsichtlich der Begriffe ALL-heit, Totalitiät. Diese Allheit ist aber nicht irgendeine unbestimmte verschwommene, sondern die Gliederung ist deutlich bestimmt.
(LO 3.1.1) Aus dieser Gliederung ergibt sich auch, dass die Gegenheit nur zweigliedrig ist, denn es gibt keine anderen inneren Glieder der Linie o als i und e, und deren Jaheit und Gegenjaheit (Neinheit). Natürlich gibt es auch „noch endlichere“ Linie in o, aber das wird sich erst im folgenden ergeben.
(LO 3.1.2) Für diesen gegliederten Organismus gilt auch, dass alle hier entwickelten Begriffe aufeinander anzuwenden sind. So hat z.B. die Ganzheit (ge) auch Wesenheit, Selbheit und Gegenselbheit, also Verhaltheit, Ganzheit, sie hat eine bestimmte Form oder ist in bestimmter Grenzheit, gegenüber der Selbheit, usw. Wenn also derjenige Teil der Mathematik der sich mit Größen beschäftigt, voll ausgebildet werden soll, dann muss an der unendlichen und nach innen absoluten Ganzheit (hier Or-Ganzheit der Linie o) begonnen werden, was bisher nicht geschehen ist. Ein anderer Zweig der Mathematik ergibt sich aber aus der Selbheit (gi) und Gegenselbheit (Verhaltheit, Verhältnis), wenn dieser Begriff nach allen anderen Begriffen durchbestimmt wird (z.B. die Lehre von den Proportionen usw.).Diese Sätze, wie auch alle anderen, gelten natürlich nur dann, wenn, wie wir für die Karidonier annehmen, die Welt nur aus einer unendlich langen Linie besteht.
(LO 4.1) Jeder der beiden Teile i und e in der Linie o (und auch die Vereinigung der beiden) ist selbst wiederum AN und IN sich Struktur, Organismus gemäß der Struktur (LO 1-3), also hat selbst wieder eine der Linie o ähnliche Struktur.
Es gilt: Wie sich die Linie o zu u, i und e und deren Gegenheiten und Vereinheiten verhält, so verhält sich wiederum i zu dem, was es IN sich ist, usw...
(LO 4.1.1) Die Form dieses Ähnlichkeitsverhältnisses ist die Stufung, Abstufung (Stufheit), wobei sich das unter (LO 2.3.1.3) dargestellte Insein und Außensein nach innen fortsetzt.
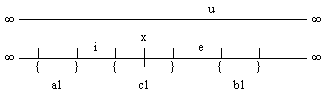
(LO 4.1.2) Fahren wir nun mit der inneren Gliederung von i und e und deren Vereinigung fort, so ergeben sich in i unendlich viele Linien gemäß a1, in e unendlich viele Linien wie b1 und in der Vereinigung von i und e unendlich viele Linien wie c1. Analysieren wir die Ganzheit, Großheit, Grenzheit und Endlichkeit (LO 2.3) dieser Linien a1, b1, c1, so fällt auf, dass sie zum Unterschied von den Linien i und e „auf beiden Seiten endlich sind“, beidseitig begrenzt sind, sie sind also ganz endlich, oder unendlich-endlich. i und e sind also in sich unendlich endliche Glieder. Ein solches Glied der Linie o nennt man nun individuell, partikular. Wichtig ist zu erkennen, dass sich die Art der Endlichkeit von i einerseits und a1 andererseits unterscheiden. Die Glieder i und z.B. a1 gehören verschiedenen Stufen der Grenzheit, Begrenzung, verschiedenen Grenzheitsstufen an. Die Erkenntnis dieses Unterschiedes in der Grenzheitsstufe von Elementen in einem unendlichen Ganzen ist entscheidend, um die Antinomien der bisherigen Mengenlehre zu vermeiden.
(LO 4.1.3) Frage: Hat diese Gliederung der Linie o nach innen ein Ende? Ja! Und zwar: Die Linie o ist beidseitig unendlich. Genauer gesagt: sie hat unendliche Or-Richtheit. Die Linien i und e gehören noch der gleichen Grenzheitsstufe an, sie sind auch noch unendlich, haben aber gegeneinander die Grenze X, sind nur mehr einseitig unendlich (endlich-unendlich). Die Glieder a1, b1, c1, sind beidseitig endlich, sind also in der Stufung der Grenzheit noch weiter innen. Teilt man jedoch a1 weiter in 3 Teile, so erhält man der Artheit nach keinen neuen Typ von Linien, weil 1/3 von a1 wiederum eine beidseitig begrenzte Linie ist. Die Grenzheitsstufe der Linientypen a1, b1, usw. ist also die letzte innere Grenzheitsstufe der Linie o. Hier ist das Ende der Endlichkeit (unterste Grenzheit; Grenze der Grenze).
(LO 4.1.4) An diesen unendlich endlichen Gliedern (Elementen) in/unter o ist nun in zweifacher Hinsicht Unendlichkeit.
1. In den Gliedern i, e und ihrer Vereinigung gibt es jeweils unendlich viele unendlich endliche Elemente (a1..,b1..,c1..).
2. Jedes unendlich endliche Glied a1, usw. ist selbst weiter unendlich teilbar und bestimmbar.
(LO 4.1.5) Das Endliche, Bestimmte oder Individuelle jeder Art und Stufe ist also nicht isoliert, gleichsam losgetrennt von dem, was neben und außer, bzw. über ihm ist (z.B. a1 von o), es ist in/unter seinem höheren Ganzen und mit ihm vereint, wie auch mit den Nebengliedern.
(LO 4.1.5.1) Aus den bisherigen inneren Gliederungen der Linie o ergeben sich nun folgende weitere axiomatische Folgerungen:
Die Stufung der Grenzheit und die Großheit sind nun mit der Selbheit und der Gegen-Selbheit, also der Verhaltheit verbunden (vereint). Die allgemeine Lehre von der Verhaltheit (von den Verhältnissen) begreift in sich Verhältnis, Verhältnisgleichheit (Analogie, Proportion), Verhältnis-Ungleichheit (Disproportion), Verhältnisreihe (Progression), nach gleichen oder ungleichen Verhältnissen; die ersten Reihen sind Gleichverhaltreihen oder Verhaltstufreihen (Potenzreihen). Hinsichtlich der Verhältnisgleichheit zeigt die reine Selbheitlehre zwei Grundoperationen: zu einen gegebenen Musterverhalte und einem gegebenen Hinterglied das gleichverhaltige Vorderglied zu finden; oder: zu einem gegebenen Vorderglied das gleichverhaltige Hinterglied zu finden. Auf die Ganzheit angewandt sind dies das Multiplizieren (Vorgliedbilden) und Dividieren (Nachgliedbilden).
(LO 4.1.5.2) Ferner entsteht hier das grenzheitsstufliche Verhältnis, also das Verhältnis von Ganzen, die zu verschiedenen Stufen der Grenzheit gehören (z.B. Linie i zu b1 usw.), als auch grenzheitsstufliche Verhältnisgleichheit, Verhältnis-Ungleichheit und Verhältnisreihe. Auch die analogen Axiome hinsichtlich der Verhältnisse von solchen Ganzen, die innerhalb einer und der selben Stufe der Grenzheit enthalten sind.
(LO 4.1.5.3) Hier ergeben sich nun zwei in der bisherigen Mathematik und Mengenlehre nicht beachtete wichtige Folgerungen.:
Jede selbganzwesenliche also unendliche und ansich unbedingte Einheit jeder Art und Stufe (hier die Linie o) ist in/unter sich unendlich viele Einheiten der nächstniederen Grenzheitsstufe (hier a1, b1, usw.; beachte i und e sind von der gleichen Grenzheitsstufe, wie die Linie o selbst!!) und so ferner bis zur untersten Grundstufe (die hier mit der beidseitig begrenzten Linie gegeben ist). Diese Grundstufe ist nach allen Richtheiten (Strecken, Dimensionen) endlich, und besteht selbst wiederum aus unendlich vielen Einheiten dieser untersten Stufe (a1 kann man weiter unendlich teilen). Jede jedstufige unendliche Einheit besteht aus unendlich vielen unendlich endlichen Einheiten der untersten Stufe.
(LO 4.1.5.4) Hier zeigt sich auch der Grundbegriff der unendlichen Vielheit und darin der unbestimmten Vielheit oder der unendlichen und darin der unbestimmten Zahlheit, wobei ein Unendlich-Ganzes des Gleichartigen (hier der Linie o) vorausgesetzt wird, worin innerhalb vollendet bestimmter Grenze, die endliche Einheit der Unendlichkeit des Ganzen wegen, willkürlich angenommen wird.
(LO 4.1.5.4.1) Hierauf beruht die mathematische Voraussetzung, dass die Zahlenreihe 1,2,3,.. und so fort unendlich ist und dass auch wiederum an jeder Zahl die ganze Zahlenreihe darstellbar ist, durch Zweiteilung, Dreiteilung, Vierteilung usw. ohne Ende. Diese hier bewiesene, unendliche und unbestimmte Vielheit, als Grundaxiom der allgemeinen Zahlheitlehre (Arithmetik und Analysis) ist wiederum eine doppelte. Einmal die unendliche Artvielheit oder Artzahlheit von Einheiten, welche artverschieden sind, oder die Zahlheit der diskreten Zahlen. (Dies ergibt sich aus dem obigen Satz LO 4.1.5.3)
Hier zeigt sich aber zum anderen auch die unendliche stetige Zahlheit, oder Stetzahlheit an Einheiten, welche in ihrem stetigen Ganzen selbst binnen bestimmbarer Grenze stetig und unendlich teilbar sind. Dies ergibt sich aus: Alles Stetige, Wesenheitgleiche ist in sich unendlich bestimmbar und teilbar. Die Lehre von der Artzahlheit ist übrigens von der Stetzahlheit zu unterscheiden.
(LO 4.1.5.4.2) Im weiteren ergibt sich hieraus das Axiom der stetigen Großheit, und der stetigen Größen: unendliche Teilbarkeit, unendliche Vielmaligkeit jedes Endlichen in seinem Unendlichen der nächsthöheren Stufe; die Gegenrichtheit hinsichtlich der Richtheit (Strecke, Dimension), das ist die Lehre von den gegenrichtheitlichen Größen, den positiven und negativen Größen. Ferner die Axiome der Stetgroßheit und der Stetgrößen nach der SELBHEIT und der VERHALTHEIT. Denn es ist eine Größe entweder eine selbheitliche Größe (Selbgröße; absolute Größe) oder eine verhaltliche Größe (gegenselbheitliche Größe), Verhaltgröße, relative Größe, welche hinsichtlich der mit ihr verglichenen Größe groß oder klein ist. Die Größeverhaltheit ist selbst wiederum eine der Gegenselbheit (ein arithmetisches Verhältnis oder Restverhältnis) oder eine der Vereinselbheit, darunter auch der Vielheit (ein sogenanntes geometrisches Verhältnis). Das gleiche gilt von der Verhaltheit hinsichtlich der Stetgroßheit.
(LO 4.1.5.4.3) Alle Größen der selben Grenzheitsstufe (hier die Linien a1, bn, c5.. usw.) stehen zu einer jeden beliebigen Größe der gleichen Grenzheitsstufe in einem bestimmten Größenverhältnis, welche letztere, wenn sie das bestimmende Glied jedes Verhältnisses ist, die Grundeinheit oder absolute Einheit genannt wird. (z. B. Verhältnis 1 zu 3 oder 3 zu 1 usw.) Jedes Verhältnis der Ungleichheit ist diesseits oder jenseits des Verhältnisses 1..1, und zwar entweder eines der größeren Ungleichheit z.B. 3 zu 1 oder der kleineren Ungleichheit z.B. 1 zu 3. [vgl. auch vorne unter (LO 4.1.5.1) die Grundoperationen des Multiplizierens und Dividierens].
(LO 4.1.5.4.4) Rein nach der Grundwesenheit der Selbheit sind an dem Stetgroßen folgende Operationen gegeben: Addition und Subtraktion, indem entweder aus den Teilen das Teilganze oder aus einem oder mehreren Teilen des Teilganzen der andere Teil (der Rest) bestimmt wird.
(LO 4.1.5.4.5) Die Verhaltheit der Stetgrößen ist selbst artgegenheitlich (qualitativ) verschieden. Denn sie ist, wie alles Endliche, Bestimmte selbst nach Unendlichkeit und Endlichkeit bestimmt. Daher ist jedes geometrische Verhältnis zweier Stetgrößen entweder ein unendliches oder ein endliches. Ersteres, wenn keine gemeinsame Einheit diese beide Glieder misst, das Verhältnis also unzahlig oder unwechselmessbar (irrational und inkommensurabel) ist, letzteres, wenn beide Glieder von derselben Einheit gemessen werden, das Verhältnis also zahlig und wechselmessbar ist.
(LO 4.1.5.5) Für die Begründung einer antinomienfreien Mengenlehre ist folgender Satz fundamental: Ein jedes Glied, ein jeder Teil einer bestimmten Grenzheitsstufe hat zu dem ihm übergeordneten Ganzen der nächsthöheren Grenzheitsstufe überhaupt kein Verhältnis der Großheit oder endlichen Vielheit. Man kann also nicht sagen: Die Linie o oder i sind größer als a1, oder b1. Wir haben zu beachten: Es gibt die Zahl, „Or-Größe“ Linie o, dann die beiden In-Größen (In-Zahlen) i und e, und schließlich die unendlich endlichen Größen wie a1, b5, c7 usw. (Zur Überwindung der Antinomien der Mengenlehre siehe oben die Grundwissenschaft unter 3.).
Wo gibt es in diesem System der geraden Linie ein WERDEN? Oder fehlt dieses in der Axiomatik der geraden Linie:
(LO 5) Das Werden
Die Linien i und e sind jede in ihrer Art unendlich, aber in ihrer Unendlichkeit im Innern unendlich bestimmt, das ist vollendet endlich und zwar insbesondere als diese beiden Teile in o; das ist, sie sind in sich eine unendliche Zahl vollendet endlicher, nach allen Wesenheiten bestimmter, Einzellinien, a1, a2...; b1, b2 ...usw.; (LO 4.1.2 ), denen wiederum alle Kategorien auf vollendet endliche Weise zukommen, und die in, mit und durcheinander zugleich in ihrem unendlichen Ganzen, von i und e sind.
Da i und e in o, durch o, nach ihrer ganzen Wesenheit vereint sind, so sind sie es auch, sofern sie die beiden entgegenstehenden Reihen vollendet endlicher Linien in sich sind und enthalten; so dass diese beiden Reihen vereint sind. Es sind dies die unendlich vielen Linien, die sowohl auf i als auch auf e liegen. Darin gibt es wieder einen Typ unendlich vieler Linien, deren Abstand auf i und e gleich lang ist und die wir als die Gruppe d1, d2, d3, usw. bezeichnen wollen.
Jede dieser Arten endlicher Linien a, b, c oder d kann sich nun in ihrer Länge verändern. Sie kann länger oder kürzer werden, diese Verkürzung und Verlängerung kann auch rhythmisch und zyklisch erfolgen. Dieser Zyklus läuft innerhalb der Linie in einer Dimension ab. Man kann aber diesen Zyklus auch in einer zweidimensionalen Kurve darstellen. Eine solche Darstellung ist aber für die Karidonier, welche nur die Logik der eindimensionalen Linie kennen, unmöglich!
Beispiel einer zyklischen Veränderung einer Linie a1, die für die Karidonier aber unverständlich wäre, da sie nur in einer Dimension leben[37]:
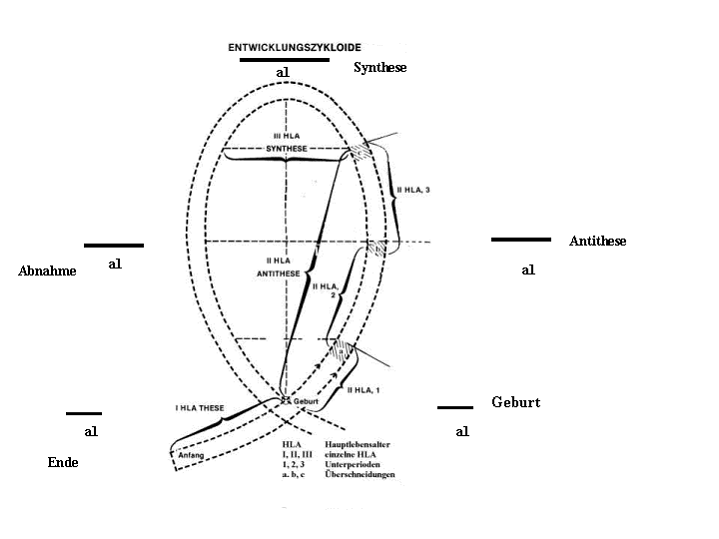
Ausgehend vom Anfang erfolgt die "Geburt" der Linie, sie entwickelt sich in ihrer inneren Differenzierung der Antithese, erreicht ihren Höhepunkt in der Synthese und beginnt dann abzunehmen und geht über in ihr Ende, welches der Beginn eines neuen Anfangs ist, usw.
Zu beachten ist aber, dass sich die Linien o, i und e nicht verändern können, weil sie unendlich sind. Sie können nicht kürzer oder länger werden. Anderseits können Linien der Typen a, b, c und d nie unendlich lange werden. Sie bleiben immer unendlich-endlich, auch wenn man annimmt, dass sie sich unentwegt ausdehnen!
Der vollendet endlichen Zustände aber der endlichen Linie z.B. a1 sind unendlich viele, weil auch die Wesenheit des Endlichen, als solche, wiederum unendlich ist (siehe LO 4.1.4); und nur alle diese Zustände des Länger- und Kürzerwerdens, alle zugleich sind die ganze, vollendet endliche Wesenheit dieser Linie, deren Zustände sie sind. Gleichwohl schließen sich alle diese vollendet endlichen Zustände an demselben Wesenlichen wechselseitig aus, da sie mit unendlicher Bestimmtheit alles Andere nicht sind. Also ist die vollendet endliche Linie z.B. a1 beides zugleich, das ist, alle ihre Zustände, und doch nur auf einmal ein jeder von diesen Zuständen einzeln; das ist: sie ist in steter Änderung nach der Form der Zeit, sie ist ein stetiges Werden.
Also sind die unendlich-endlichen Linien (a1 usw.) selbst vor und über ihrem Werden in der Zeit; sie selbst entstehen und vergehen nicht, sondern nur ihre unendlich endlichen bestimmten Zustände. Auch das Ändern selbst ist unänderlich, und bleibend in der Zeit. Auch die Zeit ist unendlich, unentstanden, und ihr stetig fortschreitender Verflusspunkt ist einer für die Linie o und für alle Linien in o. Alles in der Zeit Werdende ist die Wesenheit der Linie o und aller Linien in ihr selbst, wie sie in sich als vollendete Endlichkeit ist, und sich offenbart. Alles Individuelle eines jeden Verflusspunktes (Momentes) ist eine eigentümliche und einzige Darstellung der ganzen Wesenheit der Linie o in in ihren Linien in sich; oder jeder Moment des Geschehens (der Geschichte) ist einzig, von unbedingtem göttlichen Inhalt und Werte. Die Linie o selbst als das Eine, selbe, ganze ändert sich nicht, und ist in keiner Hinsicht zeitlich, oder in der Zeit; denn in keiner Hinsicht ist die Linie o an sich Endlichkeit, noch ist eine Grenze um die Linie o (wir nähmen ja an, dass es außer ihr nichts gibt!); und die vollendete zeitlichwerdende Endlichkeit ist nur an dem Wesenlichen in der Linie o.
Die Linie o selbst als Urlinie u ( LO 2) ist der Eine, selbe, ganze Grund und die Ursache des Einen stetändernden Werdens in ihr: und, infolge der Ähnlichkeit, ist auch jede endliche Linie in o in dem Gebiete ihrer eigenen Wesenheit nächster Grund und Ursache ihres ganzen stetändernden Werdens alles Individuellen in ihr; aber nur als untergeordneter endlicher Mitgrund und Mitursache, in Abhängigkeit von der Linie o als dem Einen Grunde und der Einen Ursache der Wesenheit jeder endlichen Linie.
Es ergibt sich daher bezüglich der Seinheit folgende Gliederung:
jo eine, selbe, ganze Seinheit (Orseinheit)
ju Urseinheit
ji Ewigseinheit
je Zeitlichseinheit (nur hier gibt es Werden und Veränderung).
Hierbei sind alle Gegensätze (z. B. zwischen ju und je oder ji und je) sowie alle Vereinigungen zu beachten.
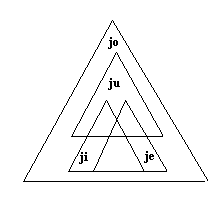
Wir wollen nun im weiteren annehmen, dass es im Volk der Karidonier einen karidonischen Physiker Weizsäcker gibt, der seine Ur-Theorie vorlegt. Der logische Atomismus der Ur-Theorie wird vom karidonischen Weizsäcker derart formuliert, dass eine Ur-Alternative als eine beidseitig begrenzte, also endliche Linie a1 IN der Teillinie e der oben dargestellten unendlich langen Linie LO erscheint. Dies ergibt sich aus dem offenen Finitismus (that with passing of time there are more and more alternatives available to divie R into smaller intervals).In dieser beidseitig begrenzten, endlichen Linie a1 lassen sich die oben vom Lyre erwähnten philosophischen Strukturen der vollständigen Binarität der Ure, sowie die mathematische Strukturen, wie HILBERTraum, Vektor, Tensorprodukt, Operator usw. einerseits, und die physikalische Begrifflichkeit wie Objekt (System) Zusammensetzung der Objekte 1 und 2, Messgröße, Zeitentwicklung usw., zwar nicht völlig aber in dem von uns hier intendierten Ausmaß ausreichend integrieren[38].
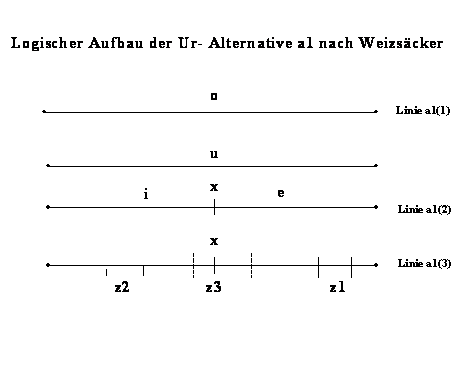
Sehr illustrativ ist die Gliederung in Kreisen und deren Beziehung nach der untenstehenden Grafik. Hier werden die Relationen an und in der Linie a1 (dem Ur) sehr deutlich. Natürlich gibt es dieses Schema in der Welt der Karidonier nicht, es sei denn wir argumentieren wie die Stringtheoretiker, die annehmen, dass die Zwei- und Dreidimensionalität als Zusatzdimensionen des Raumes auch in der Linie der Karidonier in jedem Punkt als winzige Zylinder aufgerollt enthalten sind.
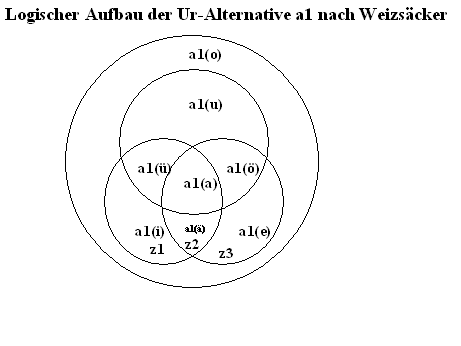
Will man alle vorne dargelegten Elemente und Beziehungen der AQT in der Linie adäquat integrieren, dann ist die kategoriale (ontische, logische, mathematische) Position der Linie a1 (eines Ur) in der unendlich langen Linie LO, die wir oben entwickelten, zu bestimmen. Es wird sich dabei zeigen, dass in dieser Linie a1 (einem Ur) sich wesentlich mehr an apriorischer Kategorialität befindet, als Weizsäcker und Lyre erkannt haben. Die Begriffe der beiden, wie Unterscheidbarkeit und Zeitlichkeit, binäre Alternative, Ganzheit, Teilheit, offener Finitismus, Endlichkeit, Unendlichkeit, Potentialität, Symmetrie usw. finden sich auch im Modell der Karidonier, aber in anderen Zusammenhängen, die aber in der Lage sind, die derzeitigen Probleme der AQT in einen neuen Konnex zu stellen.
(La1 1) Was die endlich lange, gerade Linie a1 (das Ur) AN sich ist
a1
Wir bestimmen die Linie a1 nunmehr nach den bereits oben für Gott ( vgl. 3 Grundwissenschaft) und für die Linie LO bei den Karidoniern deduzierten Kategorien. Denn nach der Grundwissenschaft gelten alle Kategorien für alles In Gott auf gleiche Weise. "AN" einem Wesentlichen ist, was von ihm ganz, durchaus gilt. "IN" einem Wesentlichen ist dasjenige Wesentliche, welches von ersterem ein Teil ist, und Gleichartiges des ersteren außer sich hat. Betrachtet wird bei der Linie a1 in (La1 1), was sie AN sich ist, also noch nicht, inwieweit sie vielleicht auch Teile usw. hat (La1 1.1). AN der Linie o wird die Wesenheit go (in der FIGUR 2 go, gu, gi, ge usw.) erkannt.
Es ist interessant, dass Lyre zwar von einer binären Alternative ausgeht, also von einer Zweiheit. Trotzdem finden sich bei ihm Hinweise auf eine darüber gelegene Ebene, die er, sich auf eine Bezeichnung Dirk Graudenz` beziehend, als das "logische Vakuum" bezeichnet. "Ferner soll mit |Ω> = |0,0> das "logische Vakuum"bezeichnet werden, also derjenige hypothetische Zustand, der keine Ure bzw. Information enthält" (Ly98, S. 78). Das "logische Vakuum" wird vom LORENTZ-Vakuum, das keine Teilchen enthält unterschieden. Unter (Ly 78, S. 145) wird das logische Vakuum auch als "Informationsvakuum" bezeichnet. "Wir können damit auch zum Ausdruck bringen, dass dieser Zustand lediglich formalen Charakter besitzt, um Berechnungen im Rahmen einer Viel-Ur-Theorie durchzuführen. Denn wie wir schon häufiger betont haben, ist im Informationsbegegriff die Notwendigkeit sematischer Ebenen enthalten, ein Informationsvakuum kann daher niemals als Zustand in der Welt vorkommen: Nicht- oder Null-Information ist eben keine Information für niemand, da ein kosmisches Informationsvakuum als Weltzustand nicht einmal einen Beobachter oder Subjekt enthielte, für den diese Null-Information keine Information wäre. Die Annahme also, dass ein solcher Zustand in der Welt vorkäme, oder dass das Universum einst von ihm ausgegangen wäre, macht noch weniger Sinn als die ohnehin sinnlose Annahme, dass Zustände mit einem oder nur wenigen Uren jemals vorgekommen wären."
Kritik: Lyre nimmt daher an, dass das logische Vakuum nur als formaler Begriff eingeführt wird, um Berechnungen durchführen zu können. Eine ontische, oder sematische Relevanz wird dem Begriff nicht zugesprochen. Hier zeigt sich wieder, dass der Umgang mit dem ( für Lyre eben "leeren") Einen, das über der Binärität liegt, und IN unter dem erst die Zweiheit kategorial ist und erkannt werden muß, kategorial nicht ausreichend gründlich, und deduktiv mangelhaft ist.
An der Wesenheit die Einheit. Dass die Linie a1 im weiteren (La1 1.2) und (La1 1.3) auch Zweiheit, Mehrheit, Vielheit, Vereinheit von mehreren Teilen usw. ist und hat, wird hier noch nicht erkannt. Die Einheit, die hier erkannt wird, ist eine ungegliederte, allen Teilheiten und Vielheiten "IN" der Linie übergeordnete Einheit, die wir der Genauigkeit wegen als OrEinheit (go) bezeichnen können.Wie wir schon oben gezeigt haben, erkennt Lyre in seiner philosophischen Begründung der Ure die über der Binarität gelegene Einheit und ihre Kategorien nicht! Es gibt also nicht eine iterative Vermehrung und Stufung der semantischen Ebenen der Binarität der Ur-Alternativen, wie Lyre meint, also die Zweiheit, sondern es gibt sehr wohl einen Startpunkt, die Or-Wesenheit und Or-Einheit eines jeden Urs. Alle (Linien a1 usw.), alle Ure befinden sich aber in der unendlichen Linie e ( der Unendlichkeit der Natur), die ihrerseits wiederum in In-Glied in der Linie o (in Gott) ist.
(La1 1.2) AN der Wesenheiteinheit go der Linie a1 werden die Selbheit (gi) und die Ganzheit (ge) erkannt. Die Selbheit bezeichnet man üblicherweise als innere Absolutheit und die Ganzheit als innere Unendlichkeit. Die Linie a1 ist AN sich Eine, und nach innen absolut und unendlich. Diesen Begriff erkennt Lyre für das Ur nicht. Das Wort "Ganzheit" meint hier nicht eine Summe von Elementen, die zu einer Ganzheit zusammengefasst sind. (Diese finden sich erst in (La1 1.2 und La1 1.3.) Die Linie a1 ist IN sich auch Summen von Teilen usw. Aber als Linie a1 ist diese Verein–Ganzheit von Teilen noch nicht ersichtlich oder erkennbar. Diese Or–Ganzeit oder unendliche Ganzheit ist ein "über"geordneter Begriff. Wesenheiteinheit (go), Selbheit (gi) und Ganzheit (go) stehen in der Gliederung der FIGUR 2 zueinander. Diesen Begriff der Ganzheit erkennt Lyre für das Ur nicht.
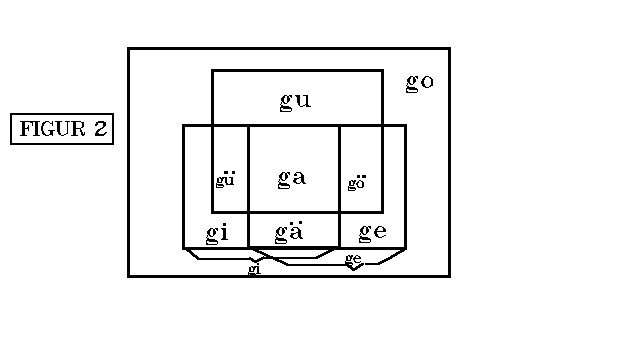
(La1 1.2.1) Wie ist die Wesenheit-Einheit (go) und wie sind im weiteren gi, ge und alle Verbindungen der Linie a1 in FIGUR 2? Die FORM der Wesenheit go ist Satzheit do. Die Linie a1 ist das eine Gesetzte, Positive. Hier An der Linie a1 gibt es noch keine Negation, keinen Gegen–Satz usw. Weizsäcker und Lyre erkennen nicht, dass vor und "über" der Ur-Alternative, also der potentiellen Binärität kategorial AN dem Ur orheitliche, noch "ungeteilte" ontische, kategoriale und semantische Ebenen bestehen. Wir bezeichnen diese Satzheit als Or-Satzheit. Die Form der Selbheit gi ist Richtheit di oder Bezugheit (Relationalität), aber auch hier gibt es nur die Eine Richtheit ohne noch ein Hin und Her oder sonstige einzelne Richtungen zu unterscheiden, also Or-Richtheit. Auch hinsichtlich der später zu erkennenden Symmetrie der Binärität, Ja-Nein Opposition zeigt sich hier die übergeordnete ungegenheitliche Richtheit und Fassheit, die Lyre nicht erkennt. Die Form der Ganzheit ge ist Fassheit de ("um"fangen, befassen). AN der Linie a1, (dem Ur) wird noch nicht ein Um-fassen endlicher Ganzer erkannt, sondern dieses Fassen der Or-Ganzheit hat keine weitere innere Endlichkeit (FIGUR 3).

Die Linie a1 ist IN sich gemäß der obigen Zeichnung Gegenlinie und Vereinlinie nach INNEN, so dass die Linie a1 (das Ur) IN sich zwei ihr als a1 untergeordnete und IN ihr selbst als ganzer selber Linie nebengegenheitliche Linien i und e ist, welche AN sich gleichwesentlich und sich darin neben-gegenheitlich sind, dass die eine von beiden ist, was die andere nicht ist und umgekehrt. Die Linie a1 aber, sofern sie ÜBER sich selbst als die beiden nebengegenheitlichen entgegengesetzten Linien i und e ist, ist die Urlinie u, von i und e unterschieden, und insoweit ist die Linie a1 in sich eine doppelgliedrige AB-Gegenheit. Die Linie ist als u auch vereint mit den beiden Gegenlinien i und e. Die beiden Neben-Gegenlinien sind ebenfalls miteinander vereint. Diese Ableitung ist für die Theorie der Ure Weizsäckers, aber darüber hinaus für die gesamte Quantentheorie und die Grundlagen der Physik und Naturphilosphie von entscheidender Bedeutung.
Wir fügen daher hier nochmals das anschauliche Schema in Kreisen ein:
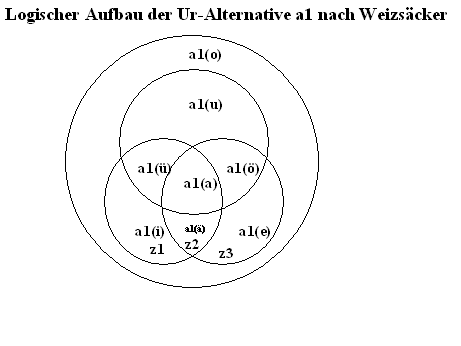
Wie die obige Zeichnung nachweist, sind wir hier, zum Unterschied von der ersten Teilung der unendlich langen Linie in die beiden Linien i und e unter (LO 2) mit einem wichtigen ontischen, semantischen und auch mathematischen Unterschied konfrontiert, der beachtet werden muß. Während unter (LO 2) die beiden Hälften i und e (als IN-Teile in unter o) vom Teilungspunkt X aus, beide gleich lang, nämlich unendlich lange sind, ist unter (La1 2) eine Teilung der Linie La1 in sich durch einen Punkt X unendlich vielmal möglich, wobei die beiden IN-Teile i und e jeweils unterschiedlich lang sind. Es gibt daher die von uns angeführten Varianten (La1, 2.1), (La1 2.2)....(La1, 2.¥). Eine Varainte ist hierbei ausgezeichnet, nämlich jene, bei der X gerade in der Mitte ist und i und e daher gleich lang sind (La1, 2.1). Diese kategorialen Feinheiten werden im folgenden nicht immer gesondert erwähnt, müssen aber beachtet werden. Es kann sich hier auch die Frage ergeben: Ist bei der unendlichen Variationsbreite der ersten Teilung diese Deduktion kategorial nicht sehr mutwillig? Könnte man nicht in der ersten Teilung gleich eine Dreiteilung, Fünfteilung oder Tausendteilung der Linie a1 durchführen. Zweifelsohne besitzt die Zweiteilung gegenüber diesen Verfahren eine kategoriale Privilegierung und auch einen "ontischen Vorrang". Für die in der modernen Physik, vor allem auch von Lyre betonten Symmetriephänomene in der Quantenphysik liegen hier wichtige, bisher nicht beachtete Akzente.
(La1 2.1) IN der Linie a1 (den Ur) in der ersten Gliederung sind nur 2 Linien, die durch den Punkt X voneinander getrennt sind. Es gibt das Erste und das Zweite, das Zweite ist das Andere des Ersten. Das Erste ist, was das Zweite nicht ist und umgekehrt. Beide sind einander nebenentgegengesetzt, nebengegenheitlich, andererseits ist aber die Entgegengesetztheit der beiden gegen die Linie u eine Ab-gegenheit. Die Gegenheit der beiden Glieder gegen u ist also eine andere als die Gegenheit der beiden i und e gegeneinander. Die Linie a1 ist IN sich beide. Man kann also nicht sagen, das Eine ist die Linie a1 und das Andere sind die beiden Linien i und e, sondern es ist zu sagen: Die Linie a1 ist In sich sowohl das Eine als auch das Andere. Unrichtig ist aber zu sagen: Die Linie a1 ist beide. Daraus ergibt sich, dass die innere Gegenheit in der Linie a1 zwei Glieder hat. Es ist unmöglich anzunehmen, dass die innere Gegenheit nur ein Glied hätte. Dadurch dass die eine der beiden Linien i nicht ist, was die andere Linie e ist, wird von der Linie a1 überhaupt nichts verneint. Dadurch, dass die Linie a1 in sich die beiden Linien i und e ist, wird sie nicht zum Anderen, wird von ihr auch überhaupt nichts verneint. Weiterhin ist zu beachten, dass die Linie a1, soweit sie ÜBER i und e ist, und erst in dieser Hinsicht eine Beziehung nach innen hat, in (La1 1) aber, AN der Or-Linie a1 solche Beziehungen nicht gegeben sind ( Es sei denn, man meint alle Beziehungen, die wir in (La1 1) darlegten, diese Beziehungen sind Aber AN-Beziehungen.).
(La1 2.2) Die in (La1 1.2) angeführten Begriffe der Wesenheit go und ihrer AN-Gliederung, also Wesenheiteinheit, Selbheit (La1 2.2)
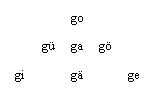
also Wesenheiteinheit, Selbeit und Ganzheit (FIGUR 2) - erfahren bei der Gliederung der Linie a1 IN (La1 2) durch Linie u und die beiden Linien i und e ebenfalls eine Ab-Gegen-, Neben-Gegen- und Vereingliederung, die folgend darstellbar ist:
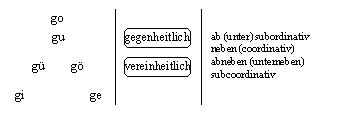
(La1 2.2.1) Die Wesenheit go, der Linie a1 (des Ur)erfährt in den beiden Linien i und e eine Veränderung. Die Neben-Gegen-Wesenheit der beiden Linien ist ihre Artheit (Art, Qualität). In der Linie a1 ist zuerst einmal eine nur zweigliedrige Artheit: der qualitative Unterschied zwischen i und e. Hier liegen also die artheitlichen Unterschiede der Elemente einer Symmetrie. Hier zeigt sich aber auch, dass die Symmetrie des binär Gegensätzlichen als innere Kategorien aus Kategorien hervorgehen, die "über" ihnen stehen.
(La1 2.2.2) Für die beiden Nebengegen-Glieder i und e ergibt sich als Gegenheit der Selbheit (gi) die Verhaltheit, das Verhältnis. Sie stehen zueinander in einem Neben-Verhältnis, zur Linie u in einem Über-Unterverhältnis usw. AN der Linie a1 in (La1 1) gibt es keine Gegen-Verhältnisse, sondern die Eine Selbheit, als Or-Selbheit. i verhält sich zu e in bestimmter Weise. Das Gegenselbe steht sich als ein Anderes wechselseitig entgegen, eines ist des anderen Objekt.
(La1 2.2.3) Für die beiden Neben-Gegenglieder i und e ergibt sich als Gegenheit der Ganzheit (Or-Ganzheit der Linie a1) die Teilheit. Das Gegenganze ist Teilheit. Die Linie a1 ist IN sich zwei und nur zwei Teile i und e. Hier wird von Weizsäcker die Bedeutung der Binärität eher geahnt, als genau erkannt. Man kann nicht sagen: die Linie a1 ist eine Menge, weil AN der Linie a1 überhaupt keine Teilheit ist, wohl aber die Linie a1 ist IN sich in dieser ersten Gegenheit zwei und nur zwei Teile (Elemente). Wir unterscheiden aber die Ab-Teilung von der Neben-Teilung. Denn die untergegenheitlichen Teile nennt man Unter-Teile, (Ab-Ant-Ganze). In der Vereinigung ergibt sich das Vereinganze der Teile, die Erste Summenbildung von i und e. Hier liegen jene kategorialen Zusammenhänge, welche etwa die "Rätsel" der Verschränkung und jeder Wechselwirkung sehr deutlich machen.
(La1 2.3). Auch hinsichtlich des Wie der Wesenheit usw. hinsichtlich der Begriffe der Formheit do usw. ergeben sich für die gegenheitlichen Linie i und e neue Bestimmungen.
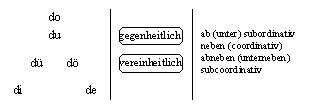
Unter (La1 1.2.1) fanden wir, dass die Linie a1 Satzheit do hat. Hinsichtlich der Gliederung a1, i, e, usw. ergibt sich hier Gegen-Satzheit und zwar wiederum Neben-Gegensatz zwischen i und e, Ab-Gegensatzheit zwischen u und i usw. Die Gegensatzheit ist die Bestimmtheit. Bestimmtheit ist also eine Teilwesenheit an der Satzheit als Gegensatzheit. i ist also gegen e bestimmt, aber auch u bestimmt e und i usw. Diese Gegensatzheit hat selbst auch eine Form. Die Or-Satzheit ist der Form nach ganz Jaheit, ohne Neinheit, also Or-Jaheit. Diese Jaheit ist nun selbst wiederum gegliedert
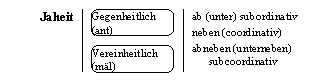
Statt der Or-Jaheit kann man sagen, die Positivität. Was die Gegen-Jaheit betrifft, so ist diese zugleich Gegen-Neinheit, entgegengesetzte Verneinheit (oppositive Negativität). Das Nein oder Nicht wird daher nur und erst hier erkannt. Die Gegenneinheit ist nur an der Gegenjaheit. Dadurch dass i bestimmt ist als das Eine von zwei Wesentlichen, ist es auch zugleich bestimmt als nicht sein Anderes, sein Gegenheitliches, hier also e ist von ihm verneint. Das Nein ist also nur in einer Beziehung gegen ein Anderes. Durch die gegenseitige Teilverneinung i gegen e und umgekehrt, wird von der Linie a1 als der Or-Linie (dem Ur) überhaupt nichts verneint. Die Bestimmtheit i gegen e besteht darin, dass es e ausschließt. Hier liegt die Grundlage der Wörter ja, nein, Nichts, des logischen „ist nicht“. Zu beachten sind natürlich auch die Gegenjaheiten von der Linie u gegen i bzw. e (Unter-Gegen-Verneinung oder Ab-Ant-Verneinung).Wenn also Weizsäcker meint, die Ur-Alternativen repräsentieren den Informationsgehalt einer möglichen Ja-Nein-Entscheidung, so zeigt sich hier, dass eine mögliche Ja-Nein-Entscheidung ( "Ent-scheidung" als Ab-Gegen und Neben-Gegen Scheidung!) keineswegs kategorial präzise erfasst wird. Es gilt vielmehr: Die Ja/Nein-Alternative ergibt sich erst in unter der Einen, selben ganzen Or-Jaheit. Die in unter sich die Gegenheit von Ja/Nein ist, wobei aber die gesamten Or, Ur und Ab-Gegen und Neben-Gegenbeziehung in diesem Konnex zu beachten sind, die sehr deutlich im obigen Kreisschema in ihren Gegenheiten und Vereinheiten zu erkennen sind. Hier fehlen bei Weizsäcker und Lyre wichtige kategoriale Glieder und Zusammenhänge. Hier erscheint auch die von Lyre als apriorisch erkannte Kategorie der Unterscheidbarkeit, allerdings nicht als herausgegriffen, sondern als eingebettet in einen anderen semantisch-strukturellen Zusammenhang.
(La1 2.3.1) Auch die Satz-Einheit, an der Linie a1, Einheit der Satzheit (oder Zahleinheit), ist hier gegenheitlich zu finden als:
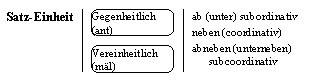
also Satz-Gegeneinheit, Satz-Vereinheit. Für die Zahl-Gegeneinheit wird das Wort Vielheit oder Mehrheit benützt. Zu beachten ist aber, dass hier noch keine Vielheit gegeben ist, die mehr als Zweiheit wäre (Gegeneinheit). Statt der Vereinzahlheit sagt man Allheit, Totalität, die aber hier nur aus zwei vereinten Gegen-Gliedern besteht. Von der Linie a1 gilt unbedingte und unendliche Zahleinheit (nach INNEN), keine Vielheit, oder Mehrheit, keine Allheit. Die Linie a1 ist IN/UNTER sich die Vielheit und das Viele, die Allheit und das All oder die Totalität, das Universum aller Glieder in sich. Jede ursprüngliche Vielheit in der Linie a1 ist eine Zweiheit, und jede Vereinzahlheit ursprünglich eine vereinte Zweiheit, da der Gegensatz, oder die nach Ja und Nein bestimmte Gegenheit nur zweigliedrig ist. Die unbestimmte Vielheit oder Vielzahligkeit ist hier noch nicht gegeben, z.B. die unendliche Vielzahligkeit 1,2,3,4,5, usw., die sich natürlich auch in der Linie a1 darstellen lässt.
(La1 2.3.1.2) Auch die Richtheit di (als Form der Selbheit in La1 1.2.1) erfährt hier weitere Bestimmung:
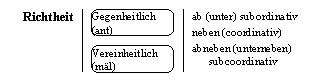
Hier wird die Gegenrichtheit in der Linie a1 (dem Ur) erkannt. Und zwar haben i und e nebengegenheitliche Richtheit. i „fängt“ bei X an und „geht in die eine Richtung", e „fängt“ bei X an und „geht in die andere Richtung“. Weiters ist die Richtung von u nach i und e und umgekehrt von i nach u usw. zu erkennen. Anstatt Richtheit sagt man gewöhnlich Dimension, Erstreckung. Der Begriff der Richtheit ist für die Ausbildung der Mathematik wichtig, bisher aber ungenau erkannt und entwickelt. Hier ist zu unterscheiden: die Eine Ganze Richtheit (Or-Richtheit di) der Linie a1; die Neben-Gegenrichtheit an den Teilganzen i und e und andererseits die Ab-Gegenrichtheit u gegen i und e usw. Hier hat der Begriff der Richtheit noch nichts mit Zeit und Bewegung zu tun. (In der Umgangssprache wird Richtung ausgedrückt durch: hin und her, auf und ab, hinüber und herüber.)
Für die in der AQT im logischen Atom, dem Ur, enthaltene Symmetrieannahmen, wie für alle anderen Symmetriepostulate hat die Kategorie der Richtheit grundsätzliche Bedeutung. Bei Weizsäcker fehlt natürlich die Or-Richtheit. Die in den Symmetriepostulaten enthaltenen und im Hilbertraum implementierten Vorstellungen des Spin, Isospin-Vektor, Ganz- und Halbzahligkeit des Spin usw. sind bereits innere Kategorien der Richtheit, allerdings in Verbindung zu allen anderen bisher abgeleiteten Kategorien (wie Selbheit, Ganzheit usw.) Was bei Weizsäcker erst sehr unbestimmt intuitiv erkannt wird, ist die Beziehung der Neben-Gegenrichtheit zur Ab-Gegenrichtheit, und die ständige Verbindung der binären inneren Gegenheiten zur Ur-Richtheit (vgl. wiederum die obige Darstellung mit Kreisen). Richtig wird bei Weizsäcker/Lyre gesehen, dass diese innere Differenziertheit der Richtheit noch nichts mit räumlichen und zeitlichen Kategorien zu tun hat.
Hier ergibt sich die wichtige Frage, ob die in den Quantentheorien "erkannten" oder müssen wir sagen "konstruierten" bzw. implementierten oder geforderten Symmetrien bedeuten, dass die Natur von den unendlich vielen Möglichkeiten der ersten binären Teilung der Linie a1, nämlivch La1 (2.1), La1 (2.2) ...La1 (2.¥) nur bestimmte Varianten "auswählt"und realisiert, oder ob jede primare duale Teilung einer endlichen Einheit ihre eigene, gegenüber der Teilung ½ und ½ "verschobene" "ungleichmäßige" Symmetrie entwickelt und ausbildet.
Eines der faszinierendsten Phänome in diesem Zusammenhang ist sicherlich die Verschränkung (entanglement):Im Bohmschen Gedankenexperiment zerfällt ein Teilchen ohne Drehimpuls (<Spin 0) in zwei Teilchen mit halbzahligem Spin (h dividiert durch 2 mal Pi). Die beiden Teilchen haben vor der Messung nicht den Spin, den wir bei der Messung beobachten. Die Messung an einem der beiden Teilchen legt automatisch und instantan auch fest, welchen Zustand das andere Teilchen besitzt, egal, wie weit entfernt dieses Teilchen ist! Es gibt also zusätzliche Eigenschaften der Teilchen, die man nicht unbedingt direkt beobachten kann, die jedoch das Verhalten jedes einzelnen Teilchens festlegen ( verborgene Variablen). Mit Hilfe dieser verborgenen Variablen können die perfekten Korrelationen der beiden Teilchen im Bohmschen Experiment erklärt werden. In (Ze 03, S. 78): "Wir können uns dies einfach so vorstellen, dass die beiden Teilchen von der Quelle so etwas wie Instruktionslisten mitbekommen haben. Auf diesen Instruktionslisten steht genau, welchen Spin die Teilchen haben müssen, falls sie entlang einer bestimmten Richtung gemessen werden. Diese Listen müssen natürlich Instruktionen für ALLE nur möglichen Orientierungen mitführen. " Die beiden Teilchen können also in ihren Instruktionslisten nachsehen, die ja die Messresultate für alle nur denkbaren Orientierungen enthalten.
Diese Beobachtungen enthalten u.E. gewaltige Konsequenzen. Zum einen wird hier von der "Quelle" gesprochen (Ur-Einheit, Ur-Selbheit, Ur-Ganzheit usw. im Sinne unserer Kategorien), welche den beiden In-Teilchen einen Informationskatalog mitgibt. Was aber kategorial noch viel interessanter ist: Es sind in diesen Informationslisten alle nur möglichen Orientierungen der Richtung (Drehung usw.) enthalten. Es handelt sich also um eine dem Inhalt nach universelle Informationsmenge, die natürlich die weitere Frage aufwirft, ob diese Menge nicht eigentlich unendlich vielzahlig sein muss. Es zeigt sich aber auch hier, dass es keineswegs verstiegen ist, IN einer endlichen Einheit, hier der Linie a1 innere Unendlichkeiten anzunehmen. Betrachtet man nämlich das ursprüngliche Teilchen mit Spin 0 als eine Linie a1 und die beiden inneren Teilchen als Linien i und e, dann zeigt sich, dass in der AB-Gegenheit von dem Ur-Teilchen, der "Quelle", an die beiden In-Teilen eine unendliche Zahl von Informationen "herabgeht". Die innere unendliche Vielzahligkeit an Informationen, die von der "Quelle" an die beiden Teile in den Informationskatalogen gegeben wird, ergibt sich daraus, dass die beidseitig endliche Linie a1 "teilhat" an der inneren Unendlichkeit der unendlich langen Linie LO, die ihrerseits wiederum "teilhat" an der unbedingt unendlichen Unendlichkeit Gottes. Die von Zeilinger erwähnte "Quelle" ist nun kategorial in unserem Sinne die Or- und Urkraft in unter der die beiden Teile in der erwähnten binären Gegenheit zu erkennen sind. Die Or- und Urkraft besitzt aber offensichtlich eine Art universelle (womöglich unendliche Informationsdatenmenge) die sie in bestimmter Weise an die inneren Teile weitergibt. Die Or-Urkraft (hier der Linie a1 oder des Teilchens ohne Drehimpuls ) wirkt also in sich, als wäre sie ein kleines All!?
Aus diesen Grunderkenntnissen über die Natur ergeben sich für die Quantenphysik neue Lösungsperspektiven. Die Übergänge von der Urkraft u zu den beiden In-Gegenheiten i und e führen keineswegs zu einer Lösung von der weiterhin wirkenden Urkraft auf die beiden In-Teile. Die Teile i und e sind, gleichgültig auf welcher begrenzten Ebene der Naturprozesse wir uns befinden, immer durch ein bestimmtes komplementäres Neben-Gegen-Verhältnis der Mischung von Selbheit und Ganzheit bestimmt. Dieses inhaltliche, in der Wesenheit Gottes deduzierte, nicht erst durch Beobachtung entstehende Neben-Gegenheitsverhältnis und Neben-Vereinverhältnis der Komplementarität der beiden Glieder ist zu unterscheiden von ihrem Ab-Gegenverhältnis und Ab-Vereinverhältnis zur höheren Urkraft u. Daher werden Beobachtungs-Wirkungen auf einen In-Teil, z. B. i, unmittelbare Wirkungen auch auf e haben, da u, i und e als strukturelle (Ver)-Einheit weiter bestehen (Verschränkung). Durch Einwirkung etwa auf ein Element (i) kann daher an beiden Elementen (i und e) eine Veränderung des Mischungsverhältnisses zwischen Selbheit und Ganzheit erfolgen. Wenn daher eines von zwei "Teilchen" durch Beobachtung seinen Spin ändert, erfolgt infolge der inhaltlichen Komplementarität (Neben-Komplementaritätssymmetrie) zwischen den beiden auch eine komplementäre Veränderung des Spins des anderen "Teilchens". Die deduktive kategoriale Darstellung der Naturprozesse im obigen Sinne scheint eine Interpretation dieser Phänomene zu erleichtern. Die deduktiven Grundlagen der Naturwissenschaft ergeben eine neue Logik des Naturgeschehens, welche die Probleme der bisherigen Interpretationen überwindet.
Die Figur, welche dieses Beziehungen darstellt ist etwa:
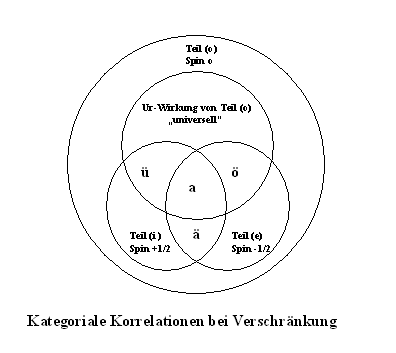
Natürlich hat die Vorstellung von der Information bei Zeilinger einen anthropomorphen Zug, denn wir, die erkennenden Subjekte, geben in keiner Weise der "Quelle" die Informationsfülle, wir nehmen sie eher über logische Überlegungen aus dem Experiment durch Schlüsse an! Auch ist es anthropomorph anzunehmen, das Teilchen "sehe in den Informationslisten nach, wie es sich unter diesen Umständen verhalten müsse." Wir nehmen die Information aber eigentlich als "objektive" im Objekt der Quelle enthaltene Informationsfülle an, was natürlich auch bestimmte Probleme aufwirft.
(La1 2.3.1.3) Auch die eine selbe ganze Fassheit de, als Form der Ganzheit der Linie a1 (des Urs) erfährt hier Bestimmung.
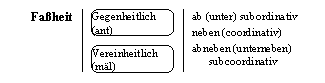
Die Linie a1 hat „ungeteilte“ ganze Fassheit (Or-Fassheit), die beiden inneren Teile i und e haben Neben-Gegenfassheit, u hat gegen i und e Ab-Gegen-Fassheit, schließlich erkennen wir alle Vereinfassheiten. Auch hier kann man sagen, dass die Linie a1 ganze Fass-Jaheit hat, dass aber von i und e neben-wechselseitig Fassjaheit und Fassneinheit gilt. Denn i fasst das, was e nicht fasst und umgekehrt. Daraus ergibt sich das In-Sein und Außensein. e ist außer i und i ist außer e. Für den logischen Atomismus bei Weizsäcker ergibt sich aber auch, dass außer der Neben-Gegenfassheit auch die Beziehungen zur Or-Fassheit also die Ab-Fassheit zu beachten und theoretisch zu berücksichtigen ist.
(La1 2.3.1.3.1) An dieser Stelle müssen wir noch genauer fragen: Wie ist die FORM dieses In-und Außensein? Die Form dieses einander In- und Außenseins ist die Grenzheit. Das sieht man leicht indem man sagt: X ist die Grenze von i und e. Dort wo die Inbefassung von i aufhört, an der Grenze X, da fängt die Inbefassung von e an. Grenzheit, Grenze ist also die Form des Gegenfassigen. Es ist also deutlich, dass An der Linie a1 (also hier dem Ur) keine Grenze ist[39], sondern dass erst IN der ersten In-Teilung derselben, an i und e die Grenzheit als X gegeben und erkannt wird. i und e haben daher eine gemeinsame Grenze. Die Grenze X ist weder i noch e, sie ist ihre gemeinsame Grenze.
(La1 2.3.1.3.2) Fragen wir nun, was ist IN dem, was da ingefasst, eingefasst wird. Der Inhalt des Infassigen wird als groß oder Großheit bezeichnet. Damit Größe da sein kann, muss etwas innerhalb bestimmter Grenzheit bejahig befasst sein.
Betrachten wir das inbegrenzte Große, so erscheint die Grenze desselben als dessen Ende, als Endheit, oder umgekehrt als Anfang. Hier erkennen wir die Begriffe Endheit, Endlichkeit, und Un-Endlichkeit in einem schon inneren, abgeleiteten Sinne, nämlich als Endlichkeit IM Endlichen. Die Endlichkeit erscheint in Karidonien erst als eine innere Ableitung unter der Einen, ganzen, nach innen absoluten geraden, unendlich langen Linie LO. Daher ist die Endlichkeit der beiden Größen i und e IN a1 eine Art der Endlichkeit, die ohne die Unendlichkeit der Linie LO nicht möglich ist.
Hier ergeben sich aber, wenn wir Lyres Begriffe der Endlichkeit und Unendlichkeit betrachten, beachtliche Unterschiede zur Theorie der Karidonier. Ausgegangen wird bei Weizsäcker und Lyre nicht vom der unendlichen Linie LO, sondern vom endlichen, logischen Atom, dem Ur, das durch Akkumulation im Rahmen endlicher Fortsetzung in einem offenen Finitismus lediglich eine potentielle Unendlichkeit ergibt oder voraussetzt und am "anderen Ende" durch die Vorgaben des HILBERTraumes begrenzt ist. Die Vorstellung der Unendlichkeit der Or-Linie LO und die Unendlichkeit der beiden Glieder i und e IN der Or-Linie LO gibt es im Modell Weizsäckers nicht!
Hier ist auch der Ort, konkret auf das technische Unendlichkeitsproblem in der Quantenphysik einzugehen. In (Ka 96, S. 92f.) heißt es: "Das Problem aller Quantenfeldtheorien liegt nun darin, dass einige dieser Beiträge unendlich sind; ein unendlicher Wert einer messbaren Größe ist aber niemals physikalisch sinnvoll. Das Unendlichkeitsproblem kommt in der Quantenfeldtheorie in unterschiedlicher Stärke vor. In renormierbaren Quantenfeldtheorien taucht nur eine endliche Zahl von Unendlichkeiten auf. Dies ermöglicht ein Verfahren der Elimination derart, dass am Ende eine endliche, messbare Größe übrigbleibt. Das sieht etwas nach Taschenspielerkunststück aus, jedoch lässt es sich methodisch rechtfertigen, und ist nicht als epistemisch trivial zu betrachten. Genau diese Strategie der Ausschaltung von Unendlichkeiten kann man nicht auf das quantenmechanische Gravitationsfeld übertragen, weil hier eine unendliche Zahl von verschiedenen Arten unendlicher Größen auftauchen. Diese mathematische Eigenschaft macht die Theorie unprüfbar, weil man eine Voraussage über den unendlichen Wert einer Variablen nicht messen kann. Eine unkontrollierbare Theorie ist aber epistemisch wertlos, weil ihre Wahrheit oder Falschheit nicht festgestellt werden kann[40]. Dieses Unendlichkeitsproblem rührt an die Fundamente unserer physikalischen Ontologie. Es macht einen wesentlichen Unterschied aus, ob Materiefelder ( e‾, v, p, n) dem Quantisierungsverfahren unterworfen werden, wobei der Raumzeitrahmen aber seine klassische Gestalt als Arena der materiellen Prozesse behält, oder ob die Raumzeitmannigfaltigeit selber die Quantisierungsprozedur erfährt. Das metrische Feld drückt ja die Struktur der Raumzeit aus, in der sich das physikalische Geschehen abspielt, damit ist im Falle ihrer Quantisierung die räumliche und zeitliche Ordnung der Dinge selber von dem Diskretisierungsvorgang betroffen. Die Geometrie des physikalischen Raumes erhält ein gitterähnliches Muster an Stelle der glatten, stetigen Mannigfaltigkeit. Dies stellt den stärksten Eingriff in die Konstruktionsprinzipien der klassischen Physik dar, den man sich denken kann. Deshalb müsste vermutlich eine neuartige geometrische Struktur gefunden werden, um eine kohärente einheitliche Darstellung von Materiefeldern und Raumzeit zu bewerkstelligen. Diese fundamentale mathematische Struktur ist noch nicht gefunden." Die neuartige geometrische Struktur kann nur dadurch gefunden werden, dass die inhaltlichen Strukturen der Natur, (die in sich die Materiefelder enthalten, und die Raumzeitstrukturen als innere Glieder in der unendlichen Unbedingtheit der göttlichen Wesenheit erkannt werden, deren Kategorienstruktur in jeweils bestimmter ART in der Natur und in der Raumzeit sowie deren Verknüpfung wieder erscheinen. Eben diese deduktiv erkannte kategoriale Gleichheit, die auch die Gottähnlichkeit an allem Endlichen bedingt, ermöglicht erst die völlige Lösung der intuitiv geahnten Relationen zwischen Natur und Raumzeit. Hierbei ist aber auch das oben geschilderte Unendlichkeitsproblem der physikalischen Mathematik dadurch zu lösen, dass auch hier deduktiv vom Einen, absoluten Unendlichen aus in die inneren Differenzierungen desselben deduktiv vorgegangen wird.
Die Endlichkeit ist eine Bestimmung der Grenzheit, die Grenzheit wieder eine Bestimmung der Gegenfaßheit an der Großheit und mithin daher eine Bestimmung der Ganzheit als Gegenganzheit. Daraus zeigt sich, dass der Begriff der Endlichkeit nicht richtig gefunden wird, ohne die Begriffe der einen, selben, ganzen Richtheit (di), der Faßheit (de) und der Ganzheit (ge). Von der Linie a1 kann nicht gesagt werden, dass sie an sich endlich ist, oder Grenze hat, sondern nur, dass sie ganz (organz) ist und in ihrer Ganzheit auch alle Endlichkeit und Grenzheit des Gegenganzen in sich befasst.
(La1 3) In der dritten Erkenntnis fassen wir zusammen, was bisher erkannt wurde, also was die Linie a1 AN und IN sich ist.
Es gilt: Die Linie a1 ist AN sich und IN sich ein Organismus, heute würde man auch sagen eine Struktur. Die An-Gliederung und die In-Gliederung wurden unter (La1 1 und La1 2) dargestellt. Dies gilt auch für die Struktur des Ur. Ein gewaltiger Unterschied zwischen der Linientheorie der Karidonier und der Ur-Theorie Weizsäckers besteht nun in der "Verankerung" einer endlichen Einheit im Ganzen. Wie wir sehen, hängt in der Linientheorie der Karidonier die ontische, logische und mathematische Struktur der Linie a1 (des Ur) in ganz deutlichen Konnexen mit den übergeordneten Kategorien der unendlichen langen Linie O und der IN dieser enthaltenen Linie e, welche hier die unendliche Natur, den materiellen Kosmos repräsentiert. Die Vorstellung Weizsäckers reicht aber in der Theorie des Kosmos über endliche ontische, logische, semantische und mathematische Relationen nicht hinaus. Auch ist ihm die Unterscheidung zwischen der Unendlichkeit der Linie O, und der Unendlichkeit der Linie e (neben i) fremd.
(La1 3.1) Dieser bisher dargestellte Gliedbau (Organismus, Struktur) der Linie a1 ist „voll"ständig. Hier ergibt sich die erste Erkenntnis hinsichtlich der Begriffe ALL-heit, Totalitiät. Diese Allheit ist aber nicht irgendeine unbestimmte verschwommene, sondern die Gliederung ist deutlich bestimmt.
(La1 3.1.1) Aus dieser Gliederung ergibt sich auch, dass die Gegenheit nur zweigliedrig ist, denn es gibt keine anderen inneren Glieder der Linie a1 als i und e, und deren Jaheit und Gegenjaheit (Neinheit). Natürlich gibt es auch „noch endlichere“ Linie in a1, aber das wird sich erst im folgenden ergeben.
(La1 3.1.2) Für diesen gegliederten Organismus gilt auch, dass alle hier entwickelten Begriffe aufeinander anzuwenden sind. So hat z.B. die Ganzheit (ge) auch Wesenheit, Selbheit und Gegenselbheit, also Verhaltheit, Ganzheit, sie hat eine bestimmte Form oder ist in bestimmter Grenzheit, gegenüber der Selbheit, usw.
(La1 4.1) Jeder der beiden Teile i und e in der Linie a1 (und auch die Vereinigung der beiden) ist selbst wiederum AN und IN sich Struktur, Organismus gemäß der Struktur (La1 1-3), also hat selbst wieder eine der Linie a1 ähnliche Struktur.
Es gilt: Wie sich die Linie a1 zu u, i und e und deren Gegenheiten und Vereinheiten verhält, so verhält sich wiederum i zu dem, was es IN sich ist, usw...
(La1 4.1.1) Die Form dieses Ähnlichkeitsverhältnisses ist die Stufung, Abstufung (Stufheit), wobei sich das unter (La1 2.3.1.3) dargestellte Insein und Außensein nach innen fortsetzt.

(La1 4.1.2) Fahren wir nun mit der inneren Gliederung von i und e und deren Vereinigung fort, so ergeben sich in i unendlich viele Linien gemäß z1, in e unendlich viele Linien wie z2 und in der Vereinigung von i und e unendlich viele Linien wie z3. Analysieren wir die Ganzheit, Großheit, Grenzheit und Endlichkeit (La1 2.3) dieser Linien z1, z2, z3, so fällt auf, dass sie ebenso wie die Linien i und e „auf beiden Seiten endlich sind“, beidseitig begrenzt sind, sie sind also wiederum ganz endlich, oder unendlich-endlich. i und e sind also in sich unendlich endliche Glieder. Ein solches Glied der Linie a1 nennt man nun individuell, partikular. Wichtig ist zu erkennen, dass sich die Art der Endlichkeit von i einerseits und a1 andererseits nicht unterscheiden. Die Glieder i und z.B. z1 gehören den gleichen Stufen der Grenzheit, Begrenzung, gleichen Grenzheitsstufen an.
(La1 4.1.3) Die Glieder z1, z2, z3, sind beidseitig endlich, sind also in der Stufung der Grenzheit gleichstufig mit i und e. Teilt man jedoch z1 weiter in 3 Teile, so erhält man der Artheit nach keinen neuen Typ von Linien, weil 1/3 von z1 wiederum eine beidseitig begrenzte Linie ist. Die Grenzheitsstufe der Linientypen z1, z2, usw. ist also die gleiche innere Grenzheitsstufe wie jene der Linie a1. Zu beachten ist, dass bei Lyre in der vollständigen binären Alternative (dem Ur) die Linien z3, die sowohl auf i wie auch auf e liegen, überhaupt fehlt! Seine Alternative ist nur über den Begiff des ODER bestimmt, was aber keineswegs ausreicht, um die innere semantische Struktur der Linie a1 (des Ur) zu bestimmen. Eben, weil die offensichtlichen Beziehungen der Linien z2 zu den Linien i und e bei ihm fehlen, können in seiner Ur-Theoie die für die Quantentheorie so wichtigen , angeblich logisch problematischen "verschwommenen" Begriffe der Wechselwirkung, des gleichzeitigen Vorhandenseins einander scheinbar ausschließender Phänomene, kaum gefasst werden.
(La1 4.1.4) An diesen unendlich endlichen Gliedern (Elementen) in/unter i und e ist nun in zweifacher Hinsicht Unendlichkeit.
1. In den Gliedern i, e und ihrer Vereinigung gibt es jeweils unendlich viele unendlich endliche Elemente (z1.., z2.., z3...).
2. Jedes unendlich endliche Glied z1, usw. ist selbst weiter unendlich teilbar und bestimmbar.
(La1 4.1.5) Das Endliche, Bestimmte oder Individuelle jeder Art und Stufe ist also nicht isoliert, gleichsam losgetrennt von dem, was neben und außer, bzw. über ihm ist (z.B. z1 von a1), es ist in/unter seinem höheren Ganzen und mit ihm vereint, wie auch mit den Nebengliedern. Diesen Konnex zwischen einem Ur und dem Kosmos erkennt Lyre z.B. nur im kategorialen Rahmen des HILBERTraumes und seinen inneren Gliederungen.
Hier auch ein Wort zur Frage zur Behandlung des Raum-Zeit-Kontinuums. Lyre schreibt etwa (Ly 98, S.160): "Zweifelsohne gehört die Frage nach der Natur des Kontinuums mit zu den schwierigsten philosophischen Grundfragen der Mathematik und Physik. Wir verweisen auf die Auffassung Aristoteles, das Kontinuum als dasjenige anzusehen, was in wieder kontinuierliche Teile teilbar ist. Unsere Vermutung wäre, dass wir dieser Auffassung, die eben vom Unendlichen im Sinne potentieller, nicht aktueller Information ausgeht konzeptionell ernsthaft folgen müssen. Bei der Umsetzung im Rahmen der Physik sollte dann zusätzlich die Quantentheorie ins Spiel kommen. Wie sich dies aber formal angemessen ausdrücken lässt, ist bislang das große ungelöste Rätsel.[41]"
Wie das Kontinuum unabhängig von Raum und Zeit zu behandeln ist, ergibt sich in der Sematik der Wesenlehre aus ganz anderen Deduktionen des Begriffes der Unendlichkeit Gottes. Zweifelsohne ist zwischen a) der Ontologie der an der Wesenheit Gottes abgeleiteteten Inhaltlichkeit des "Objektes" jenseits von Zeit und Raum und b) der Ontologie des Raumes als formaler Kategorie, die jedes endliche inhaltlich Wesentliche als formale Kategorie IN sich hat, zu unterscheiden. Mit Sicherheit kann nicht gesagt werden, dass der Raum, dass Räumlichkeit den sachlichen Inhalt eines endlichen Wesentlichen mitbestimmt, oder erzeugt. Für den qualitativen Inhalt eines endlichen Wesentlichen sind diejenigen Kategorien maßgeblich, welche jede Qualität in unter der göttlichen Wesenheit bestimmen. Die innere Stetigkeit, die "Lückenlosigkeit", die "Nicht-Quantisierung" des Kontinuums ergibt sich in der Wesenlehre in der oben dargestellten Form (0 4.1.5.2 f.). Die Räumlichkeit ist eine weitere, innere Qualität des endlichen Wesentlichen, die sich aber aus "höheren" Zusammenhängen ergibt. Der Raum selbst ist gleichfalls eine formale Kategorie, die selbst wiederum Qualität ist und in sich unendlich (or-om) gegliederte innere Qualitäten besitzt. Auch der Raum ist als göttliche Kategorie nicht quantisiert, Quantisierung ist erst eine innere, sehr wohl kategorial vorhandene Eigenschaft des Raumes. Die kategoriale Quantisierungsmöglichkeit des Raumes ist aber keineswegs für die Quantisierung der endlichen "Objekte" konstitutiv, welche Räumlichkeit IN sich haben. Wir müssen wohl sagen: Die Quantisierung des Inhaltes eines endlichen Wesentlichen (eines endlichen "Objektes") ist eine Folge der In-Gegenheit endlicher Größen, die aber in unter einem "höheren" Wesentlichen zu erkennen sind, IN dem sie innere Teile bilden.
(La1 5) Die Zeit, das Werden
Wo gibt es in diesem System der geraden Linie a1 ein WERDEN? Wie leitet sich hier, bei der Linie a1 die Kategorie der Zeit ab. Lyre meint u.a. "the cosmic time (the epoch) is correlated with the total number of urs, i.e. the increase of the number of urs has to be understood as an expression of time." Andererseit macht er den Zeitbegriff vom subjektiven Moment der emirischen Erkenntnis abhängig.
(La1 5) Das Werden
Zu beachten sind hier die Linie a1, die beiden Linien i und e. Sie sind jede in ihrer Art endlich, aber in ihrer Unendlichkeit im Innern unendlich bestimmt, das ist vollendet endlich und zwar insbesondere als diese beiden Teile i und e in a1; das ist, sie sind in sich eine unendliche Zahl vollendet endlicher, nach allen Wesenheiten bestimmter, Einzellinien, z1, z2...;usw.; (La1 4.1.2 ), denen wiederum alle Kategorien auf vollendet endliche Weise zukommen, und die in, mit und durcheinander zugleich in ihrem unendlichen Ganzen, von a1, und i bzw. e oder in beiden sind. Der logisch-atomistische Aufbau der Linie a1 in sich ist daher wesentlich komplexer, als er bei Lyre für das Ur über den HLBERTraum erfolgt. Wie sich aus diesen unendlich vielen Bestimmtheiten jeder Einheit die Zeit und das Werden ergeben, ist bereits oben ausführlich unter (L0 5) erläutert und abgeleitet worden.
Wir wollen aber für die weitere Analyse hier Lyres elementare Feststellung heranziehen:
"Ly 94, S. 6):" Space is by no means "empty", it is at least filled up with urs. Moreover, its structure as a global S3 is a consequence of the isomorphic structure of the abstract symmetry group of urs, i.e., space is the appearance of pure information in the world. Apart from this further appearances of information like energy and matter exist. Hence radiation and massive particles as well as the vacuum density will be described by density situations of urs, i.e. information. In that sense energy and matter can be looked upon as condensates of information in front of background of urs representing vacuum."
In unserem kategorialen Rahmen ergibt sich hier für das Verhältnis von Energie zu Materie folgende Bezüge:
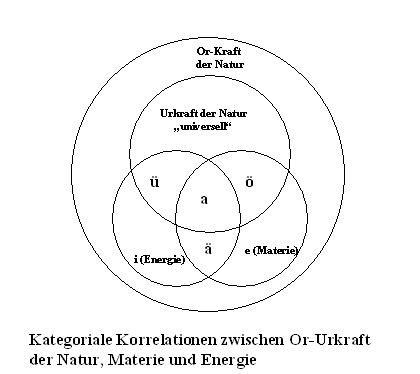
Energie und Materie sind nicht nur in der Gradation der Dichtheit voneinander unterschieden. Ihre dyadische Gegenheit ist vor allem durch das in der Grundwissenschaft abgeleitete unterschiedliche Verhältnis von Selbheit und Ganzheit bestimmt. In der Grafik zeigen sich aber auch die Möglichkeiten der unendlich vielen Gradationen der Gewichtung von Selbstheit und Ganzheit, die vor allem aber auch die Möglichkeit der Verbindung von energetischen und Massephänomenen in ä beinhalten. Schließlich fehlen in der modernen Physik, die von der Binärität als höchster Kategorie ausgeht:
a) die Erkennntis der Einen, selben, ganzen Or-Kraft ;
b) die Erkenntnis der Verbindung von Energie und Materie mit der Or-Kraft, IN der sie beide als antheitliche Glieder sind, vermittels und über das Glied der Ur-Kraft u!
c) die Erkenntnis aller Relationen der Ab-, Neb- Gegenheiten und Vereinheiten, wie sie sich aus dieser Zeichnung ergeben, wodurch sich das Verhältnis von Ganzheit zu den Teilen, des Einen zu dem Vielen, zur Allheit und Universalität anders darstellt.
Zum Unterschied von Lyres Konzept ist natürlich der hier demonstrierte Kategorialbezug nicht digitalisierbar! (Vgl.: http://or-om.org/MI%20und%20KI1.htm ).
Da i und e in a1, durch a1, nach ihrer ganzen Wesenheit vereint sind, so sind sie es auch, sofern sie die beiden entgegenstehenden Reihen vollendet endlicher Linien in sich sind und enthalten; so dass diese beiden Reihen vereint sind. Es sind dies die unendlich vielen Linien, die sowohl auf i als auch auf e liegen. Darin gibt es wieder einen Typ unendlich vieler Linien, deren Abstand auf i und e gleich lang ist und die wir als die Gruppe d1, d2, d3, usw. bezeichnen wollen.
Jede dieser Arten endlicher Linien z1 usw. oder d1, d2 usw. kann sich nun in ihrer Länge verändern. Sie kann länger oder kürzer werden, diese Verkürzung und Verlängerung kann auch rhythmisch und zyklisch erfolgen. Dieser Zyklus läuft innerhalb der Linie a1 in einer Dimension ab.
Wohlgemerkt: Hier ist die Zeit als Kategorie in der Linie a1 (demUr) noch nicht erkannt und abgeleitet. In der Terminologie Lyres ist hier nicht von Teilchen in Raum und Zeit die Rede, sondern von logischen Atomen, deren Symmetrien die Raum-Zeit und alle Objekte mit ihren Wechselwirkungen bestimmen. (Charakterisierung der Wellenfunktion als potentieller Information im Sinne von Quanteniformation ).
Wie entsteht bei Lyre das Apriori der Zeit? Durch Aktualisierung der Potentialität jenseits von Raum und Zeit bestehender Ur-Alternativen! Wodurch geschieht die Aktualisierung? Durch Kenntnisnahme der an einem "Objekt" gewinnbaren Information durch ein empiriebegabtes Subjekt! Derjenige, der die Potentialität in Aktualität übergehen lässt, ist daher das beobachtende Subjekt?! Getrennte Teile liegen erst dann vor, wenn faktisch eine Teilung mittels Messung durchgeführt wurde! Wir wiederholen von vorne Sätze Lyres:
"Der Indeterminismus ist daher eine notwendige Eigenschaft einer fundamentalen Physik. Die Zukunft ist offen, die Vergangenheit faktisch. Die Reduktion der Wellenfunktion ist Ausdruck des notwendig stattfindenden Übergangs von potentiell zu aktuell bei Kenntnisnahme der an einem Objekt gewinnbaren Information durch ein empiriebegabtes Subjekt. Die Basisprinzipien der Unterscheidbarkeit und Zeitlichkeit verweisen durchaus auf den Holismus der Quantentheorie. Ein Ganzes ist der Möglichkeit nach in unterscheidbare Teile zerlegbar. Aber getrennte Teile liegen erst dann vor, wenn faktisch eine Teilung mittels Messung durchgeführt wurde. Dann aber ist das ehemalige Ganze bereits zerstört. Man beachte, wie in diesen Verbalisierungen unterscheidende und zeitliche Sprechweise ineinandergreifen. Die Quantentheorie kennt die Teilbarkeit in ununterscheidbare Teile. Hierin kommt noch der primäre Charakter des Ganzen zum Ausdruck, das nur prinzipiell, dann aber bei Zerstörung des Ganzen, in Teile zerlegt werden kann. Vor der aktuellen Teilung sind die Teile nicht individuiert. Ein Quantenfeld "besteht" daher als Ganzes aus ununterscheidbaren Feldquanten." (Vgl. diesbezüglich vorne die Kritik zu Lyres Oszillation zwischen einer Konstitution und Konstruktion der Natur durch das Subjekt und der Rezeption "objektiver" Daten aus dem "Ding an sich" (intermediärer Strukturenrealismus).
Wir erinnern uns, Weizsäcker spricht von: Uren, als logischen Atomen, ein einziges Ur sei bereits Darstellung des gesamten Kosmos, die binäre Alternativen, Ur-Alternativen repräsentieren den Informationsgehalt einer möglichen Ja-Nein-Entrscheidung, also 1 bit quantentheoretisch behandelte potentielle Information.
Vorerst ist nicht von Teilchen in Raum und Zeit die Rede. Die binären Alternativen, aus denen die Zustandsräume der Quantentheorie aufgebaut werden können, nennen wir Ur-Alternativen, die in Linie a1(1) enthalten sind. Das der Ur-Alterntive a1(1) zugeordnete Subobjekt nennen wir Ur, welches alle inneren Gliederungen in a1(1) umfasst. Die Ur-Alternative repräsentiert den Informationsgehalt einer möglichen Ja-Nein-Entscheidung, also 1 bit quantentheoretisch behandelte potentielle Information. Wir sehen, dass sich erst IN der Linie a1(1) in der ersten inneren Gliederung, nämlich in der Linie a1(2) kategorial die Ja-Nein-Entscheidung mit unendlich vielen Varianten der ersten binären Teilung ergibt. An der Linie a1(1) ist diese Gegenheit ja/nein noch nicht gegeben und nicht erkennbar.
Man kann zwar sagen, dass die Linie a1(2) schon potentiell in der Linie a1(1) als Möglichkeit enthalten sei, das gilt aber für alle weiteren inneren Differenzierungen auch!
Das logische Atom, das Ur, besitzt (noch vor Raum und Zeit) Symmetrieeigenschaften der universalen Symmetriegruppe SU(2), die wir als in der Linie a1(2) integriert denken. Zwischen dem Kosmos, der aus der endlichen Zahl von Uren besteht (in unserer Zeichnung endlich viele Linien a1 aneinandergereiht, und dem einzelnen Ur besteht nun ein Zusammenhang, den Lyre folgend beschreibt: "Der informationstheoretische Atomismus erlaubt nun durch folgende Überlegung einen Zusammenhang zu der in Raum und Zeit vorfindbaren Welt: ein Tensorprodukt aus Quantenbits ist invariant unter der Transformation aller Quantenbits mit einem Element der zweidimensionalen unitären Gruppe SU(2), welche eben die wesentliche Invarianzgruppe des Quantenbit-HILBERTraums ist (der isomorph zum c2 ist). Die wesentlichen Symmetrieeigenschaften unserer im Ortsraum befindlichen Welt sind umgekehrt gerade die Raumsymmetrien. Die SU(2) ist nun nicht nur lokal isomorph zur dreidimensionalen räumlichen Drehgruppe SO(3), sie ist selber topologisch ein dreidimensionaler sphärisch gekrümmter Raum S3. Dieser Raum kann als Näherungsmodell unseres Kosmos selbst angesehen werden. Die SU(2) ist der globale Raum und die in diesem Raum vorfindbaren Objekte können quantentheoretisch aus Quantenbits, mit dieser Interpretation sogenannten Ur-Alternativen (kurz (Ure) aufgebaut werden."
Die Teilung der Linie a1(2.1) in zwei gleiche Hälften soll hier ausreichen, um die Vielzahl der logischen Symmetrien zu repräsentieren, die hier von Lyre intendiert sind. Seine These, dass der Raum offen finit, und nur potentiell unendlich sei, wird darstellbar, indem wir uns vorstellen, dass etwa 10120 Linien a1 aneinandergereiht werden, wobei für das Verhältnis der Gesamtheit aller endlichvielen a1 zum einzelnen a1 durch die obigen Relationen Lyres bestimmt wären.
In der Linie a1(3) ist nun das raum-zeitliche "Objekt" der AQT , in seiner mit den üblichen Sprachschemen nicht beschreibbaren Form (Welle-Teilchen, Partikel als Energie-Impuls-Paket, usw.) anzusetzen. Aus der Potentialität des logischen Atoms, dem Ur, wird in die Faktizität übergangen, wobei aber die bekannte begriffliche Unschärfe bestehen bleibt. Auf der Linie a1(3) lassen sich sowohl Wellenfunktionen , als auch Partikel, als auch "Überlagerungen" darstellen. Die Zeit und der Raum kommen ins Spiel. IN der Linie a1(3) schnellt ein Punkt (mit Länge 0) rhythmisch hin und her, oder bewegen sich Teilstrecken (x1), (x2), (x3) usw.
Das physikalische "Objekt" in der AQT ist also die Summe des im Aufbau der Linien a1(1)(2)(3) dargestellten Gliederung nach innen. Die gesamte Struktur wird noch durchsichtiger, wenn man sie in Kreisen darstellt, was bei den Karidoniern natürlich nicht möglich ist.
In diesem Aufbau und Verhältnis zwischen Ganzen und Teilen (Teil-Ganze-Problematik), die auch nach der Teilung miteinander verbunden bleiben, sieht Lyre, wie oben gezeigt, in der AQT im Verhältnis zum zur klassischen Physik einen wesentlichen Unterschied. Im klassischen dreidimensionalen Ortsraum ist die Bedingung, dafür, dass zwei Objekte tatsächlich voneinander isoliert sind, der empirische Nachweis, sie an getrennten Orten im Raum zu finden. Ein durch einen HILBERTraum dargestelltes Objekt lässt sich nicht a priori eindeutig in Teilobjekte d.h. Teilräume zerlegen. Zweitens ist die Zerlegung von der Art, dass die Teile auch nach der Zerlegung in Beziehung zueinander stehen. Korrelationen zwischen den Teilobjekten bleiben bestehen.[42] Das Schema der Kreise ist in der Lage, Lyres Korrelationen zu repräsentieren. Viele der Zusammenhänge im Kreisschema werden bei Weizsäcker übrigens noch gar nicht sauber erkannt. Doch hierauf wollen wir im folgenden genauer eingehen.
Da in Karidonien schon eine neue Ontologie, Logik und Mathematik angewendet werden, wurde die These des karidonischen Weizsäckers folgend kritisch behandelt.
Der erste wichtige Einwand besteht darin, dass der gesamte Aufbau der AQT von einem logischen Atomismus ausgeht, der eine unendlich-endliche Ur-Einheit, das Ur, (die Linie a1) annimmt und von dieser ausgehend eine kosmische Summe und Gesamtheit der Natur postuliert, die über einen HILBERTraum und Symmetriebedingungen mit dem "ersten" Ur verbunden sind (Ganze-Teil-Problem). In Karidonien ging man jedoch bereits in der kategorialen, ontologischen, epistemologischen, logischen und mathematischen Behandlung der Natur und ihrer Teile von neuen Grundlagen aus. Basis der Naturphilosophie bildet die folgende Ableitung, die von der unendlichen und nach innen unbedingten Linie 0 ausgeht.[43] In dieser findet sich dann erst in einer sehr abgeleiteten inneren Stufe die Linie a1, das Quantenbit.
Im Rahmen der Deduktion ist vor allem wichtig, dass in der unendlichen und nach innen unbedingten Linie (L0 1), in der ersten In-Abstufe sich die beiden ebenfalls noch unendlichen Linien i und e befinden (L0 2). Das vom karidonischen Weizsäcker postulierte Ur kann nun, nach der Logik der geraden Linie nur in der Linie e liegen[44]! Hier liegt eine beachtliche Neuerung vor, die vor allem in der Frage der Möglichkeit der quantentheoretischen Naturalisierung des erkennenden Subjektes völlig andere Ergebnisse bringt, als in den hier des öfteren erwähnten Erkenntnistheorien.
Im weiteren zeigt sich, dass zwischen dem unendlichen Glied e und der unendlich-endlichen Glied a1 in dieser Ableitung andere Beziehungen bestehen, als bei Lyre (Ganze-Teil-Relation). Bei Lyre entspricht die Beziehung zwischen Gesamt-Natur und Einzel-Ur jener zwischen einer Linie, die aus 10120 Uren besteht und dem Einzel-Ur a1, also einer zwar sehr großen aber endlichen Strecke 10120x a1 zu a1. Die Ganze-Teil-Relation erweist sich aber in der neunen karidonischen Kategorialität völlig anders. Die Linie e, die (Or-Natur) ist nicht endlich lange, sondern unendlich lange. Die Natur ist also nicht endlich sondern unendlich als Eine, selbe, ganze Natur. Erst IN sich ist die unendlich lange Linie e (die unendliche Natur) unendlich viele Inglieder, beidseitig endliche Linien a1 bis a∞. Allein dieses Faktum hat weitreichende Folgen. Die Annahme eines einmaligen Entstehens des Kosmos, der Natur in einem Big Bang erweist sich als irrig. Die Natur erzeugt in jedem "Augenblick" unendlich viele Welten mit unendlich vielen Teilen in sich, die alle im karidonischen Modell auf der Linie e Platz haben. Die Natur ist aber nicht das einzige unendliche Wesen in unter der unendlichen und unbedingten Linie O (der unendlichen und unbedingten Wesenheit Gottes), sondern neben ihr gibt es noch die unendliche Linie i (das Geistwesen). Was nun die inhaltliche (sematische) Beziehung zwischen der ganzen Natur und ihren Teilen (Linie e zu a1) betrifft, sie zeigt sich, dass der Teil a1 immer, auch nach seiner Individuierung in e sowohl mit der Or-Linie O als auch mit der Linie e in ontischer und logischer Verbindung bleibt. Er hat also weiterhin teil an den Grundkategorien der Linie O wie auch an den spezifischen Eigenschaften der Linie e (der Natur) die in ihren Eigenschaften durch die Gegenähnlichkeit zum Geistwesen durch und durch bestimmt ist (Überwiegen der Ganzheit über die Selbheit). Alle Kategorien, die von der Linie O gelten, und die für die Linie e gelten, gelten auch für die Linie a1.In anderer Weise als bei Weizsäcker gilt also, dass ein einziges Ur eine Darstellung des gesamten Kosmos sei. Das muss aber derart interpretiert werden, dass die unendlichen Ganzen die ontische und logische Kategorialisierung der Teile deduktiv bestimmen, und der endliche Teil die kategorialen Eigenschaften nur in der ihm als Teil zukommenden Bestimmtheit besitzt.[45] Für die Entwicklung der Kategorie der Zeit (bei Lyre als neues Apriori) ist schon leicht im karidonischen Modell ersichtlich, dass es keinen Sinn hätte, eine Zeitlichkeit der Linie O anzunehmen (vgl. oben die Grundwissenschaft) . AN einer unendlich langen Linie kann keine "Änderung" stattfinden.[46] Gott als Or-Wesen hat nicht die Form der Zeit an sich. Aber auch für die Linie e gilt noch, dass sie unendlich ist, und auch für sie gilt daher nicht die Form der Zeit. Wohl aber gilt die Form der Zeit für die beidseitig begrenzte Linie a1 und zwar doppelt. Einerseits ist sie als Ur IN sich in dauernder Veränderung begriffen, andererseits kann sich die Linie a1 gegenüber anderen endlichen Linien a2, bis a∞ in ihrer Position verändern. Im karidonischen Modell gilt nicht der offene Finitismus an Teilen des Kosmos, sondern ein offener Infinitismus, der eine aktual unendliche Zeitkategorie zur Folge hat. Ebenso gilt, dass der karidonische Raumbegriff, schon für diese Linie O nicht nur in einem potentiellen Sinne sondern aktual unendlich sein muss. Es ist im übrigen allein schon ein Problem der traditionellen Mathematik, die Potentialität (Möglichkeit) einer infiniten Fortsetzung endlicher Raumeinheiten zu erlauben, ohne zu fragen, wie das möglich sein sollte. Die infinite Fortsetzung der Möglichkeit nach setzt ja voraus, dass der Raum nicht irgendwo eine Grenze hat, also nur eine Aktual-Unendlichkeit kann der Garant dafür sein, dass man im Potentiell-Unendlichen nicht an "eine Grenze stößt".
Wir versuchten soeben, zwei intuitiv gewonnene physikalische Ansätze in ihrer Verbindung zu den deduktiven Grundlagen der Wesenlehre zu bringen und damit eine konstruktive Weiterbildung der beiden anzuregen.
Abschließend möge hier die ontische, logische, semantische und mathematische Struktur der Naturphilosophie zusammengefasst werden, die für eine Evolution der derzeitigen physikalischen Theorien und deren Vereinheitlichung herangezogen werden könnte.
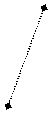
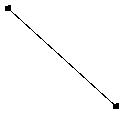
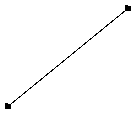
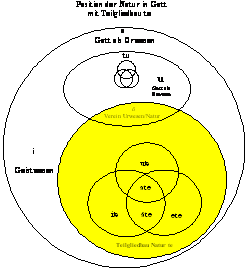
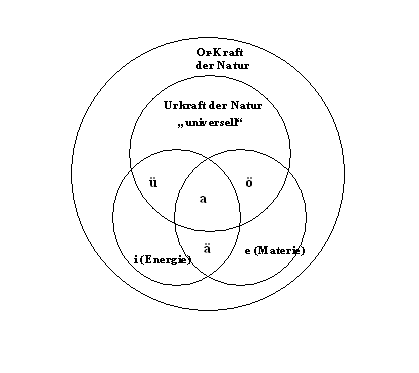
|
Vermittlerteilchen der Kräfte Kraftüberträger Wechselwirkungsteilchen, Austauschteilchen
ganzzahliger Spin (Spin 1)
Alle relevanten Wechselwirkungen (WW) werden durch den Austausch von Bosonen mit Spin 1 beschrieben. a) Photon= Austauschteilchen der el.magn. WW b) 8 Gluonen=vermittelt die starke WW c) 3 schwache Bosonen W+, W- und Z sind die Austauschteilchen der schwachen WW |
Bausteine der Materie, Elementarteilchen Materie-Teilchen
½ zahliger Spin (Spin-1/2 Teilchen) 1. Gruppe: Leptonen
a) masselose Neutrinos mit Ladung 0; nehmen ausschließlich an der schwachen WW teil. b) Elektron, Myon und Tauon mit Ladung –1, die sich in ihrer Masse unterscheiden; können sowohl schwach als auch el.magn. wechselwirken. 2. Gruppe: Quarks Entsprechend den Leptonen gibt es 6 unterschiedliche Quarks oder flavours. Die Quarks haben drittelzahlige Ladung. Sie können zusätzlich stark wechselwirken. |
Die Vereinheitlichte Theorie
Für die Erarbeitung der Vereinheitlichten Theorie, welche die zeitgenössischen inkompatiblen Basistheorien zusammenführen sollte, wären die oben nur skizzierten deduktiven Grundlagen der Naturwissenschaft mit den intuitiven Theorien der Moderne (RT, QP, STT, VT usw.) in einer Konstruktion zu vereinigen.
|
(At 01) |
Atmansbacher/Römer/Walach: Weak Quantum Theory: Complementarity and Entanglement in Physics and Beyond. Foundations of Physics. 2001 |
|
(Ap 73) |
Apel: Transformation der Philosophie. Frankfurt am Main 1973. |
|
(Ap 96) |
Apel/Kettner(Hg.): Die eine Vernunft und die vielen Rationalitäten. Frankfurt am Main 1996. |
|
Be 02) |
Benioff: Towards a Coherent Theory of Physics and Mathematics. Foundations of Physics. 2002 |
|
(Ca 03) |
Castagnino/Lombardi/Lara: The Global Arrow of Time as a Geometrical Property of the Universe. 2003 |
|
(Eb 88) |
Ebeling: Gehirn, Sprache, Computer. 1988 |
|
(Gr 03) |
Greene: Das elegante Universum.2003 |
|
(He 69) |
Heisenberg. Der Teil und das Ganze. 1969 |
|
(Ka 79) |
Kanitschneider: Philososphie und moderne Physik. 197 |
|
(Ka 91) |
Kanitschneider: Kosmologie. Geschichte und Systematik in philosophischer Perspektive. 1991 |
|
(Ka 96) |
Kanitschneider: Im Inneren der Natur. Philosophie und moderne Physik. 1996 |
|
(Ka 03) |
Kantorovich:The priority of internal symmetries in particle physics. 2003 |
|
(Kr 28) |
Krause: Vorlesungen über das System der Philosophie. 1828 und 1981 |
|
(Kr 84) |
Krause: Vorlesungen über Synthetische Logik. 1884 |
|
(Ly 94) |
Lyre: The Quantum Theory of Ur-Objects as a Theory of Informatin. 1994 |
|
(Ly 96) |
Lyre: Quantum Space-Time an Tetrads. 1996 |
|
(Ly 97) |
Lyre: Der Naturbegriff im Lichte der Quantentheorie. http://www.lyre.de/nlq.pdf . 1997 |
|
(Ly 98) |
Lyre: Quantentheorie der Information. 1998 |
|
(Ly 99) |
Lyre: Zur apriorischen Begründbarkeit von Information. http://www.lyre.de/dkp18.pdf . 1999 |
|
(Ly 00) |
Lyre: Kann moderne Physik a priori begründbar sein? |
|
(Ly 02) |
Lyre: Möglichkeiten und Grenzen des wissenschaftlichen Realismus. |
|
(Ly 02a) |
Zum Weizsäckerschen Weltbild der Physik. 2002 |
|
(Ly 03) |
Lyre: Einblick in die Philosophie der Physik. http://www.pro-physik.de/Phy/External/PhyH/1,,2-9206-01-phy_news-00,00.html . 2003 |
|
(Ly 04) |
Informationsbegriff und Quantentheorie der Ur-Alternativen. 2004. |
|
(Ly 04a) |
Lyre: Lokale Symmetrien und Wirklichkeit. 2004 |
|
(Mi 89) |
Mittelstaedt: Philosophische Probleme der modernen Physik. 1989 |
|
(Mi 00) |
Mittelstaedt: Universell und inkonsistent. Quantenmechanik am Ende des 20. Jahrhunderts. 2000 |
|
(Mo 02) |
Morrison: The one and the many. The search for unity in a world of diversity. Studies in History and Philosophy of Modern Physics. 2002 |
|
(Pe 90) |
Penrose: Die Debatte um künstliche Intelligenz, Bewusstsein und die Gesetze der Physik. 1990 |
|
(Pl 03) |
Plotnitsky: Mysteries without Mysticism and Correlations without Correlata: On Quantum Knowledge and Knowledge in General. Foundations of Physics. 2003 |
|
(Ste 57) |
Stegmüller: Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik. 1997 |
|
(Ste 59) |
Stegmüller: Unvollständigkeit und Unentscheidbarkeit. Die metamathematischen Resultate von Gödel, Church, Kleene, Rosser und ihre erkenntnistheoretische Bedeutung. 1959 |
|
(Ste 02) |
Stefanovich: Is Minkowski Space-Time Compatible with Quantum Mechanics? Foundations of Physics. 2002 |
|
(Sv 02) |
Svozil: Conventions in Relativity Theory and Quantum Mechanics. Foundations of Physics. 2002 |
|
(To 02) |
Tomiska: Moderne Einführung in die Quantentheorien. 2002 |
|
(Wa 90) |
Waldenfels: Der Stachel des Fremden. 1990 |
|
(We 95) |
Welsch: Vernunft. 1995 |
|
(We 96) |
Welsch: Vernunft und Übergang. 1996 |
|
|
|
|
|
|
krwesphys.doc
[1] Auch (Ka 79, S. 3 f.) enthält folgende ähnliche Überlegungen: "Aber die Aspekthaftigkeit der Erkenntnis bedingt keineswegs notwendig eine residuale Irrationalität und ebenso wenig besitzt die Natur deshalb irgendeine Art von innerer Undurchsichtigkeit ("opaqueness"). (...) ebenso ist es möglich, aus den (hypothetischen) Wissen über die Erkenntnisapparatur und der Kenntnis der Wechselwirkung von materialem und informationsnehmenden System bei Vorliegen einer Klasse von Phänomenen jene invariante Größe zu rekonstruieren, die die gleichbleibende Ursache aller verschiedenen Projektionsphänomen ist. Diese Betrachtung der Erkenntnis als Projektion setzt die Auffassung voraus, dass das erkennende System mit seiner Umgebung in einer Wechselwirkungsbeziehung steht, dass also das kognitiv agierende Bewusstsein, die intendierte Objektklasse und der Übertragungsmechanismus ontologisch gleichrangig sind. Dieser projektive Erkenntnisbegriff ist nicht übertragbar auf die idealistische Konzeption, wonach das Bewusstsein alle seine Inhalte selbst erzeugt, somit die Phänomene Bausteine der Erkenntnis ("rock bottom of knowledge") sind, und nicht Wechselwirkungserscheinungen eines späten Evolutionszustandes der organischen Materie mit ihrer Umgebung."
[2] Bitte hier das file "Doppelspaltexperiment" mittels eines Links einfügen.
[3] (Ly 04, S. 144.) "Der auf Hugo Dingler und Paul Lorenzen zurückgehende Erlanger Konstruktivismus und speziell die Protophysik des Raumes übernimmt eine Kantische Argumentationsfigur, insofern die Naturgesetze als Bedingungen der Möglichkeit apparateabhängiger und experimenteller Erfahrung angesehen werden ("messtheoretisches Apriori" Lorenzen)." Es zeigt sich also, dass wir hier in eine äußerst schwierige und heftig umstrittene Frage einsteigen, die wir auch später bei den verschiedenen Theorien des Raumes wieder aufgreifen werden.
[4] Wie wir später sehen werden, versucht Lyre die Spannung zwischen der Welt der klassischen Meßapparate und der Welt der Quantensysteme durch eine zirkulär dynamische Auffassung des Apriori-Problems zu lösen, welche auf Weizsäcker zurückgeht. Hierzu schreibt (Ly 02, S. 3):" Der Kopenhagener Interpratation wird in diesem Zumsammenhang häufig die Vorhaltung gemacht, das Messproblem unter ontologischer Inanspruchnahme der klassichen Physik lösen zu wollen, d.h. die Welt willkürlich in den Seinsbereich der Quantensysteme und der klassischen Messapparate zu trennen (wobei zudem die Grenze zwischen beiden undefinierbar ist). Mag dies etwa für Bohrs Position zutreffend gewesen sein, so macht Weizsäcker deutlich, dass er die klassische Physik nur als ein "methodisches Apriori" zur Quantenmechanik auffassen möchte, dass aber das inhaltliche – und damit eben auch das ontologische – Verhältnis gerade umgekehrt ist. 'In diesem spezifischen Sinn erklärt also die Erkenntnis a posteriori nachträglich erst, was in der Erkenntnis a priori schon vorausgesetzt war. Es ist ein Fehler vieler erkenntnistheoretischer Ansätze, diesen fruchtbaren Zirkel aller Erkenntnis nicht beachtet zu haben.' Es ist eben dieser Erkenntniszirkel, der zu einem Leitmotiv des Weizsäckerschen Denkens geworden ist. (...) Der Kreisgang ist der Versuch, die Beschreibung der Welt und des Menschen als Objekte empirischer Wissenschaft in Einklang zu bringen mit der transzendentalphilosophischen Reflexion auf die methodischen Vorbedingungen der Möglichkeit des Unternehmens".
[5] Hier bitte das beiliegende File "Zeitbegriff.doc" mittels eines Links einfügen.
[6] Zum Problem einer übergeordneten "cosmic time",in der die "proper times" aller Partikel des Universums koordiniert werden können, zwei Bedeutungen des Zeitbegriffes für einen "atemporal standpoint" usw. siehe etwa (Ca 03).
[7] Ähnlich etwa auch (Ka 03, S.672): "Thus contemporary particle physics operates in a dual reality consisting of two worlds: (1) The physical world (…) (2) The Platonic world, that is occupied by an abstract structure that governs the behavior and content of physical world."
[8] Vgl.: hierzu den Aufsatz (Be 02, S. 989 f.) über den Versuch der Bildung einer kohärenten Theorie für Physik und Mathematik. Aus den Ableitungen der Grundwissenschaft ergibt sich diesbezüglich, dass die Kategorien der Mathematik göttliche Kategorien sind, die auf alles, daher u.a auch auf die Natur und alles Endliche in ihr anzuwenden sind, wenn die Naturwissenschaft (darin auch die Physik) inhaltlich adäquat vorgehen will. Andererseits zeigt sich, dass die Natur eines der beiden noch unendlichen Grundwesen in Gott ist, dessen inhaltliche Bestimmung, Qualität usw. durch das Verhältnis zu Geistwesen einerseits, und zu Gott als Urwesen andererseits kategorial bestimmt ist und bestimmt werden soll. Eine Gleichsetzung von Mathemtik und Physik ist daher kategorial (sachlich, informationstheoretisch, semantisch usw.) und ontologisch nicht zulässig!
[9] Eine gründliche Kritik der Postmoderne kann hier nicht erfolgen. Siehe aber u. a. http://or-om.org.postpostmoderne.htm/.
[10] Diese und alle folgenden Hervorhebungen durch den Autor.
[11] Wie schon vorne erwähnt, erstellt (Ka 79, S. 33 f.) eine differenziertere Systematik der beiden Schultypen. Die idealistischen Standpunkte umfassen: Instrumentalismus, Operationalismus, Phänomenalismus und Konventionalismus; die realistischen Standpunkte umfassen naiven, kritischen, hypothetischen, strukturalen und repräsentativen Realismus. Hier können die Unterschiede nicht ausgeführt und noch weniger kritisch analysiert werden. Es zeigt sich jedoch auch hier eine typisch "postmoderne" Situation der inkompatibelen Ausdifferenzierung von Standpunkten, wobei aber Kanitschneider selbst das Erkenntnisziel synthetischer Philosophie (Aufbau eines integrierten Weltbildes) unter Abgrenzung zur Metaphysik als erstrebenswert ansieht, während andere Physiker dies strikte ablehnen. Er selbst vertritt übrigens eine Auffassung der Erkenntnis als Wechselwirkung, eine Position, die "im Dienste einer naturalistischen Weltsicht steht, da hier von einem hypothetisch angenommenen aussenstehenden Stadpunkt (den einzunehmen man im Prinzip niemanden logisch zwingen kann) eine Rekonstruktion der kognitiven Arbeit des Subjektes angestrebt wird, die dessen anfänglich ausgezeichnete Position homogen in die Gesamtrealität einordnet."
[12] Bereits bei (He 69, S. 173) findet sich der Satz: "Aber man muß sich doch gleichzeitig vor Augen halten, dass sich mit der historischen Entwicklung auch die Struktur des menschlichen Denkens ändert."
[13] Vgl. oben die Überlegungen bez. Erkenntnisschulen (2).
[14] Vgl. oben "Erkenntnisschulen (2)".
[15] Insbesondere (19) und (38).
[16] Eine gründliche Ausführung findet sich in den "Vorlesungen über das System der Philosophie" (19, S. 208 ff.) und (Pf 90, S. 102 ff.), wo dieser Erkenntnisschritt ebenfalls ausführlich dargestellt ist.
[17] (19, 2. Teil) bzw. Werk (69, 2. Teil).
[18] Wenn also Einstein fragte,was Gott vor dem "Urknall" dachte, liegt hier der "höchste" Gedanke oder die "unhintergehbare" Basis der göttlichen (Selbst)-Erkenntnis. Wie Gott alles an und in sich nach allen Arten der Erkenntnis erkennt, wird in der Synthetischen Logik ausgeführt.
[19] An anderer Stelle, die wir später nochmals benützen, gibt aber auch Lyre zu, dass diese Frage völlig offen bleiben muß: "Zweifelsohne gehört die Frage nach der Natur des Kontinuums mit zu den schwierigsten philosophischen Grundfragen der Mathematik und Physik. Wir verweisen auf die Auffassung Aristoteles, das Kontinuum als dasjenige anzusehen, was in wieder kontinuierliche Teile teilbar ist. Unsere Vermutung wäre, dass wir dieser Auffassung, die eben vom Unendlichen im Sinne potentieller, nicht aktueller Information ausgeht, konzeptionell ernsthaft folgen müssen. Bei der Umsetzung im Rahmen der Physik sollte dann zusätzlich die Quantentheorie ins Spiel kommen. Wie sich dies aber formal angemessen ausdrücken lässt, ist bislang das große ungelöste Rätsel."
[20] Hinsischtlich der Probleme der Naturalisierung des Bewusstseins nimmt Lyre eine kritische Haltung ein. Vgl.:auch unsere Arbeit: http://or-om.org/filmrot.htm "Sieht ihr Film rot auf rot? oder: Der Riese Polyphem in der Bewusstseinstheorie".
[21] Vgl. etwa auch (28, S. 502 und 505 f.).
[22] Derzeit wäre auch noch die Variante einzufügen, dass Gott und Geist überhaupt nur als Natur, oder Materieprodukte interpretiert werden.
[23] In (Ka 96, S. 128 f.) behandelt Kanitschneider die Möglichkeit einer Verbindung von Übernatur und Naturwissenschaft. Es gibt kein sicheres Wissen, selbst die Fallibilitätsthese ist selbstanwendbar, "denn es ist nicht einmal erweisbar, dass sie unbezweifelbar gilt." Wohl aber sei die methodologische These, dass es kein sicheres Wissen geben kann, durch logische Analyse der Verfahren der Wissensgewinnung hervorgebracht worden. Die dabei verwendete Logik sei nicht spezfisch natural über supernatural, sie ist wie alle Logik ontologisch neutral. Gerade hier liegt ein gewaltiger Irrtum verankert. Eben eine solche ontologisch neutrale Logik ist als "sicheres Werkzeug" gefährlich und behindert den Durchbruch zu einer ontologisch begründeten Inhaltslogik im hier dargestellten Sinn. Die neue synthetische Logik öffnet dann auch die neue Verbindung von göttlicher und naturaler Ebene. Wenn (Ka 96, S.181) weiter meint, der universelle Fallibilismus lege eine von Grund auf nicht auf Hegemonie angelegte Weltorientierung nahe, dann ist aus hiesieger Sicht zu sagen, dass gerade dieser Fallibilismus selbst zu einem inadäquaten Instrument von inhumaner Herrschaft werden kann.
[24] Hier erhebt sich bereits die wichtige Frage: Kann dieses Denkgesetz auch in der Physik für Objekte der Feldontologie, manifester Nicht-Lokalität gelten, welche die Unmöglichkeit der Individuation an Raum-Zeit-Stellen aufzeigen, wo jede traditionelle Gegestandsontologie aufhört, wie dies etwa Lyre in (Ly 04, S. 185) aufzeigt?
Aus Sicht der Wesenlehre ist festzuhalten, dass die traditionelle Gegenstandsontologie, wie wir zeigten, in mehrfacher Hinsicht mangelhaft ist, da die deduktive Erkenntnis aller Gegenstände der Wissenschaft eigentlich noch fehlt. Erst durch die Verankerung der Gegenstandsontologie in unter der unendlichen und unbedingten Ontologie Gottes werden hier die adäquaten Relationen hergestellt. Gegenstände in der Natur könnten daher nur im Rahmen der Erkenntnis der Ontologie der unendlichen Natur in Gott adäquat erkannt werden. Weiters fehlt in der modernen Physik die Unterscheidung der Seinsarten eines jeden Gegenstandes: Wir unterscheiden bekanntlich Orseinheit, Urseinheit und darin und darunter Ewigsein und Zeitlichsein. Schließlich ergibt sich daraus auch eine andere Erkenntnis der Kategorien der Zeit und des Raumes. Die endlichen Gegenstände sind nicht IN Zeit und IN Raum, sondern sie haben, als sich ändernde nur die formalen Eigenschaften der Zeitlichkeit und Räumlichkeit IN sich, die für sie aber nicht ontologisch konstitutiv wirken. Die endlichen Gegenstände werden daher in den als endlich erkannten Kategorien des Raumes und der Zeit in der modernen Physik ohnehin ontologisch mangelhaft erkannt. Der Begriff der "Unmöglichkeit der Individuation an Raum-Zeit-Stellen" verliert daher in diesem neuen System völlig seine bisherige Bedeutung. Schließlich ist zu bedenken, dass besonders die genaue Relation zwischen dem ersten, zweiten und dritten Denkgesetz der modernen Physik sicher sehr helfen könnte, in diesen heiklen Fragen mehr Klarheit zu gewinnen. Gerade in diesen schon inneren Kraftverhältnissen der Felder ist natürlich eine genau Beachtung der Spannung der Gegenheit zur darüber befindlichen Einheit zu beachten sowie die relativen Balancen, die vor allem im dritten Denkegesetz mit dem ersten wiederum verbunden werden.
[25] Nun fügt Kanitschneider eine Fußnote an, die sogar auf Krause Bezug nimmt: "Ähnlichkeiten mit Friedrich Krauses Panentheismus sind zweifellos festzustellen. Krauses Variante des Panentheismus besagt, dass Gott eine innerweltliche Existenz besitzt, dennoch aber die Welt überragt."
[26] Kanitschneider schreibt in (Ka 96, S.62): Man muß wohl die Existenz dieser kaum zu vertreibenden Singularitäten als Anzeichen für die Geltungsgrenze der Allgemeinen Relativitätstheorie sowie deren Voraussetzung der Mannigfaltigkeitsstruktur der Raumzeit werten. Es ist nicht zu erwarten, dass unser Bild einer kontinuierlichen, glatten Raumzeit-Mannigfaltigkeit bis in beliebig kleine Bereiche extrapolierbar ist. Ab S. 170 erwähnt Kanitschneider auch Ansätze singularitätsfreier Modelle, in denen das Universum ein unendliches Alter besitzt. "In solchen Welten ist das Anfangsproblem nicht definiert und damit der Gegensatz von Entstehung und Schöpfung nicht gegeben." (z.B. José Senovilla ein inhomogenes relativistisches Modell ohne Anfangssingularität, Wolfgang Prister und Hans-Joachim Blome ein zeitlich unendliches Modell (die Entstehung der Materie wird von der Entstehung der Raum-Zeit getrennt. Raum und Zeit existieren danach seit ewigen Zeiten. Das teilchenfreie Vakuum ist die seit der unendlichen Vergangenheit vorhandene primordiale Existenzweise der Welt.) Weiters gibt es quantenksomologische Modelle in vollständigen Theorien, in denen die Zeit nicht mehr vorkommt, mit ihnen lässt sich daher ein Schöpfungsprozess nicht kombinieren. "Instaed of talking the universe as being created, and maybe coming to an end, one should just say: The universe is" (S. W. Hawking). Da die relativistische Kosmologie auf Grund ihrer Singularitäten eine unvollständige Theorie ist, versucht man sie in der Quantenkosmologie durch Modelle zu ersetzen, die mit der absoluten Entstehung des Universums ohne irgendwelche raumzeitlichen oder stofflichen Vorgaben Ernst machen (z.B. Ansatz von Alexander Vilenkin, wonach das Universum "aus dem Nichts" entstanden ist).
[27] Offensichtlich wird aber hier angenommen, dass der Körper IM Raum ist und nicht wie in der Wesenlehre, dass der Körper die Räumlichkeit in sich hat.
[28] "Das Phänomen der Händigkeit erfährt in den heutigen naturwissenschaftlichen Fachsprachen vielfältigen Niederschlag. Eng verwandt oder gar synonym sind etwa die Begriffe Pariät, Chiralität, Spiralität, Helizität, Dissymmetrie oder Enantiomorphie, Enantiomerie oder optische Isomerie" (Ly 04, S. 27).
[29] Alle Kursivstellungen im Zitat durch S.P.
[30] Wie wir später sehen werden, versucht Lyre die Spannung zwischen der Welt der klassischen Meßapparate und der Welt der Quantensysteme durch eine zirkulär dynamische Auffassung des Apriori-Problems zu lösen, welche auf Weizsäcker zurückgeht. Hierzu schreibt (Ly 02, S. 3):" Der Kopenhagener Interpratation wird in diesem Zusammenhang häufig die Vorhaltung gemacht, das Messproblem unter ontologischer Inanspruchnahme der klassichen Physik lösen zu wollen, d.h. die Welt willkürlich in den Seinsbereich der Quantensysteme und der klassischen Messapparate zu trennen (wobei zudem die Grenze zwischen beiden undefinierbar ist). Mag dies etwa für Bohrs Position zutreffend gewesen sein, so macht Weizsäcker deutlich, dass er die klassische Physik nur als ein "methodisches Apriori" zur Quantenmechanik auffassen möchte, dass aber das inhaltliche – und damit eben auch das ontologische – Verhältnis gerade umgekehrt ist. 'In diesem spezifischen Sinn erklärt also die Erkenntnis a posteriori nachträglich erst, was in der Erkenntnis a priori schon vorausgesetzt war. Es ist ein Fehler vieler erkenntnistheoretischer Ansätze, diesen fruchtbaren Zirkel aller Erkenntnis nicht beachtet zu haben.' Es ist eben dieser Erkenntniszirkel, der zu einem Leitmotiv des Weizsäckerschen Denkens geworden ist. (...) Der Kreisgang ist der Versuch, die Beschreibung der Welt und des Menschen als Objekte empirischer Wissenschaft in Einklang zu bringen mit der transzendentalphilosophischen Reflexion auf die methodischen Vorbedingungen der Möglichkeit des Unternehmens".
[31] Wenn er (Ze 03, 216) meint, die Naturgesetze dürften keinen Unterschied machen zwischen Wirklichkeit und Information, dann meint er damit wohl: Wir haben es immer nur mit unseren Informationen über die "unzugängliche Wirklichkeit" zu tun, eine echte Relation zur "Wirklichkeit" können wir nicht herstellen, daher können wir unsere Information, unsere Konstruktion der Wirklichkeit, mit der "Wirklichkeit" gleichsetzen.
[32] Der Versuch Kanitschneiders (Ka 79, S. 184) diese Position eher intolerant zu desavouieren, erscheint nicht zielführend. Er schreibt in einem Kapitel über Zeitreisen und Selbstbewußtsein: "Zwar wird der Transzendentalist dann in einer tu-quoque-Wendung abermals behaupten, dass der eben gesagte Zusammenhang eine Erkenntnis ist, die überhaupt nur unter der Voraussetzung der transzendentalen Einheit der Apperzeption wachsen konnte, aber dies zeigt nur umso stärker, dass es sich beim transzendentalen Ansatz generell um eine unwiderlegbare Position handelt, in der gleichen Weise, wie ein kosequenter Psychonalytiker auf jeden Angriff gegen seine geliebte Theorie damit reagiert, dass er dem Kritiker eine besonders starke Neurose attestiert." Nochmals: wir verteten hier nicht den transzendentalen Ansatz, wir betonen aber, dass eine Pointe desselben, nämlich die starkte innersubjektive Konstruktion dessen, was wir als Wirklichkeit bezeichen und betrachten unbedingt beachtet werden muß. Wir sagen dann im weiteren: wenn wir über diese Position, wie auch über die realistischen, die beide beachtliche Mängel aufweisen, hinausgelangen können, dann nur dadurch, dass die Essentialistische Wende in der Erkenntnistheorie vollzogen wird, und in eigener subjektiver Evidenz eine undogmatische Metaphysik (Grundwissenschaft, Logik, Mathematik und Naturwissenschaft) begründet werden kann. Wir verlassen daher die Oszillationsbereich der Schultypen (1) bis (3), überschreiten sie und sind in der Lage, ihre jeweiligen Grenzen darzustellen und Möglichkeiten der Überwindung anzuregen.
[33] Dass über den Urgrund begrifflich artikulierbares Wissen, Semantik, Syntax und Pragmatik möglich sind, ist gerade die Pointe unserer Darstellung im Sinne der Wesenlehre.
[34] Fettstellung durch S.P.
Wir wiederholen hier die Frage: Wie steht es nun mit der selbstreferentiellen Konsistenz unserer eigenen Sätze bezogen auf das von uns vorgelegte neue Vernunftkonzept?
Alle Sätze dieser Arbeit gehören dem System der All-Sprache der Grundwissenschaft an, dessen Semantik durch die Erkenntnisse der Grundwissenschaft, dessen Syntax durch die All-Gliederung der Wesenheiten und Wesen an und in dem unendlichen und unbedingten Grundwesen und dessen Pragmatik durch die Endschau der Entwicklung der Menschheit nach der Lebenslehre der Grundwissenschaft bestimmt wird.
Diese Sätze sind so weit systeminvariant gegenüber allen bisherigen Kultur- und Sozialsystemen, dass sie in der Lage sind, Grundlage einer wissenschaftlichen, universellen Rationalität darzustellen, die ihrerseits universelle Prinzipien für Wissenschaft, Kunst und Sozialität im planetaren Sinne bilden kann.
Es kann hier der Einwand vorgebracht werden, das hier als neu festgestellte Grundsystem sei ja nur in unserer üblichen Sprache beschreibbar, setze also eine grüne Systemsprache, unsere Umgangssprache, voraus (pragmatisch-linguistisches Argument), diese Sätze müssten verstanden werden und setzen bereits wieder ein sozial vorgeformtes Sprachverständnis voraus (hermeneutischer Aspekt), kurz, die konsensual-kommunikative Rationalität Apels oder eine andere an der formalen Logik festegemachte Rationalität sei unhintergehbare Bedingung dieser Sätze. Dazu ist zu sagen: Diese Zeilen in einer grünen Systemsprache, einer systemmitbedingten Sprache abgefasst, sind Anleitung und Hinweis, bestimmte bereits nicht mehr der Sprache der jeweiligen Gesellschaft angehörende Erkenntnisse, Gedanken, anzuregen. Diese Sätze sind aber für die Erkenntnisse der Grundwissenschaft nicht konstitutiv und sie bedürfen auch zu ihrer Begründung nicht eines kommunikativen oder gar interkulturellen Konsenses. Wohl aber ist zur Einführung dieser Erkenntnisse erforderlich, dass es gelingt, sie in der Kommunikationsgemeinschaft aller Menschen und darin der theoretischen Physiker über kommunikativ-konsensuale Prozesse bekannt zu machen und die Gesellschaften nach ihren universalen Prinzipien weiterzubilden.
[36] Die LeserInnen werden bemerken, dass der Linien-Kosmos der Karidonier nach den gleichen Kategorien gegliedert ist, wie unter 3. Gott an und in sich (Göttliche Kategorien). Nur handelt es sich bei der Linie 0 um eine im Inneren Gottes befindliche, endliche Einheit, die aber innerhalb ihrer Grenzen selbst noch Unendlichkeit und nach innen Unbedingtheit besitzt.
[37] Allerdings könnten wir so wie in der Stringtheorie argumentieren: die Zwei- und Dreidimensionalität als Zusatzdimensionen des Raumes sind auch in der Linie der Karidonier in jedem Punkt als winzige Zylinder aufgerollt enthalten!
[38] Wenn wir wiederum wie die Stringtheoretiker vorgehen, können wir ohne weiteres sagen: Die Zwei- und Dreidimensionalität des intendierten Hilbertraumes (der kein Anschauungsraum ist) sind auch in der Linie a1 der Karidonier in jedem Punkt als winziger Zylinder aufgerollt.
[39] Genauer müssen wir sagen, "keine In-Grenze ist", denn nach außen hat a1 natürlich eine Grenze gegen alle anderen a1, usw.
[40] Dieses Argument zeigt sehr deutlich einen der wichtigen Gründe, warum die moderne Physik sich folgenden beiden Arten der Unendlichkeit nicht öffnen will: a) der Unendlichkeit des Einen, Ganzen; b) der unendlichen Vielzahl endlicher Glieder in einem unendlichen Ganzen. Damit entstünden nach mancher Ansicht "epistemische Wertlosigkeit" und vor allem "Unkontrollierbarkeit".
[41] Wir fügen hier nochmals den entscheidenden Gedanken Kanitschneiders hinzu, der gleichfalls um diese Frage kreist: "Es macht einen wesentlichen Unterschied aus, ob Materiefelder ( e‾, v, p, n) dem Quantisierungsverfahren unterworfen werden, wobei der Raumzeitrahmen aber seine klassische Gestalt als Arena der materiellen Prozesse behält, oder ob die Raumzeitmannigfaltigeit selber die Quantisierungsprozedur erfährt. Das metrische Feld drückt ja die Struktur der Raumzeit aus, in der sich das physikalische Geschehen abspielt, damit ist im Falle ihrer Quantisierung die räumliche und zeitliche Ordnung der Dinge selber von dem Diskretisierungsvorgang betroffen. Die Geometrie des physikalischen Raumes erhält ein gitterähnliches Muster an Stelle der glatten, stetigen Mannigfaltigkeit. Dies stellt den stärksten Eingriff in die Konstruktionsprinzipien der klassischen Physik dar, den man sich denken kann. Deshalb müsste vermutlich eine neuartige geometrische Struktur gefunden werden, um eine kohärente einheitliche Darstellung von Materiefeldern und Raumzeit zu bewerkstelligen. Diese fundamentale mathematische Struktur ist noch nicht gefunden." Ähnliche Probleme treten auch in den Stringtheorien auf, wie (Gr 03, S. 437 f.) zeigt.
[42] Es liegt mehr an der traditionellen Logik und Mathematik, wie den mangelhaften Prämissen der klassischen Physik, dass zwischen Teilen eines Systems und dem Ganzen keine Korrelationen angenommen wurden. Die Kategorien der Wesenlehre und das daraus abgeleitete Denkgesetz zeigen, dass immer Korrelationen zwischen dem Ganzen und seinen IN-Teilen anzunehmen sind.
[43] Die LeserInnen werden feststellen, dass die kategorialen Deduktionen der Linie an und in sich bestimmte Ähnlichkeiten mit der oben dargestellten Ableitung in der Grundwissenschaft besitzen. Die Karidonier können die Grundwissenschaft nicht direkt erkennen, da sie IN der Linie leben, schon in ihrem System der Linie 0 lassen sich aber essentielle Kategorien finden. Wir können hier auch den Einwand hören: Nun gut: die Linie 0 wird hier als aktual unendlich postuliert, ein in der heutigen Mathematik unzulässiges Verfahren (vgl. die Probleme der Mengenlehre usw.). Unter welchen Voraussetzungen kann eine Aktual-Unendlichkeit endlicher Größen inhaltlich, ontisch zulässig sein? Nur dann, wenn es für den Menschen auf endliche Weise erkennbar ein unendliches unbedingtes Wesen gibt, IN dem alle endlichen Unendlichkeiten stufenweise deduzierbar sind. Der Satz Lyres: "Wissbar ist aber in endlicher Zeit immer nur endliches Wissen" ist daher grundsätzlich dann mangelhaft, wenn der Mensch Unendliches denken kann. Hier wird versucht zu zeigen, dass dies möglich ist.
[44] Nach der Ontologie der Grundwissenschaft der Wesenlehre, hier nach der Ontologie der Linie 0 entspricht nämlich das noch unendliche Glied e der Natur, welches mit dem gegenähnlichen Glied i (dem Geistwesen) in Gegensatz und Verbindung steht.
[45] In diesen Zusammenhang ist auch die wichtige, in der heutigen Logik und Mathematik fehlende Deduktion der Grenzheitsstufen zu beachten. Die unendliche karidonische Linie hat in sich nur eine Grenzheitsstufe, nämlich die beidseitig begrenzte Linie. In Kirudien, wo die Menschen auf einer unendlichen Fläche leben, zeigt sich, dass diese in alle drei Richtungen unendliche Fläche in sich zwei Arten innerer Grenzheitsstufen besitzt, die oben dargestellt wurden., Schließlich gilt für den unendlichen und unbedingten Raum, dass er in sich 3 Arten innerer Grenzheitsstufen besitzt. Diese ontischen und logischen Ableitungen sind natürlich bei einer Theorie der Natur, jenseits der Weizsäckerschen Ansätze mit den HILBERTräumen zu beachten. Ob eine derartige Theorie des Raumes sachlich, ontisch zulässig ist, was den Annahmen der derzeitigen Physik widerspricht, kann wiederum nur seine letzte Begründung in der Grundwissenschaft erfahren.
[46] Natürlich nur unter der Annahme, dass die Welt nur aus dieser Linie besteht, und auch sonst "kein Raum gegeben ist, IN dem die Linie ist".